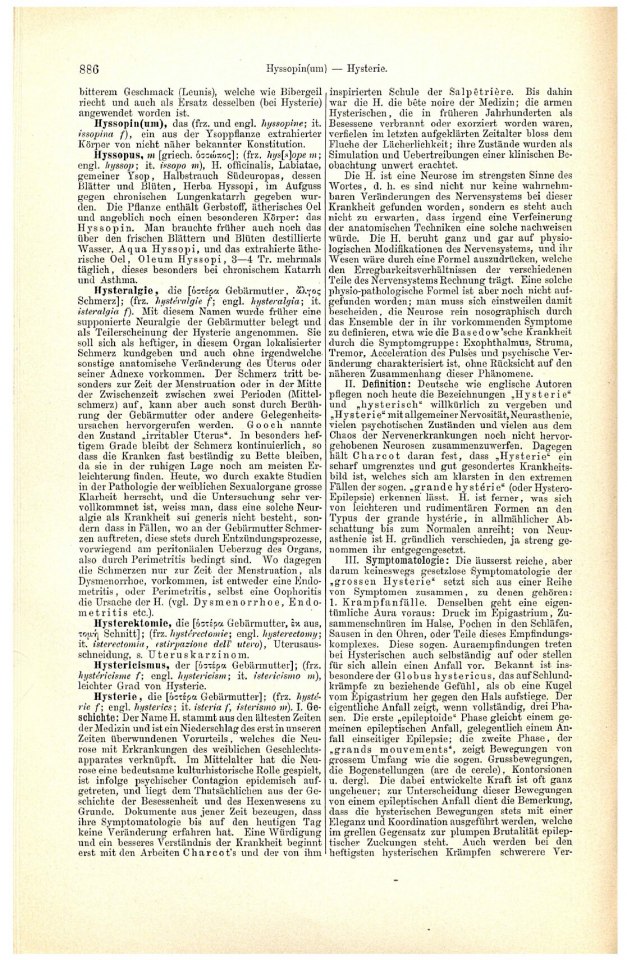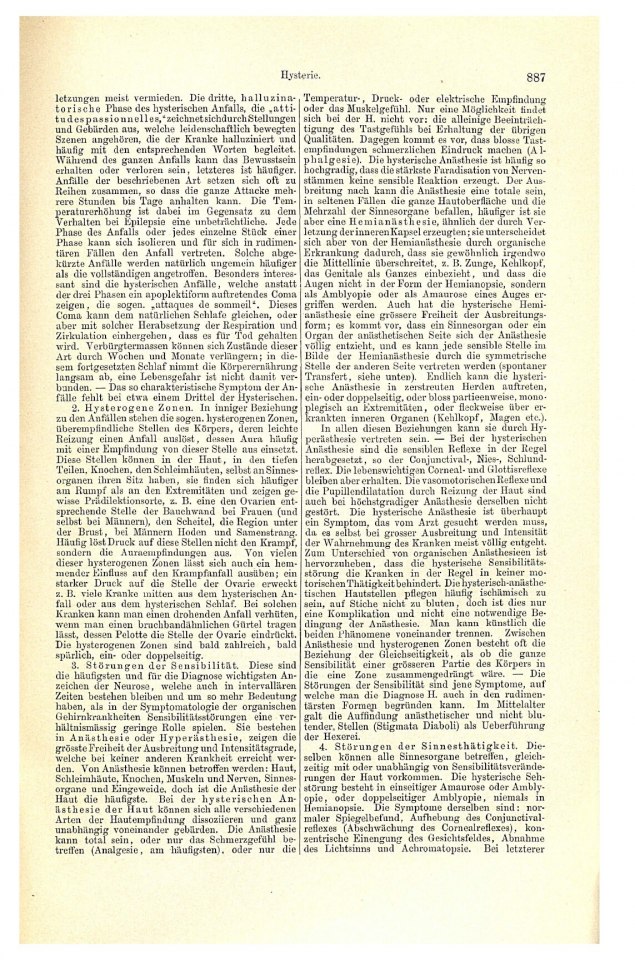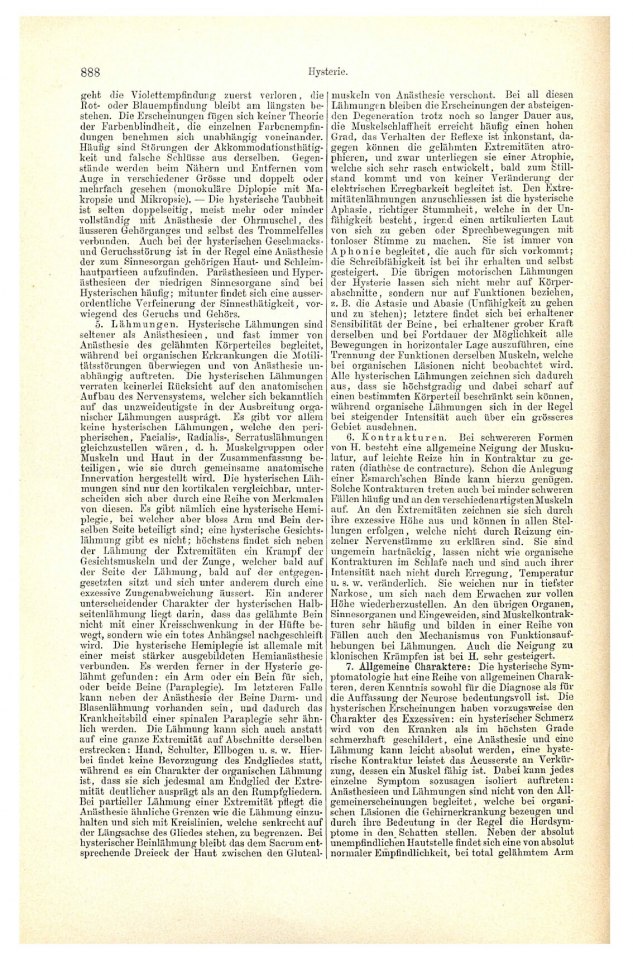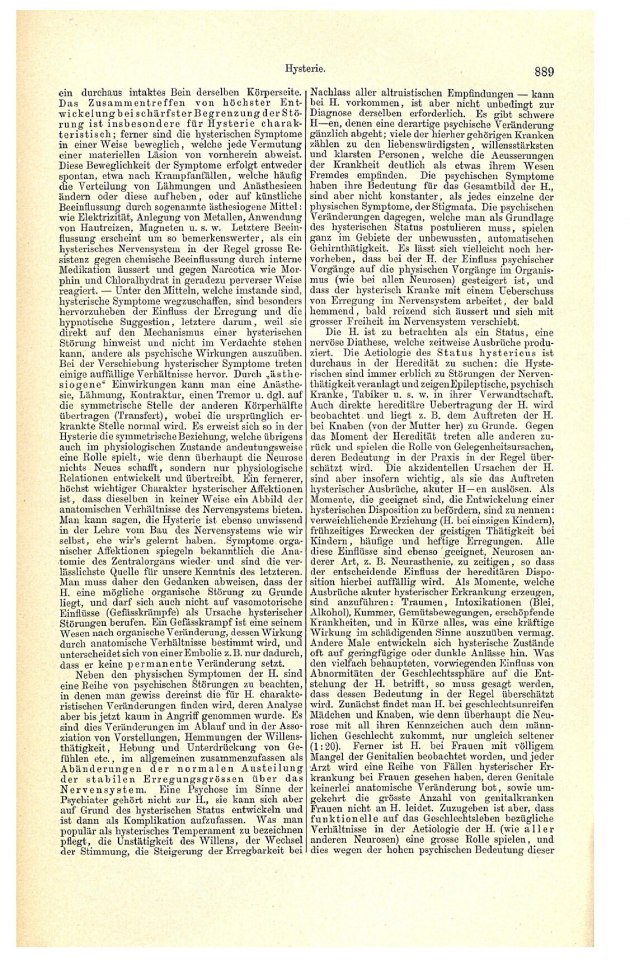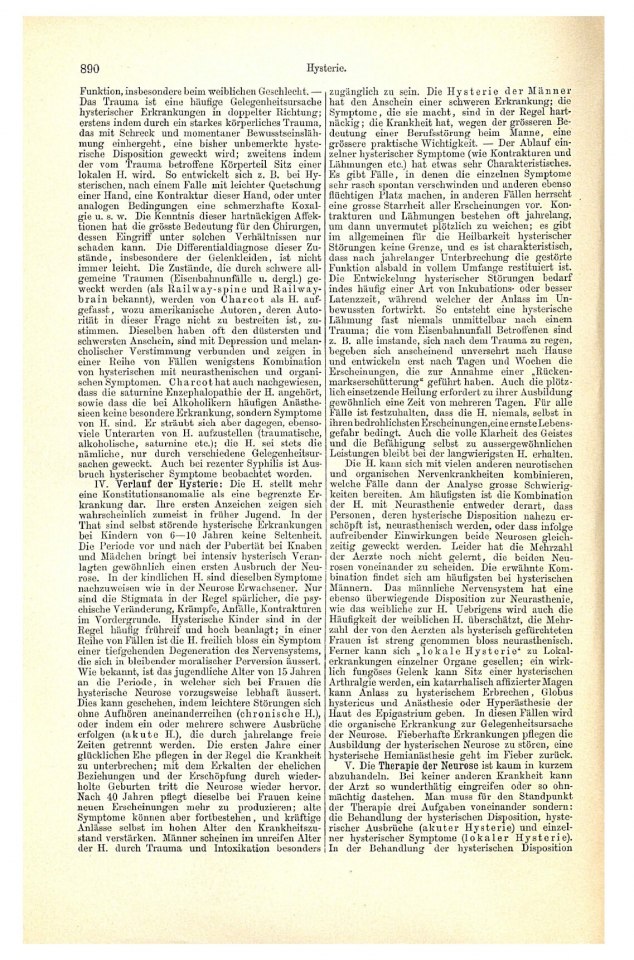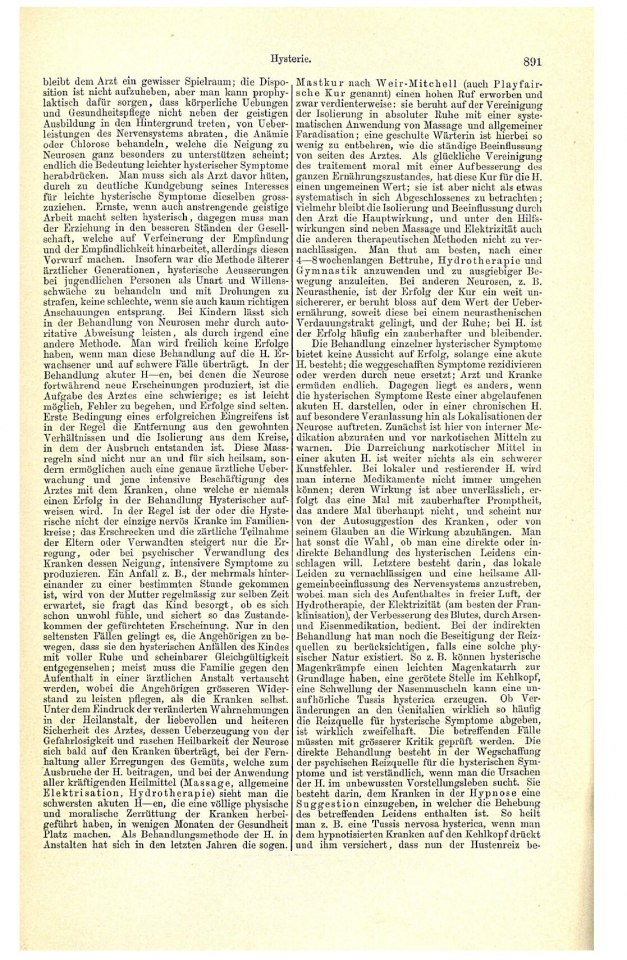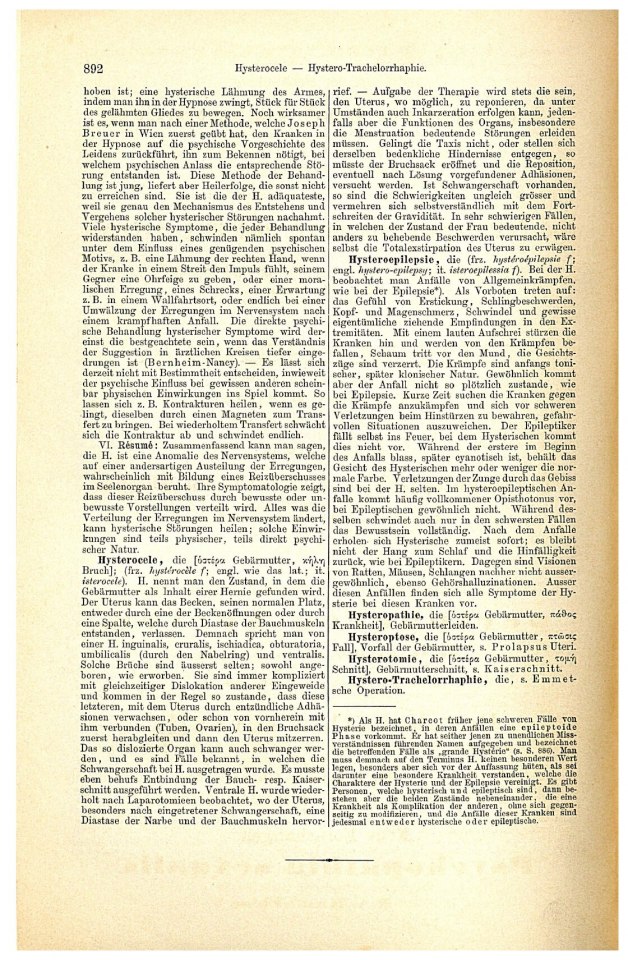S.
886/1
Hysterie, die [ύστέρα, Gebärmutter]; (frz. hysté-
rie f; engl. hysterics; it. isteria f, isterismo m). I. Ge-
schichte: Der Name H. stammt aus den ältesten Zeiten
der Medizin und ist ein Niederschlag des erst in unserer
Zeit überwundenen Vorurteils, welches die Neu-
rose mit Erkrankungen des weiblichen Geschlechts-
apparates verknüpft. Im Mittelalter hat die Neu-
rose eine bedeutsame kulturhistorische Rolle gespielt,
ist infolge psychischer Contagion epidemisch auf-
getreten, und liegt dem Thatsächlichen aus der Ge-
schichte der Besessenheit und des Hexenwesens zu
Grunde. Dokumente aus jener Zeit bezeugen, dass
ihre Symptomatologie bis auf den heutigen Tag
keine Veränderung erfahren hat. Eine Würdigung
und ein besseres Verständnis der Krankheit beginnt
erst mit den Arbeiten Charcot's und der von ihm886/2
inspirierten Schule der Salpětrière. Bis dahin
war die H. die běte noire der Medizin; die armen
Hysterischen, die in früheren Jahrhunderten als
Besessene verbrannt oder exorziert worden waren,
verfielen im letzten, aufgeklärten Zeitalter bloss dem
Fluche der Lächerlichkeit; ihre Zustände wurden als
Simulation und Übertreibungen einer klinischen Be-
obachtung unwert erachtet.Die H. ist eine Neurose im strengsten Sinne des
Wortes, d. h. es sind nicht nur keine wahrnehm-
baren Veränderungen des Nervensystems bei dieser
Krankheit gefunden worden, sondern es steht auch
nicht zu erwarten, daß irgendeine Verfeinerung
der anatomischen Techniken eine solche nachweisen
würde. Die H. beruht ganz und gar auf physio-
logischen Modifikationen des Nervensystems, und ihr
Wesen wäre durch eine Formel auszudrücken, welche
den Erregbarkeitsverhältnissen der verschiedenen
Teile des Nervensystems Rechnung trägt. Eine solche
physio-pathologische Formel ist aber noch nicht auf-
gefunden worden; man muß sich einstweilen damit
bescheiden, die Neurose rein nosographisch durch
das Ensemble der in ihr vorkommenden Symptome
zu definieren, etwa wie die Basedow'sche Krankheit
durch die Symptomgruppe: Exophthalmus, Struma,
Tremor, Acceleration des Pulses und psychische Ver-
änderung charakterisiert ist, ohne Rücksicht auf den
näheren Zusammenhang dieser Phänomene.II. Definition: Deutsche wie englische Autoren
pflegen noch heute die Bezeichnungen „Hysterie“
und „hysterisch“ willkürlich zu vergeben und
„Hysterie“ mit allgemeiner Nervosität, Neurasthenie,
vielen psychotischen Zuständen und vielen aus dem
Chaos der Nervenerkrankungen noch nicht hervor-
gehobenen Neurosen zusammenzuwerfen. Dagegen
hält Charcot daran fest, daß „Hysterie“ ein
scharf umgrenztes und gut gesondertes Krankheits-
bild ist, welches sich am klarsten in den extremen
Fällen der sogenannten „grande hystérie“ (oder Hystero-
Epilepsie) erkennen lässt. H. ist ferner, was sich
von leichteren und rudimentären Formen an den
Typus der grande hystérie, in allmählicher Ab-
schattung bis zum Normalen anreiht; von Neur-
asthenie ist H. grundsätzlich verschieden, ja streng ge-
nommen ihr entgegengesetzt.III. Symptomatologie: Die äußerst reiche, aber
darum keineswegs gesetzlose Symptomatologie der
„großen Hysterie“ setzt sich aus einer Reihe
von Symptomen zusammen, zu denen gehören:1. Krampfanfälle. Denselben geht eine eigen-
thümliche Aura voraus: Druck im Epigastrium, Zu-
sammenschnüren im Halse, Pochen in den Schläfen,
Sausen in den Ohren, oder Teile dieses Empfindungs-
komplexes. Diese sogen. Auraempfindungen treten
bei Hysterischen auch selbständig auf oder stellen
für sich allein einen Anfall vor. Bekannt ist ins-
besondere der Globus hystericus, das auf Schlund-
krämpfe zu beziehende Gefühl, als ob eine Kugel
vom Epigastrium her gegen den Hals aufstiege. Der
eigentliche Anfall zeigt, wenn vollständig, drei Pha-
sen. Die erste, „epileptoide“ Phase gleicht einem ge-
meinen epileptischen Anfall, gelegentlich einem An-
fall einseitiger Epilepsie; die zweite Phase, der
„grands mouvements“, zeigt Bewegungen von
großem Umfang wie die sogen. Grussbewegungen,
die Bogenstellungen (arc de cercle), Kontorsionen
u. dergl. Die dabei entwickelte Kraft ist oft ganz
ungeheuer; zur Unterscheidung dieser Bewegungen
von einem epileptischen Anfall dient die Bemerkung,
dass die hysterischen Bewegungen stets mit einer
Eleganz und Koordination ausgeführt werden, welche
im grellen Gegensatz zur plumpen Brutalität epilep-
tischer Zuckungen steht. Auch werden bei den
heftigsten hysterischen Krämpfen schwerere Ver-S.
letzungen meist vermieden. Die dritte, halluzina-
torische Phase des hysterischen Anfalls, die „atti-
tudes passionelles“ zeichnet sich durch Stellungen
und Gebärden aus, welche leidenschaftliche Bewegungen
Szenen angehören, die der Kranke halluziniert und
häufig mit den entsprechenden Worten begleitet.
Während des ganzen Anfalls kann das Bewusstsein
erhalten oder verloren sein, letzteres ist häufiger.
Anfälle der beschriebenen Art setzen sich oft zu
Reihen zusammen, so dass die ganze Attacke meh-
rere Stunden bis Tage anhalten kann. Die Tem-
peraturerhöhung ist dabei im Gegensatz zu dem
Verhalten bei Epilepsie eine unbeträchtliche. Jede
Phase des Anfalls oder jedes einzelne Stück einer
Phase kann sich isolieren und für sich in rudimen-
tären Fällen den Anfall vertreten. Solche abge-
kürzte Anfälle werden natürlich ungemein häufiger
als die vollständigen angetroffen. Besonders interes-
sant sind die hysterischen Anfälle, welche anstatt
der drei Phasen ein apoplektikom mißdeutendes Coma
zeigen, die sogen. „attaques-de-sommeil“.
Dieses
Coma kann dem natürlichen Schlafe gleichen, oder
aber an Anomalien der Herztätigkeit, der Respiration und
Zirkulation einhergehen, dass es für Tod gehalten
wird. Vorübergehenszeiten können sich Zustände dieser
Art durch Wochen und Monate verlängern, an die-
sem fortgesetzten Schlaf nimmt die Körperernährung
hingegen ab, eine Lebensgefahr ist nicht damit ver-
bunden. Das so charakteristische Symptom der An-
fälle fehlt bei etwa einem Drittel der Hysterischen.
2. Hystero
gene Zonen. In inniger Beziehung
zu den Anfällen stehen die sogen. hysterogenen Zonen,
überempfindliche Stellen des Körpers, deren leichte
Reizung einen Anfall auslöst, dessen Aussetzen
mit einer Empfindung von dieser Stelle aus einsetzt.
Diese Stellen können in der Haut, in den tiefen
Teilen, Knochen, den Schleimhäuten, selbst an Nerven-
stämmen ihren Sitz haben, sie finden sich häufiger
am Rumpf als an den Extremitäten und zeigen ge-
wisse Prädilektionsorte, z. B. eine den Ovarien ent-
sprechende Stelle der Bauchwand bei Frauen (und
selbst bei Männern), dem Scheitel, die Region unter
der Brust, bei Männern Hoden und Samenstrang.
Häufig löst **Druck** auf diese Stellen nicht nur Krampf,
sondern die Anfallsfortsetzungen aus. Von vielen
dieser hysterogenen Zonen lässt sich auch ein hem-
mender Einfluss auf den Krampfanfall ausüben, ein
starker Druck auf die Stelle der Ovarien erweckt
z. B. viele Kranke mitten aus dem hysterischen An-
fall oder aus dem hysterischen Schlaf. Bei solchen
Kranken kann man einen drohenden Anfall verhüten,
wenn man einen bauchbandähnlichen Gürtel tragen
lässt, dessen Pelotte die Stelle der Ovarien eindrückt.
Die hysterogenen Zonen sind bald zahlreich, bald
spärlich, ein- oder doppelseitig.
3. Störungen der Sensibilität.
Diese sind
die häufigsten und für die Diagnose wichtigsten An-
zeichen der Neurose, welche auch in Intervall-
zeiten bestehen bleiben und um so mehr Beachtung
haben, als in der Symptomatologie der organischen
Gehirnkrankheiten Sensibilitätsstörungen eine ver-
hältnismässig geringe Rolle spielen. Sie bestehen
in Anästhesie oder Hypaästhesie, zeigen die
grösste Feinheit der Ausbreitung und Intensitätsgrade,
welche bei keiner anderen Krankheit erreicht wer-
den. Die Anästhesie können betroffen werden: Haut,
Schleimhäute, Knochen, Muskeln und Nerven, Sinn-
organe und Eingeweide, doch ist die Anästhesie der
Haut die häufigste. Bei der hysterischen An-
ästhesie der Haut können sich alle verschiedenen
Arten der Hautempfindung dissoziieren und ganz
unabhängig voneinander gebärden. Die Anästhesie
kann total sein oder nur das Schmerzgefühl be-
treffen (Analgesie, am häufigsten), oder nur die
Temperatur-, Druck- oder elektrische Empfindung
oder das Muskelgefühl. Nur eine Möglichkeit findet
sich bei der H. nicht vor: die isolierte Beteiligung
des Tastgefühls bei Erhaltung der übrigen
Qualitäten. Dagegen kommt es vor, dass blosse Tast-
empfindungen schmerzlosem Eindruck machen (Al-
phalgesie). Die hysterische Anästhesie ist häufig so
hochgradig, dass die stärkste Reizung von Nerven-
stämmen keine sensible Reaktion erzeugt. Der Aus-
breitung nach kann die Anästhesie eine totale sein,
in selteneren Fällen die ganze Körperoberfläche und die
Mehrzahl der Sinnesorgane befallen, häufiger ist sie
aber eine Hemianästhesie, ähnlich der durch Ver-
letzung der inneren Kapsel erzeugten, sie unterscheidet
sich aber von der Hemianästhesie durch organische
Erkrankung dadurch, dass sie gewöhnlich irgendwo
die Mittellinie überschreitet, z. B. Zunge, Kehlkopf,
das Genitale als Ganzes einbezieht und dass die
Augen nicht in der Form der Hemianopsie, sondern
als Amblyopie oder als Amaurose eines Auges er-
griffen werden. Auch hat die hysterische Hemi-
anästhesie eine grössere Freiheit der Ausbreitung,
gegen sie kommt vor, dass ein Stumpfzonen oder an
Organ der anästhetischen Seite sich der Anästhesie
völlig entzieht und es kann jede sensible Stelle im
Bilde der Hemianästhesie durch die symmetrische
Stelle der anderen Seite vertreten werden (spontaner
Transfer, siehe unten). Endlich kann die hysteri-
sche Anästhesie in zerstreuten Herden auftreten,
ein- oder doppelseitig, oder blos partienweise, mono-
plegisch an Extremitäten oder flächenweise, über er-
krankten inneren Organen (Kehlkopf, Magen etc.).
In allen diesen Beziehungen kann sie durch Hy-
perästhesie vertreten sein. Bei der hysterischen
Anästhesie sind die sensiblen Reflexe in der Regel
herabgesetzt, so der Conjunctival-, Nies-, Schlund-
reflex. Die Lebenswichtigkeit: Corneal- und Glottisreflexe
bleiben aber erhalten. Die vasomotorischen Reflexe und
die Pupillardilatation durch Reizung der Haut sind
auch bei höchstgradiger Anästhesie derselben nicht
gestört. Die hysterische Anästhesie ist überhaupt
ein Symptom, das vom Arzt gesucht werden muss,
da es selbst bei grosser Ausbreitung und Intensität
der Wahrnehmung des Kranken meist völlig entgeht.
Zum Unterschied von organischen Anästhesien ist
hervorzuheben, dass die hysterische Sensibilitäts-
störung in der Regel in keiner mo-
torischen Tätigkeit behindert. Die hysterisch-anästhe-
tischen Hautstellen pflegen häufig ischämisch zu
sein, auf Stiche nicht zu bluten, doch ist dies nur
eine Komplikation und nicht eine notwendige Be-
dingung der Anästhesie. Man kann künstlich die
beiden Phänomene voneinander trennen. Zwischen
Anästhesie und hysterogenen Zonen besteht oft die
Beziehung der Gleichseitigkeit, als ob die ganze
Sensibilität einer grösseren Hälfte des Körpers in
die eine Zone zusammen
gedrängt wäre.
Die
Störungen der Sensibilität sind jene Symptome, auf
welche man die Diagnose H. auch in den rudimen-
tärsten Formen begründen kann. Im Mittelalter
galt die Auffindung anästhetischer und nicht blu-
tender Stellen (Stigmata Diaboli) als Überführung
der Hexerei.
4. Störungen der Sinnestätigkeit.
Die-
selben können alle Sinnnesorgane betreffen, gleich-
zeitig mit oder unabhängig von Sensibilitätsverände-
rungen der Haut vorkommen. Die hysterische Stö-
rung besteht in einseitiger Amaurose oder Ambly-
opie, oder doppelseitiger Amblyopie, niemals in
Hemianopsie. Die Symptome derselben sind: nor-
maler Spiegelbefund, Aufhebung des Conjunctival-
reflexes (Abschwächung des Cornealreflexes), kon-
zentrische Einengung des Gesichtsfeldes, Abnahme
des Lichtsinns und Achromatopsie. Bei letzterer
S.
geht die Violettempfindung zuerst verloren, die
Rot- oder Blauempfindung bleibt am längsten be-
stehen. Die Erscheinungen für sich als keine Neurose
der Farbenblindheit, die einzelnen Farbenempfin-
dungen benehmen sich unabhängig voneinander.
Häufig sind Störungen der Akkommodationsfähig-
keit und falsche Schlüsse aus derselben. Gegen-
stände werden beim Nähern und Entfernen vom
Auge in verschiedener Grösse und doppelt oder
mehrfach gesehen (monokuläre Diplopie mit Ma-
kropsie und Mikropsie). Die hysterische Taubheit
ist selten doppelseitig, meist mehr oder minder
vollständig mit Anästhesie der Ohrmuschel, des
äusseren Gehörganges und selbst des Trommelfelles
verbunden. Auch bei der hysterischen Geschmacks-
und Geruchsstörung ist in der Regel eine Anästhesie
des zum Sinnnesorgan gehörigen Haut- und Schleim-
hautpartieen aufzufinden. Bei hysterischen Läh-
mungen sind die niederen Sinnnesorgane und bei
hysterischen Fiebern mitunter findet sich ein ausser-
ordentlicher Verfeinerung der Sinnestätigkeit, vor-
wiegend des Geruchs und Gehörs.
5. Lähmungen. Hysterische Lähmungen sind
seltener als Anästhesieen, und fast immer von
Anästhesie des gelähmten Körperteiles begleitet,
während bei organischen Erkrankungen die Motorik
tätstörungen überwiegen und von Anästhesie un-
abhängig auftreten. Die hysterischen Lähmungen
entstammen keinerlei Rücksicht auf den anatomischen
Aufbau des Nervensystems, welcher sich bekanntlich
auf das unveränderte in der Ausbreitung orga-
nischer Lähmungen ausprägt. Es gibt vor allem
keine hysterischen Lähmungen, welche den per-
ipherischen **Partialis-, Radialis-, Serratus**lähmungen
gleichzustellen wären, d. h. Muskelgruppen oder
Muskeln und Haut in der Weise sich beteiligen,
wie sie durch gemeinsame anatomische
Innervation hergestellt wird. Die hysterischen Läh-
mungen sind mit den kortikalen vergleichbar, unter-
scheiden sich aber durch eine Reihe von Merkmalen
von diesen. Es gibt nämlich eine hysterische Hemi-
plegie, bei welcher alle, blos Arm und Bein der-
selben Seite beteiligt sind; eine hysterische Gesichts-
lähmung gibt es nicht; höchstens findet sich neben
der Lähmung der Extremität ein Krampf in
der Gesichtsmuskeln und der Zunge, welcher bald auf
der Seite der Lähmung, bald auf der entgegen-
gesetzten sitzt und sich unter anderem durch ein
exzessive Zungenabweichung äussert. Ein anderer
unterscheidender Charakter der hysterischen Halb-
seitenlähmung liegt darin, dass das gelähmte Bein
nicht mit einer Kreisschwenkung in der Hüfte be-
wegt, sondern wie ein totes Anhängsel nachgeschleift
wird. Die hysterische Hemiplegie ist allemal mit
einer meist stärker ausgebildeten Hemianästhesie
verbunden. Es werden ferner in der Hysterie ge-
häuft gefunden: ein Arm oder ein Bein für sich,
oder beide Beine (Paraplegie). Im letzteren Falle
kann neben der Anästhesie der Beine Darm- und
Blasenlähmung vorhanden sein, und dadurch das
Krankheitsbild einer spinalen Paraplegie sehr ähn-
lich werden. Diese Lähmung kann sich auch noch
auf eine ganze Extremität auf Abschnitte desselben
erstrecken: Hand, Schulter, Ellbogen u. s. w. Hier-
bei findet keine Bewegung des Endgliedes statt,
während es ein Charakter der organischen Lähmung
ist, dass sich siech jedesmal am Endglied der Extre-
mität deutlicher ausprägt als an der Rumpfgliedern.
Bei partieller Lähmung einer Extremität pflegt die
Anästhesie ähnlicher Grenzen weichen, wie man An-
halten und sich mit Kreisschnitten der Geruch auf
der Längsachse des Gliedes ziehen, zu begrenzen. Bei
hysterischer Beinlähmung bleibt zu dem Sensum ent-
sprechende Dreieck der Haut zwischen den Gluteal-
Muskeln von Anästhesie verschont. Bei all diesen
Lähmungen bleiben die Erscheinungen der absteigen-
den Degeneration trotz noch so langer Dauer aus,
die Muskelleerhaftigkeit erreicht häufig einen hohen
Grad, das Verhalten der Reflexe ist inkonstant, da-
gegen können die gelähmten Extremitäten atro-
phieren, und zwar unterliegen sie einer Atrophie,
welche sich sehr rasch entwickelt, bald zum Still-
stand kommt und von keiner Veränderung der
elektrischen Erregbarkeit begleitet ist. Den Extre-
mitätenlähmungen angeschlossen ist die hysterische
Aph
asie, richtiger Stummheit, welche in der Un-
fähigkeit besteht irgend einen artikulierten Laut
von sich zu geben oder Sprechbewegungen mit
tonlosen Stimme zu machen. Sie ist indessen von
Aph
onie begleitet, die auch für sich vorkommt,
die Schreibfähigkeit ist bei ihr erhalten und voll-
ständiger. Den übrigen motorischen Lähmungen
der Hysterie lassen sich nicht mehr auf Körper-
abschnitte, sondern nur auf Funktionen beziehen,
z. B. die Astasie und Abasie (Unfähigkeit zu gehen
und zu stehen); letztere findet sich bei erhaltenem
Fussgefühl der Beine, bei erhaltener grober Kraft
derselben und bei Fortdauer der Möglichkeit alle
Bewegungen in horizontaler Lage auszuführen, eine
Trennung der Funktionen derselben Muskeln, welche
bei organischen Läsionen nicht beobachtet wird.
Alle hysterischen Lähmungen zeichnen sich dadurch
aus, dass sie höchstgradig und dabei scharf auf
einen bestimmten Körperteil beschränkt sein können,
während organische Lähmungen sich in der Regel
bei steigender Intensität auch über ein grösseres
Gebiet ausdehnen.
6. Kontrakturen.
Bei schwereren Formen
von H. besteht eine allgemeine Neigung der Musku-
latur auf leichte Reize hin in Kontraktur zu ge-
raten (Di
athese de contracture). Selten die Anlegung
einer Esmarch
schen Binde kann hierzu genügen.
Solche Kontrakturen treten auch bei minder schweren
Fällen häufig und an den verschiedenartigsten Stellen
auf. An den Extremitäten zeichnen sie sich durch
ihre exzessive Höhe aus und können in allen Stel-
lungen erfolgen, welche nicht durch Reizung ein-
zelner Nervenstämme zu erklären sind. Sie sind
**unangenehm**, lassen nicht wie
organischen
Kontrakturen im Schlafe nach und sind auch ihrer
Intensität nach nicht durch Erregung, Temperatur
u. s. w. veränderlich. Sie weichen nur in tiefer
Narkose, um sich nach dem Erwachen zur vollen
Höhe wiederherzustellen. An den übrigen Organen,
Sinnesorganen und Eingeweiden sind Muskelkontrak-
turen sehr häufig und bilden in einer Reihe von
Fällen auch den Mechanismus von Funktionsein-
bussung bei Lähmungen. Auch die Neigung zu
klonischen Krämpfen ist bei H. sehr geneigt.
7. Allgemeine Charakteristik.
Die hysterische Sym-
ptomatologie hat eine Reihe von allgemeinen Charak-
teren, deren Kenntnis sowohl für die Diagnose als für
die Auffassung der Neurose bedeutungsvoll ist. Die
hysterischen Erscheinungen haben vorzugsweise den
Charakter des Exzessiven: ein hysterischer Schmerz
wird von den Kranken auf in höchstem Grade
schmerzhaft geschildert, eine Anästhesie und eine
Lähmung kann leicht absolut werden, eine hyste-
rische Kontraktur leistet die Äusserste an Verkür-
zung, dessen ein Muskel fähig ist. Dabei kann jedes
einzelne Symptom sozusagen isoliert auftreten.
Anästhesieen und Lähmungen sind nicht von den All-
gemeinerscheinungen begleitet, welche bei organi-
schen Läsionen die Reizungskrankheiten erzeugen und
durch ihre Bedeutung in der Regel die Hord
symp
to
me
in den Schatten stellen. Selten der absolut
unempfindlichen Hautstelle findet sich eine absolut
normaler Empfindlichkeit, bei total gelähmtem Arm
S.
ein durchaus intaktes Bein derselben Körperseite.
Das Zusammentreffen von höchster Ent-
wickelung beischärfster Begrenzung der Stö-
rung ist insbesondere für hysterische Charak-
teristik, ferner sind die hysterischen Symptome
in einer Weise beweglich, welche jede Vermutung
einer materiellen Läsion von vornherein abweist.
Diese Beweglichkeit der Symptome erfolgt entweder
spontan, etwa nach Krampfanfällen, welche häufig
die Verteilung von Lähmungen und Anästhesien
ändern oder diese aufheben, oder auf künstliche
Beinflussung durch sogenannte ätiologische Mittel
wie Elektrizität, Niesung von Metallen, Anwendun
von Hautreizen, Magneten u. s. w. Letztere Beein-
flussung erscheint um so bemerkenswerter, als ein
hysterisches Nervensystem in der Regel grosser Re-
sistenz gegen chemische Beeinflussung durch innere
Medikation anbietet und gegen Narcotica, wie Mor-
phin und Chloralhydrat in geradezu perverser Weise
reagiert. Unter den Mitteln, welche imstande sind
hysterische Symptome wegzuschaffen, sind besonders
hervorzuheben der Einfluss der Erregung und die
hypnotische Suggestion, letztere darum, weil sie
direkt auf den Mechanismus einer hysterischen
Störung hinweist und nicht im Verdachte stehen
kann, andere als psychische Wirkungen auszuüben.
Bei der Verschiebung hysterischer Symptome treten
einige auffällige Verhältnisse hervor. Durch Anästhe-
sieen
können bewirkt werden: eine Anästhe-
sie, Lähmung, Kontraktur, einen Tremor u. dgl. auf
die symmetrische Stelle des anderen Körperhälften
übertragen (Transfer), wobei die ursprünglich er-
krankte Stelle normal wird. Es erweist sich so in der
Hysterie die symmetrische Beziehung, welche übrigens
auch im physiologischen Zustande anordnungsweise
eine Rolle spielt, wie denn überhaupt die Neurose
richtig diesen Inhalt, sondern nur physiologische
Reaktionen entwickelt und übertreibt. Ein fernerer,
höchst wichtiger Charakter hysterischer Affektionen
ist, dass dieselben in keiner Weise ein Abbild der
anatomischen Verhältnisse des Nervensystems bieten.
Man kann sagen, die Hysterie ist ebenso unwissend
in der Lehre von Bau des Nervensystems wie
wir
selbst, ehe wir's gelernt haben. Symptome orga-
nischer Affektionen spiegeln bekannlich die Ana-
tomie der Centralorgane wieder und sind die ver-
lässlichste Quelle für neue Kenntnis des letzteren.
Man muss daher den Gedanken abweisen, dass der
H. eine mögliche organische Störung zu Grunde
liegt, und darf auch nicht an vasomotorische
Einflüsse (Gefässkrampf) als Ursache hysterischer
Störungen berufen. Ein Gefässkrampf ist eine seinem
Wesen nach organische Veränderung, dessen Wirkung
durch anatomische Verhältnisse bestimmt wird, und
unterscheidet sich von einer Embolie z. B. nur dadurch,
dass er keine permanente Veränderung setzt.
Neben den physischen Symptomen der H. sind
eine Reihe von psychischen Störungen zu beachten,
in denen man gewisse Vereinst für die H. charakte-
ristischen Veränderungen finden wird, deren Analyse
aber bis jetzt kaum in Angriff genommen wurde. Es
sind dies Veränderungen im **Allgemeinzustand** in der Asso-
ziation von Vorstellungen, Hemmungen der Willens-
tätigkeit, **Hypnosen** und Unterdrückung von Ge-
fühlen etc., im allgemeinen zusammenfassen als
Abänderungen der **normalen Ausstellung**
der subtilen Erregungsgrössen über das
Nervensystem. Eine Psychose im Sinne der
Psychiater gehört nicht zur H., sie kann sie aber
auf Grund der hysterischen Diathese entwickeln und
ist dann als Komplikation aufzufassen. Was man
populär als hysterisches Temperament zu bezeichnen
pflegt, die Unstätigkeit der Gefühle, der Wechsel
der Stimmung, die Steigerung der Erregbarkeit bei
Nachlass aller altruistischen Empfindungen – kann
bei H. vorkommen, ist aber nicht unbedingt zur
Diagnose derselben erforderlich. Es gibt schwere
Formen, denen eine derartige psychische Grundlage
gänzlich abgeht; viele der hierher gehörigen Kranken
zählen zu den liebenswürdigsten, willensstärksten
und klarsten Personen, welche die Äusserungen
der Krankheit deutlich als etwas ihrem Wesen
fremdes empfinden. Die psychischen Symptome
haben ihre Bedeutung für das Gesamtbild der H.,
sind aber nicht konstanter, als jede einzelne der
physischen Komplexe, der Stigmate. Die psychischen
Veränderungen dagegen, welche man als Grundlage
des hysterischen Status postulieren muss, spielen
ganz im Gebiete der Unbewussten, automatischen
Gehirnthätigkeit. Es lässt sich vielleicht noch her-
vorheben, dass bei der H. der Einfluss psychischer
Vorgänge auf die physischen Vorgänge im Organis-
mus (wie bei allen Neurosen) gesteigert ist, und
dass die hysterische Kranke mit einer Ueberschuss
von Erregung im Nervensystem arbeitet, der bald
hemmend, bald reizend sich äussert und sich mit
grosser Freiheit im Nervensystem verschiebt.
Die H. ist zu betrachten als ein Status, eine
nervöse Diathese, welche zeitweise Ausbrüche produ-
ziert. Die Ätiologie des Status h
ysteri
scher
durchaus in der Heredität zu suchen: die Hyste-
rischen sind immer Erblich, Störungen der Nerven-
thätigkeit vererbt u. s. w. In ihrer Verwandtschaft
hysterische Kranke, Träumer u. s. w. an ihrer Verwandtschaft
auch direkte hereditäre Uebertragung der H. wird
beobachtet und liegt z. B. dem Auftreten der H.
bei Knaben (von der Mutter her) zu Grunde. Gegen
die Moment der Heredität treten alle anderen zu-
rück und spielen die Rolle von Gelegenheitsursachen,
deren Bedeutung in der Praxis in der Regel über-
schätzt wird. Die anziehendsten Ursachen der H.
sind aber insofern wichtig, als sie das Auftreten
hysterischer Ausbrüche akuter H. zu entblössen.
Als
solche sind geeignet, eine die Entwickelung einer
hysterischen Disposition zu befördern, sind zu nennen:
verweichlichende Erziehung (bei einzigen Kindern
frühzeitiges Erwecken der geistigen Thätigkeit bei
Kindern, häufige und heftige Erregungen). Alle
diese Einflüsse sind ebenso geeignete Neurosen an-
derer Art, z. B. Neurasthenie zu zeitigen, so dass
der entscheidende Einfluss der hereditären Dispo-
sition neben anfällig wird. Als Momente, welche
Ausbrüche akuter hysterischer Erkrankung erzeugen,
sind anzuführen: **Traumen**, **Intoxikationen** (Blei,
Alkohol, Kummer), Gemütsbewegungen, erschöpfende
Krankheiten und in Kürze alles, was eine kräftige
Wirkung im schwächeren Sinne auszuüben vermag.
Andere Male entwickeln sich hysterische Zustände
oft auf geringfügiger oder dunkler Anlässe hin. Was
den vielfach diskutierten, verriegelnden Einfluss von
Abnormitäten der Geschlechtssphäre auf die Ent-
stehung der H. betrifft, so muss gesagt werden,
dass dessen Bedeutung in der Regel überschätzt
wird. Zunächst findet man H. bei Geschlechtsreifen
Mädchen und Knaben, wie denn überhaupt die Neu-
rosen oft all ihren Kennzeichen auch dem seltenen
Geschlecht zukommt, nur ungleich seltener
(1:20). Ferner ist H. auch bei Frauen seit stillender
Mangel der Genitalien beobachtet worden, und jeder
Arzt wird eine Reihe von Fällen hysterischer Er-
krankung bei Frauen gesehen haben, deren Genitale
keinerlei anatomische Veränderung bot, sowie um-
gekehrt die grösste Anzahl von **Genitalkranken**
Frauen nicht an H. leiden. Zuzugeben ist aber, dass
funktionelle auf das Geschlechtsleben bezügliche
Verhältnisse in der Ätiologie der H. (wie all
anderen Neurosen) eine grosse Rolle spielen und
dies wegen der hohen psychischen Bedeutung dieser
S.
890
[Spatium 1]
Funktion, insbesondere beim weiblichen Geschlecht. –
Das Trauma ist eine häufige Gelegenheitsursache
hysterischer Erkrankungen in doppelter Richtung;
erstens indem durch ein starkes körperliches Trauma,
das mit Schreck und momentaner Bewusstseinsläh-
mung einhergeht, eine bisher unbemerkte hyste-
rische Disposition geweckt wird; zweitens indem
der vom Trauma betroffene Körperteil Sitz einer
lokalen H. wird. So entwickelt sich z. B. bei Hy-
sterischen, nach einem Falle mit leichter Quetschung
einer Hand, eine Kontraktur dieser Hand oder, unter
analogen Bedingungen, eine schmerzhafte Koxal-
gie u. s. w. Die Kenntnis dieser hartnäckigen Affek-
tionen hat die größte Bedeutung für den Chirurgen,
dessen Eingriff unter solchen Verhältnissen nur
schaden kann. Die Differentialdiagnose dieser Zu-
stände, insbesondere der Gelenkleiden, ist nicht
immer leicht. Die Zustände, die durch schwere all-
gemeine Traumen (Eisenbahnunfälle u. dergl.) ge-
weckt werden (als Railway-spine und Railway-
brain bekannt), werden von Charcot als H. auf-
gefasst, wozu amerikanische Autoren, deren Auto-
rität in dieser Frage nicht zu bestreiten ist, zu-
stimmen. Dieselben haben oft den düstersten und
schwersten Anschein, sind mit Depressionen und melan-
cholischer Verstimmung verbunden und zeigen in
einer Reihe von Fällen wenigstens Kombination
von hysterischen mit neurasthenischen und organi-
schen Symptomen. Charcot hat auch nachgewiesen,
dass die saturnine Enzephalopathie der H. angehört,
sowie dass die bei Alkoholikern häufigen Anästhe-
sien keine besondere Erkrankung, sondern Symptome
von H.sind. Er sträubt sich aber dagegen, ebenso-
viele Unterarten von H. aufzustellen (traumatische,
alkoholische, saturnine etc.); die H. sei stets die
nämliche, nur durch verschiedene Gelegenheitsur-
sachen geweckt. Auch bei rezenter Syphilis ist Aus-
bruch hysterischer Symptome beobachtet worden.IV. Verlauf der Hysterie: Die H. stellt mehr
eine Konstitutionsanomalie als eine begrenzte Er-
krankung dar. Ihre ersten Anzeichen zeigen sich
wahrscheinlich zumeist in früher Jugend. In der
Tat sind selbst störende hysterische Erkrankungen
bei Kindern von 6-10 Jahren keine Seltenheit.
Die Periode vor und nach der Pubertät bei Knaben
und Mädchen bringt bei intensiv hysterisch Veran-
lagten gewöhnlich einen ersten Ausbruch der Neu-
rose. In der kindlichen H. sind dieselben Symptome
nachzuweisen wie in der Neurose Erwachsener. Nur
sind die Stigmata in der Regel spärlicher, die psy-
chische Veränderung, Krämpfe, Anfälle, Kontrakturen
im Vordergrunde. Hysterische Kinder sind in der
Regel häufig frühreif und hoch beanlagt; in einer
Reihe von Fällen ist die Hysterie freilich bloss ein Symptom
einer tiefgehenden Degeneration des Nervensystems,
die sich in bleibender moralischer Perversion äussert.
Wie bekannt, ist das jugendliche Alter von 15 Jahren
an die Periode, in welcher sich bei Frauen die
hysterische Neurose vorzugsweise lebhaft äußert.
Dies kann geschehen, indem leichtere Störungen sich
ohne Aufhören aneinanderreihen (chronische H.),
oder indem ein oder mehrere schwere Ausbrüche
erfolgen (akute H.), die durch jahrelange freie
Zeiten getrennt werden. Die ersten Jahre einer
glücklichen Ehe pflegen in der Regel die Krankheit
zu unterbrechen; mit dem Erkalten der ehelichen
Beziehungen und der Erschöpfung durch wieder-
holte Geburten tritt die Neurose wieder hervor.
Nach 40 Jahren pflegt dieselbe bei Frauen keine
neuen Erscheinungen mehr zu produzieren; alte
Symptome können aber fortbestehen, und kräftige
Anlässe selbst im hohen Alter den Krankheitszu-
stand verstärken. Männer scheinen im unreifen Alter
der Hysterie durch Trauma und Intoxikation besonders–––
[Spatium 2]zugänglich zu sein. Die Hysterie der Männer
hat den Anschein einer schweren Erkrankung; die
Symptome, die sie macht, sind in der Regel hart-
näckig; die Krankheit hat, wegen der grösseren Be-
deutung einer Berufsstörung beim Manne, eine
größere praktische Wichtigkeit. – Der Ablauf ein-
zelner hysterischer Symptome (wie Kontrakturen und
Lähmungen etc.) hat etwas sehr Charakteristisches.
Es gibt Fälle, in denen die einzelnen Symptome
sehr rasch spontan verschwinden und anderen ebenso
flüchtigen Platz machen, in anderen Fällen herrscht
eine grosse Starrheit aller Erscheinungen vor. Kon-
trakturen und Lähmungen bestehen oft jahrelang,
um dann unvermutet plötzlich zu weichen; es gibt
im allgemeinen für die Heilbarkeit hysterischer
Störungen keine Grenze, und es ist charakteristisch,
dass nach jahrelanger Unterbrechung die gestörte
Funktion alsbald in vollem Umfange restituiert ist.
Die Entwickelung hysterischer Störungen bedarf
indes häufig einer Art von Inkubations- oder besser
Latenzzeit, während welcher der Anlaß im Un-
bewussten fortwirkt. So entsteht eine hysterische
Lähmung fast niemals unmittelbar nach einem
Trauma; die vom Eisenbahnunfall Betroffenen sind
z. B. alle imstande, sich nach dem Trauma zu regen,
begeben sich anscheinend unversehrt nach Hause
und entwickeln erst nach Tagen und Wochen die
Erscheinungen, die zur Annahme einer „Rücken-
markserschütterung" geführt haben. Auch die plötz-
lich einsetzende Heilung erfordert zu ihrer Ausbildung
gewöhnlich eine Zeit von mehreren Tagen. Für alle
Fälle ist festzuhalten, daß die H. niemals, selbst in
ihren bedrohlichsten Erscheinungen,eine ernste Lebens-
gefahr bedingt. Auch die volle Klarheit des Geistes
und die Befähigung selbst zu außergewöhnlichen
Leistungen bleibt bei der langwierigsten H. erhalten.Die H. kann sich mit vielen anderen neurotischen
und organischen Nervenkrankheiten kombinieren,
welche Fälle dann der Analyse grosse Schwierig-
keiten bereiten. Am häufigsten ist die Kombination
der H. mit Neurasthenie entweder derart, dass
Personen, deren hysterische Disposition nahezu er-
schöpft ist, neurasthenisch werden oder dass infolge
aufreibender Einwirkungen beide Neurosen gleich-
zeitig geweckt werden. Leider hat die Mehrzahl
der Aerzte noch nicht gelernt, die beiden Neu-
rosen voneinander zu scheiden. Die erwähnte Kom-
bination findet sich am häufigsten bei hysterischen
Männern. Das männliche Nerven-system hat eine e
benso überwiegende Disposition zur Neurasthenie,
wie das weibliche zur H.. Übrigens wird auch die
Häufigkeit der weiblichen H. überschätzt, die Mehr-
zahl der von den Aerzten als hysterisch gefürchteten
Frauen ist strenggenommen bloß neurasthenisch.
Ferner kann sich „lokale Hysterie" zu Lokal-
erkrankungen einzelner Organe gesellen; ein wirk-
lich fungöses Gelenk kann Sitz einer hysterischen
Arthralgie werden, ein katarrhalisch affizierter Magen
kann Anlaß zu hysterischem Erbrechen, Globus
hystericus und Anästhesie oder Hyperästhesie der
Haut des Epigastrium geben. In diesen Fällen wird
die organische Erkrankung zur Gelegenheitsursache
der Neurose. Fieberhafte Erkrankungen pflegen die
Ausbildung der hysterischen Neurose zu stören, eine
hysterische Hemianästhesie geht im Fieber zurück.V. Die Therapie der Neurose ist kaum in kurzem
abzuhandeln. Bei keiner anderen Krankheit kann
der Arzt so wunderthätig eingreifen oder so ohn-
mächtig dastehen. Man muß für den Standpunkt
der Therapie drei Aufgaben voneinander sondern:
die Behandlung der hysterischen Disposition, hyste-
rischer Ausbrüche (akuter Hysterie) und einzel-
ner hysterischer Symptome (lokaler Hysterie).
In der Behandlung der hysterischen DispositionS.
bleibt dem Arzt ein gewisser Spielraum; die Dispo-
sition ist nicht aufzuheben, aber man kann prophy-
laktisch dafür sorgen, daß körperliche UEbungen
und Gesundheitspflege nicht neben der geistigen
Ausbildung in den Hintergrund treten, von Über-
leistungen des Nerven-systems abraten, die Anämie
oder Chlorose behandeln, welche die Neigung zu
Neurosen ganz besonders zu unterstützen scheint;
endlich die Bedeutung leichter hysterischer Symptome
herabdrücken. Man muß sich als Arzt davor hüten,
durch zu deutliche Kundgebung seines Interesses
für leichte hysterische Symptome dieselben gross-
zuziehen. Ernste, wenn auch anstrengende geistige
Arbeit macht selten hysterisch, dagegen muss man
der Erziehung in den besseren Ständen der Gesell-
schaft, welche auf Verfeinerung der Empfindung
und der Empfindlichkeit hinarbeitet, aller-dings diesen
Vorwurf machen. Insofern war die Methode älterer
ärztlicher Generationen, hysterische Aeußerungen
bei jugendlichen Personen als Unart und Willens-
schwäche zu behandeln und mit Drohungen zu
strafen, keine schlechte, wenn sie auch kaum richtigen
Anschauungen entsprang. Bei Kindern läßt sich
in der Behandlung von Neurosen mehr durch auto-
ritative Abweisung leisten als durch irgend eine
andere Methode. Man wird freilich keine Erfolge
haben, wenn man diese Behandlung auf die H. Er-
wachsener und auf schwere Fälle überträgt. In der
Behandlung akuter Hysterien, bei denen die Neurose
fortwährend neue Erscheinungen pro-duziert, ist die
Aufgabe des Arztes eine schwierige; es ist leicht
möglich, Fehler zu begehen, und Erfolge sind selten.
Erste Bedingung eines erfolg-reichen Eingreifens ist
in der Regel die Entfernung aus den gewohnten
Verhältnissen und die Isolierung aus dem Kreise,
in dem der Ausbruch entstanden ist. Diese Mass-
regeln sind nicht nur an und für sich heilsam, son-
dern ermöglichen auch eine genaue ärztliche Ueber-
wachung und jene intensive Beschäftigung des
Arztes mit dem Kranken, ohne welche er niemals
einen Erfolg in der Behandlung Hysterischer auf-
weisen wird. In der Regel ist der oder die Hyste-
rische nicht der einzig nervöse Kranke im Familien-
kreise; das Erschrecken und die zärtliche Teilnahme
der Eltern oder Verwandten steigert nur die Er-
regung oder bei psychischer Verwandlung des
Kranken dessen Neigung, intensivere Symptome zu
produzieren. Ein Anfall z. B., der mehrmals hinter-
einander zu einer bestimmten Stunde gekommen
ist, wird von der Mutter regelmäßig zur selben Zeit
erwartet, sie fragt das Kind besorgt, ob es sich
schon unwohl fühle, und sichert so das Zustande-
kommen der gefürchteten Erscheinung. Nur in den
seltensten Fällen gelingt es, die Angehörigen zu be-
wegen, daß sie den hysterischen Anfällen des Kindes
mit voller Ruhe und scheinbarer Gleichgültigkeit
entgegensehen; meist muß die Familie gegen den
Aufenthalt in einer ärztlichen Anstalt vertauscht
werden, wobei die Angehörigen größeren Wider-
stand zu leisten pflegen als die Kranken selbst.
Unter dem Eindruck der veränderten Wahrnehmungen
in der Heilanstalt, der liebevollen und heiteren
Sicherheit des Arztes, dessen Überzeugung von der
Gefahrlosigkeit und raschen Heilbarkeit der Neurose
sich bald auf den Kranken überträgt, bei der Fern-
haltung aller Erregungen des Gemüts, welche zum
Ausbruche der Hysterie beitragen, und bei der Anwendung
aller kräftigenden Heilmittel (Massage, allgemeine
Elektrisation, Hydrotherapie) sieht man die
schwersten akuten Hysterien, die eine völlige physische
und moralische Zerrüttung der Kranken herbei-
geführt haben, in wenigen Monaten der Gesundheit
Platz machen. Als Behandlungsmethode der H. in Anstalten
hat sich in den letzten Jahren die sogenannteMastkur nach Weir-Mitchell (auch Playfair-
sche Kur genannt) einen hohen Ruf erworben und
zwar verdienterweise; sie beruht auf der Vereinigung
der Isolierung in absoluter Ruhe mit einer syste-
matischen Anwendung von Massage und allgemeiner
Faradisation; eine geschulte Wärterin ist hierbei so
wenig zu entbehren wie die ständige Beeinflussung
von seiten des Arztes. Als glückliche Vereinigung
des traitement moral mit einer Aufbesserung des
ganzen Ernährungszustandes, hat diese Kur für die H.
einen ungemeinen Wert; sie ist aber nicht als etwas
systematisch in sich Abgeschlossenes zu betrachten;
vielmehr bleibt die Isolierung und Beeinflussung durch
den Arzt die Hauptwirkung, und unter den Hilfs-
wirkungen sind neben Massage und Elektrizität auch
die anderen therapeutischen Methoden nicht zu ver-
nachlässigen. Man thut am besten, nach einer
4-8 wochenlangen Bettruhe, Hydrotherapie und
Gymnastik anzuwenden und zu ausgiebiger Be-
wegung anzuleiten. Bei anderen Neurosen, z. B.
Neurasthenie, ist der Erfolg der Kur ein weit un-
sichererer, er beruht bloss auf dem Wert der Ueber-
ernährung, soweit diese bei einem neurasthenischen
Verdauungstrakt gelingt, und der Ruhe; bei H. ist
der Erfolg häufig ein zauberhafter und bleibender.Die Behandlung einzelner hysterischer Symptome
bietet keine Aussicht auf Erfolg, solange eine akute
H. besteht; die weggeschafften Symptome rezidivieren
oder werden durch neue ersetzt; Arzt und Kranke
ermüden endlich. Dagegen liegt es anders, wenn
die hysterischen Symptome Reste einer abgelaufenen
akuten H. darstellen oder in einer chronischen H.
auf besondere Veranlassung hin als Lokalisationen der
Neurose auftreten. Zunächst ist hier von interner Me-
dikation abzuraten und vor narkotischen Mitteln zu
warnen. Die Darreichung narkotischer Mittel in
einer akuten Hysterie ist weiter nichts als ein schwerer
Kunstfehler. Bei lokaler und restierender H. wird
man interne Medikamente nicht immer umgehen
können; deren Wirkung ist aber unverläßlich, er-
folgt das eine Mal mit zauberhafter Promptheit,
das andere Mal überhaupt nicht und scheint nur
von der Autosuggestion des Kranken, oder von
seinem Glauben an die Wirkung abzuhängen. Man
hat sonst die Wahl, ob man eine direkte oder in-
direkte Behandlung des hysterischen Leidens ein-
schlagen will. Letztere besteht darin, das lokale
Leiden zu vernachlässigen und eine heilsame All-
gemeinbeeinflussung des Nervensystems anzustreben,
wobei man sich des Aufenthaltes in freier Luft, der
Hydrotherapie, der Elektrizität (am besten der Fran-
klinisation), der Verbesserung des Blutes durch Arsen-
und Eisenmedikation bedient. Bei der indirekten
Behandlung hat man noch die Beseitigung der Reiz-
quelle zu berücksichtigen, falls eine solche phy-
sischer Natur existiert. So z. B. können hysterische
Magenkrämpfe einen leichten Magenkatarrh zur
Grundlage haben, eine gerötete Stelle im Kehlkopf,
eine Schwellung der Nasenmuscheln kann eine un-
aufhörliche Tussis hysterica erzeugen. Ob Ver-
änderungen an den Genitalien wirklich so häufig
die Reizquelle für hysterische Symptome abgeben,
ist wirklich zweifelhaft. Die betreffenden Fälle
müßten mit größerer Kritik geprüft werden. Die
direkte Behandlung besteht in der Wegschaffung
der psychischen Reizquelle für die hysterischen Sym-
ptome und ist verständlich, wenn man die Ursachen
der Hysterie im unbewußten Vorstellungsleben sucht. Sie
besteht darin, dem Kranken in der Hypnose eine
Suggestion einzugeben, in welcher die Behebung
des betreffenden Leidens enthalten ist. So heilt
man z. B. eine Tussis nervosa hysterica, wenn man
dem hypnotisierten Kranken auf den Kehlkopf drückt
und ihm versichert, daß nun der Hustenreiz be-S.
hoben ist; eine hysterische Lähmung des Armes,
indem man ihn in der Hypnose zwingt, Stück für Stück
des gelähmten Gliedes zu bewegen. Noch wirksamer
ist es, wenn man nach einer Methode, welche Josef
Breuer in Wien zuerst geübt hat, den Kranken in
der Hypnose auf die psychische Vorgeschichte des
Leidens zurückführt, ihn zum Bekennen nötigt, bei
welchem psychischen Anlaß die entsprechende Stö-
rung entstanden ist. Diese Methode der Behand-
lung ist jung, liefert aber Heilerfolge, die sonst nicht
zu erreichen sind. Sie ist die der H. adäquateste,
weil sie genau den Mechanismus des Entstehens und
Vergehens solcher hysterischer Störungen nachahmt.
Viele hysterische Symptome, die jeder Behandlung
widerstanden haben, schwinden nämlich spontan
unter dem Einfluss eines genügenden psychischen
Motivs, z. B. eine Lähmung der rechten Hand, wenn
der Kranke in einem Streit den Impuls fühlt, seinem
Gegner eine Ohrfeige zu geben, oder einer mora-
lischen Erregung, eines Schrecks, einer Erwartung
z. B. in einem Wallfahrtsort, oder endlich bei einer
Umwälzung der Erregungen im Nervensystem nach
einem krampfhaften Anfall. Die direkte psychis-
che Behandlung hysterischer Symptome wird der-
einst die bestgeachtete sein, wenn das Verständnis
der Suggestion in ärztlichen Kreisen tiefer einge-
drungen ist (Bernheim – Nancy). – Es läßt sich
derzeit nicht mit Bestimmtheit entscheiden, inwieweit
der psychische Einfluss bei gewissen anderen schein-
bar physischen Einwirkungen ins Spiel kommt. So
lassen sich z. B. Kontrakturen heilen, wenn es ge-
lingt, dieselben durch einen Magneten zum Trans-
fert zu bringen. Bei wiederholtem Transfert schwächt
sich die Kontraktur ab und schwindet endlich.VI. Resümé: Zusammenfassend kann man sagen,
die H. ist eine Anomalie des Nervensystems, welche
auf einer andersartigen Austeilung der Erregungen,
wahrscheinlich mit Bildung eines Reizüberschusses
im Seelenorgan beruht. Ihre Symptomatologie zeigt,
dass dieser Reizüberschuß durch bewusste und un-
bewusste Vorstellungen verteilt wird. Alles was die
Verteilung der Erregungen im Nervensystem ändert,
kann hysterische Störungen heilen; solche Einwir-
kungen sind teils physischer, teils direkt psychi-
scher Natur.
Villaret1888Handwoerterbuch
886
–892