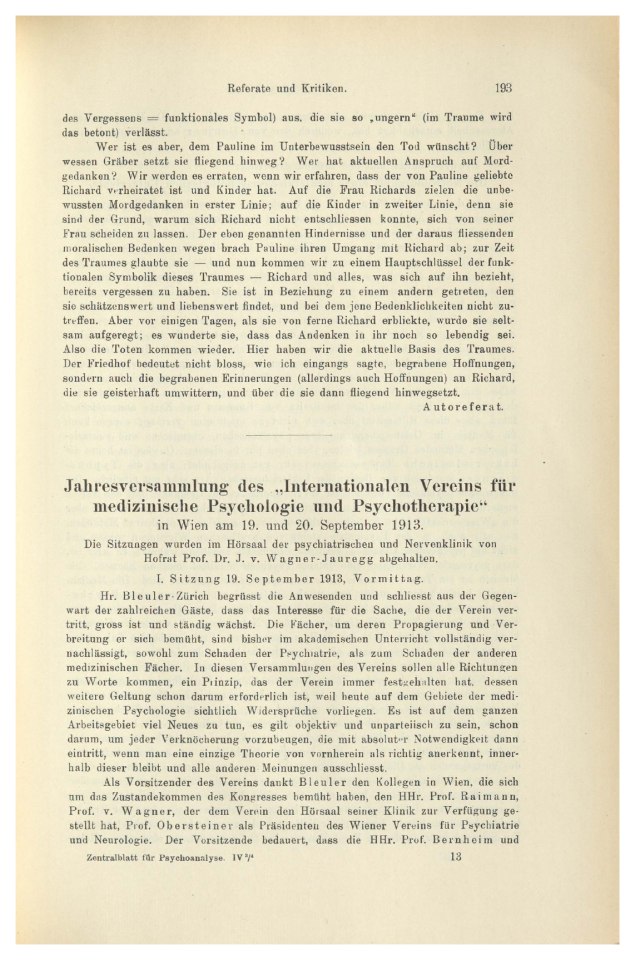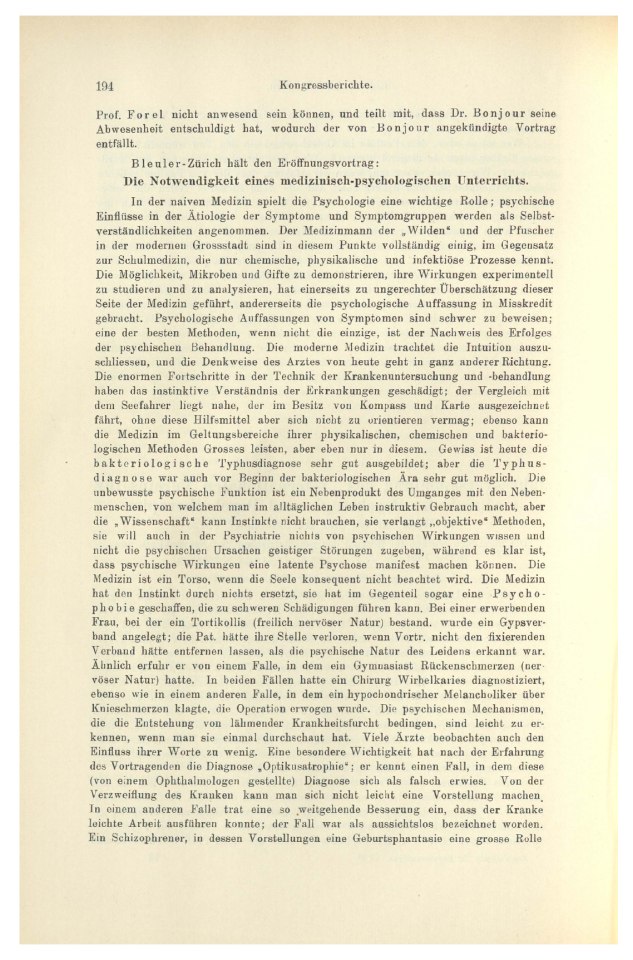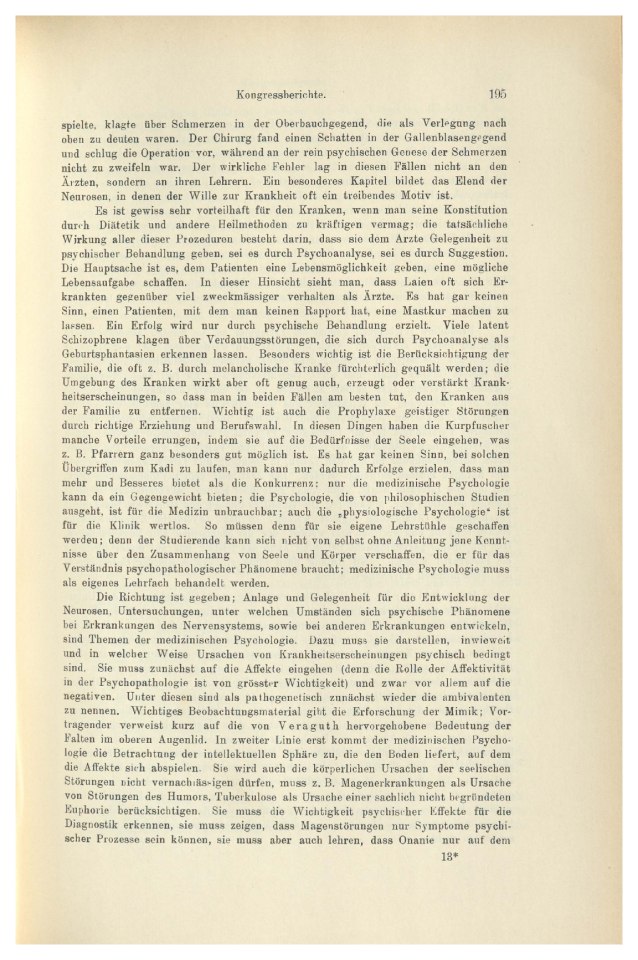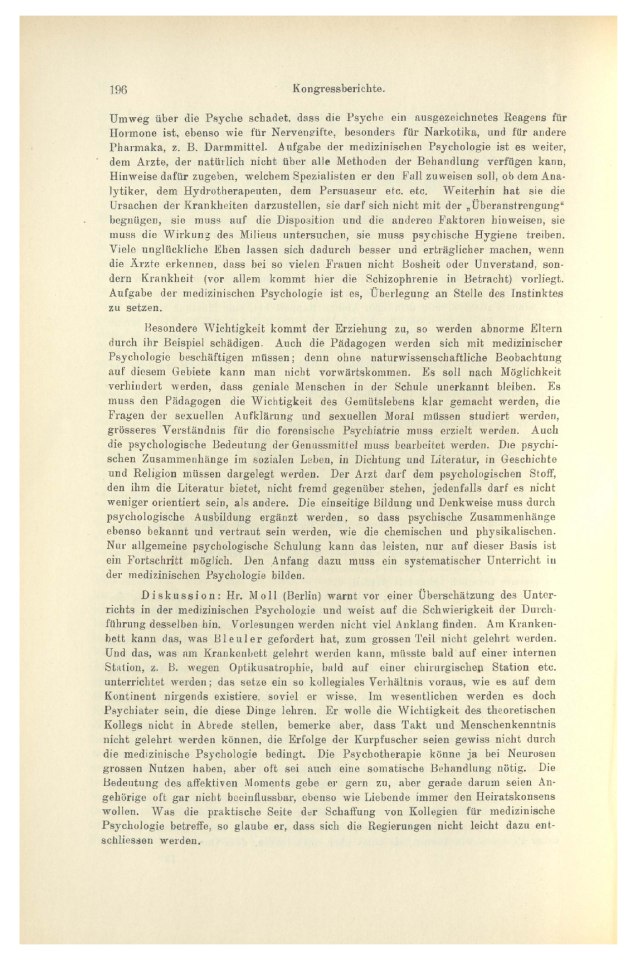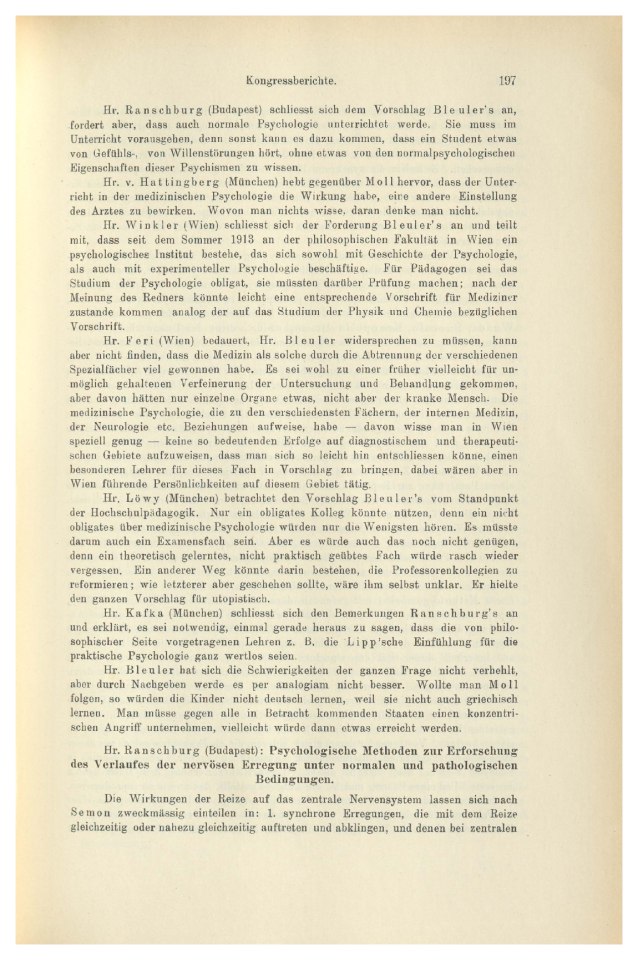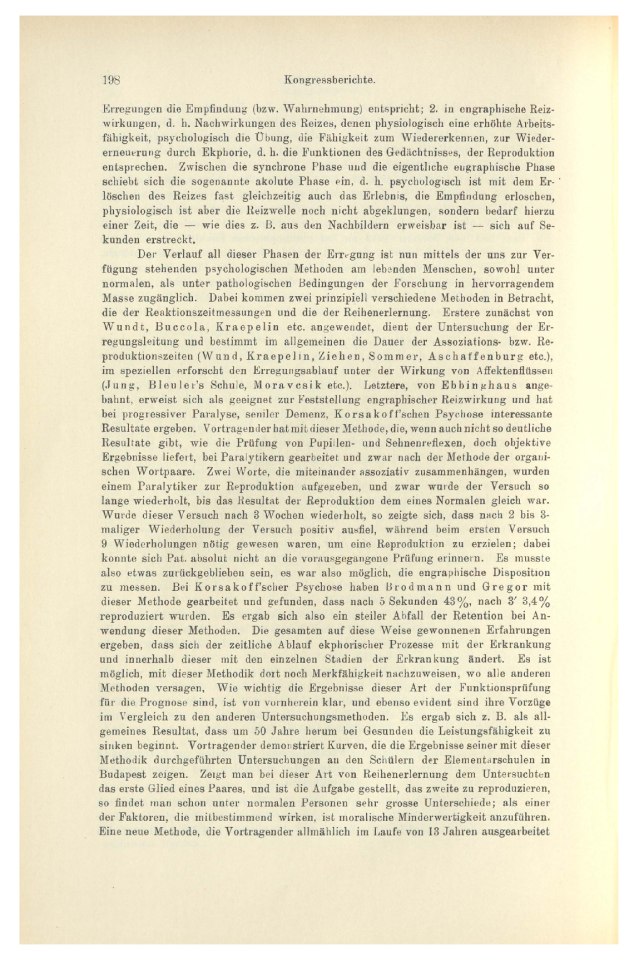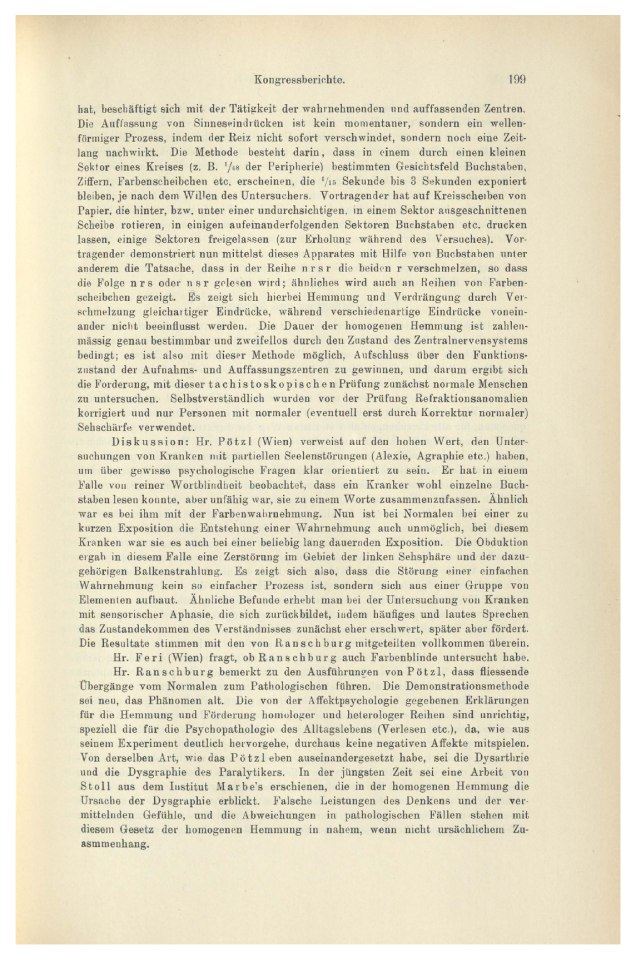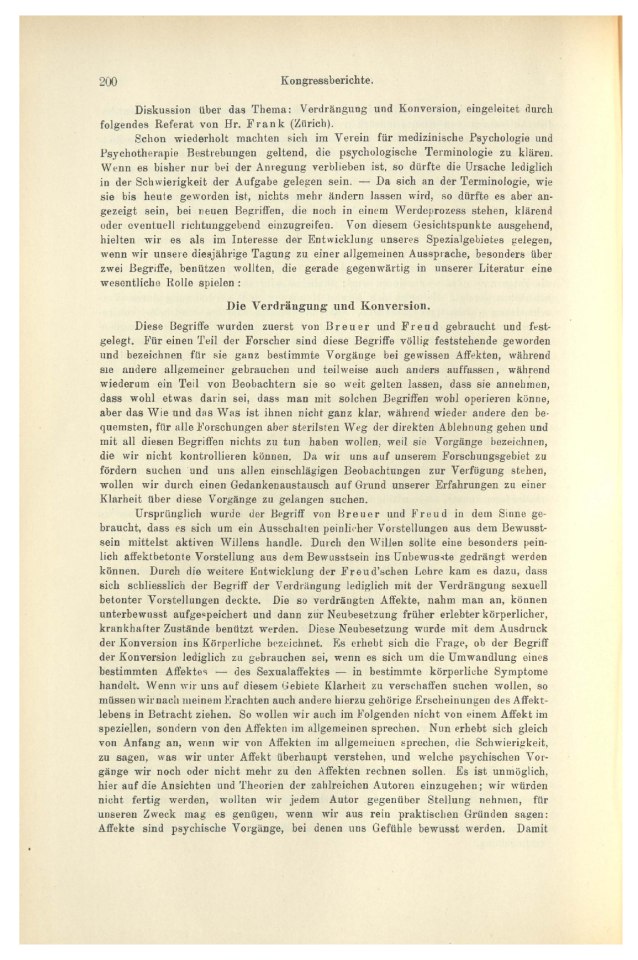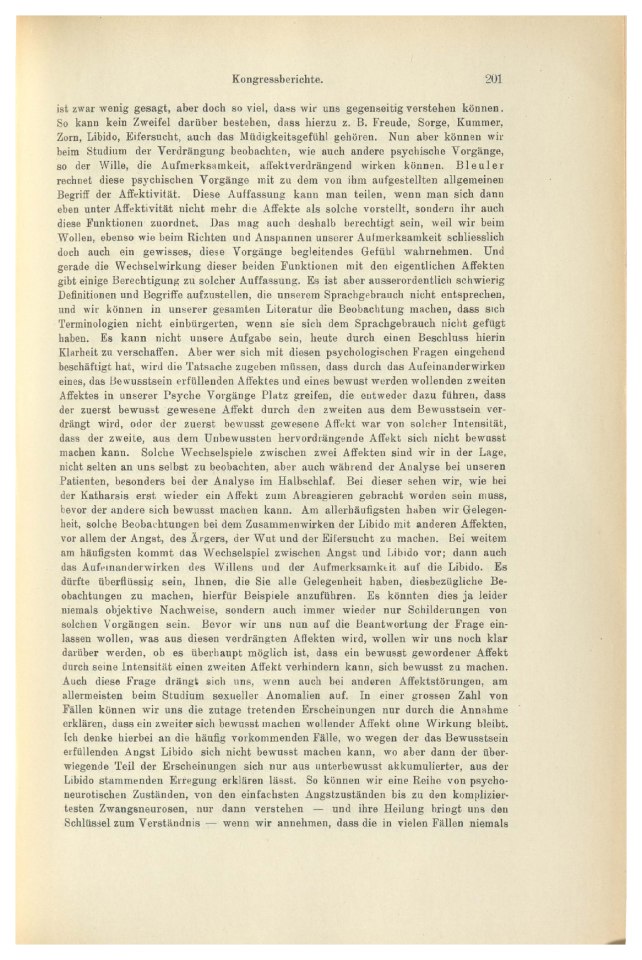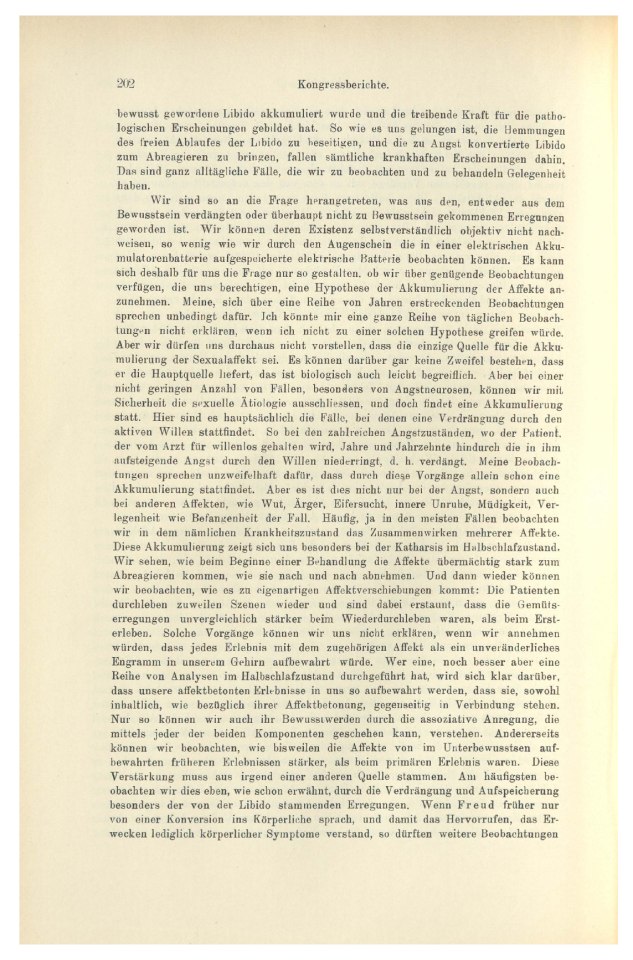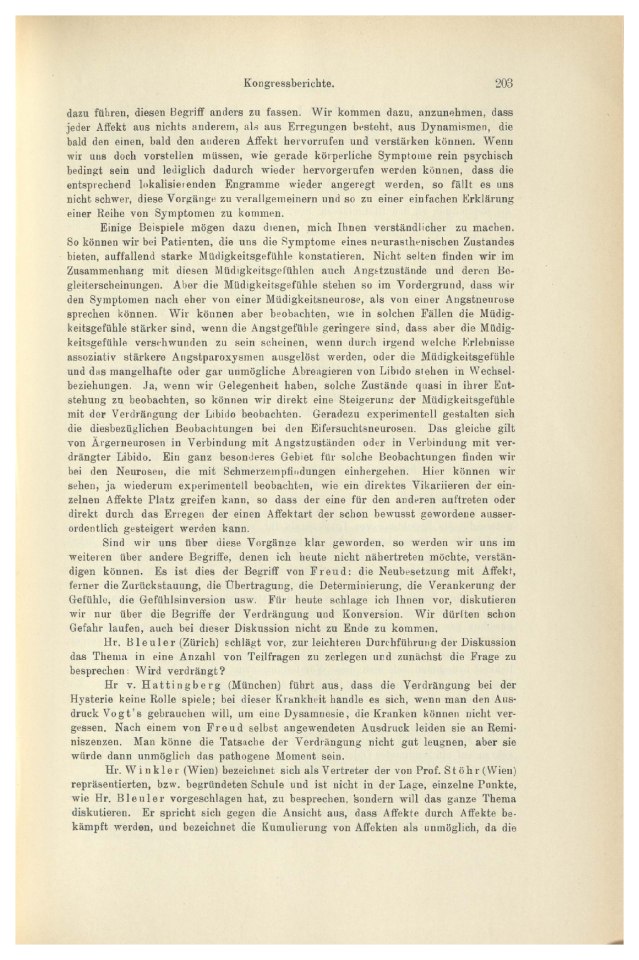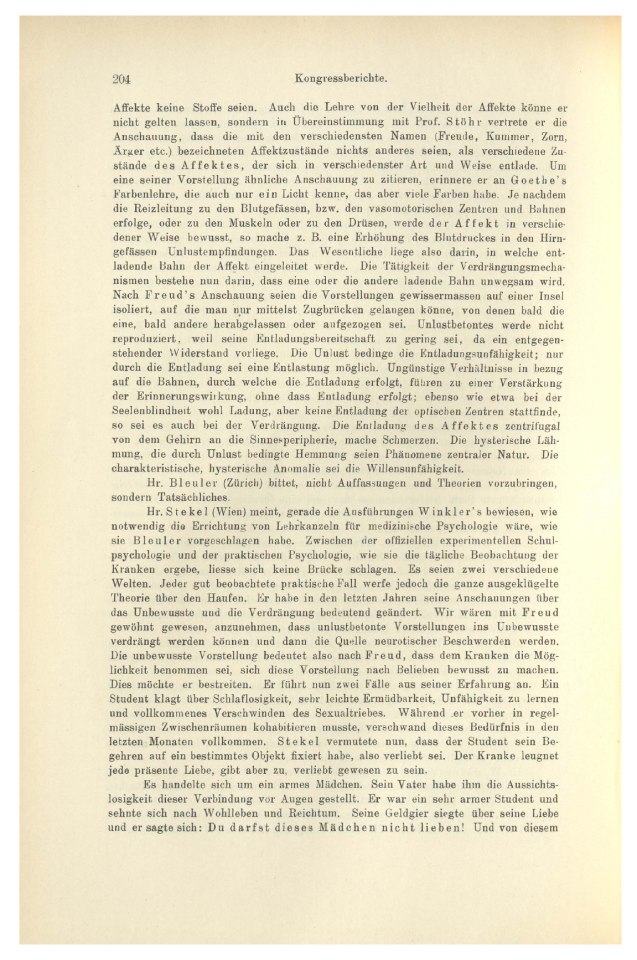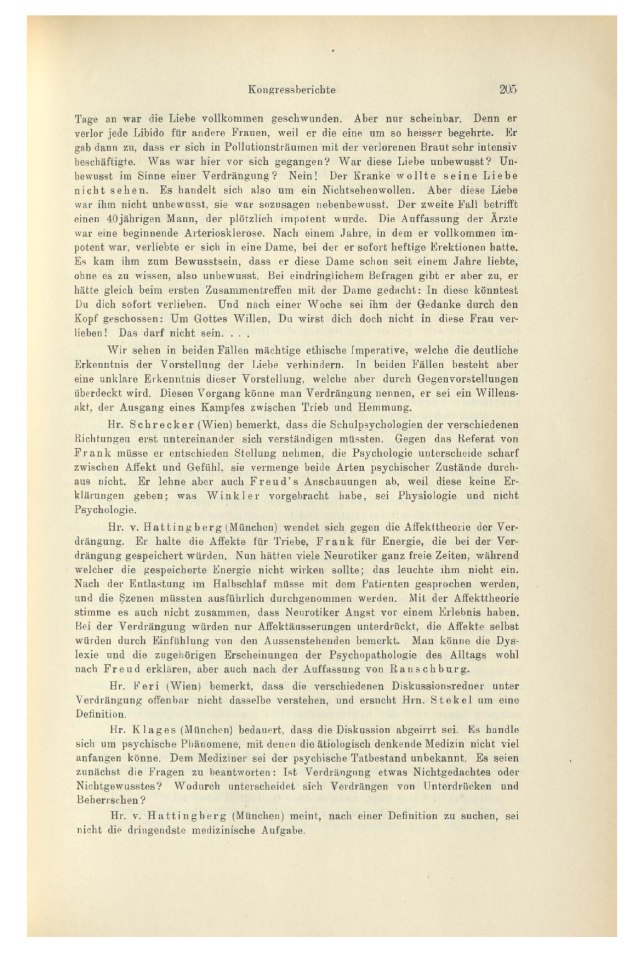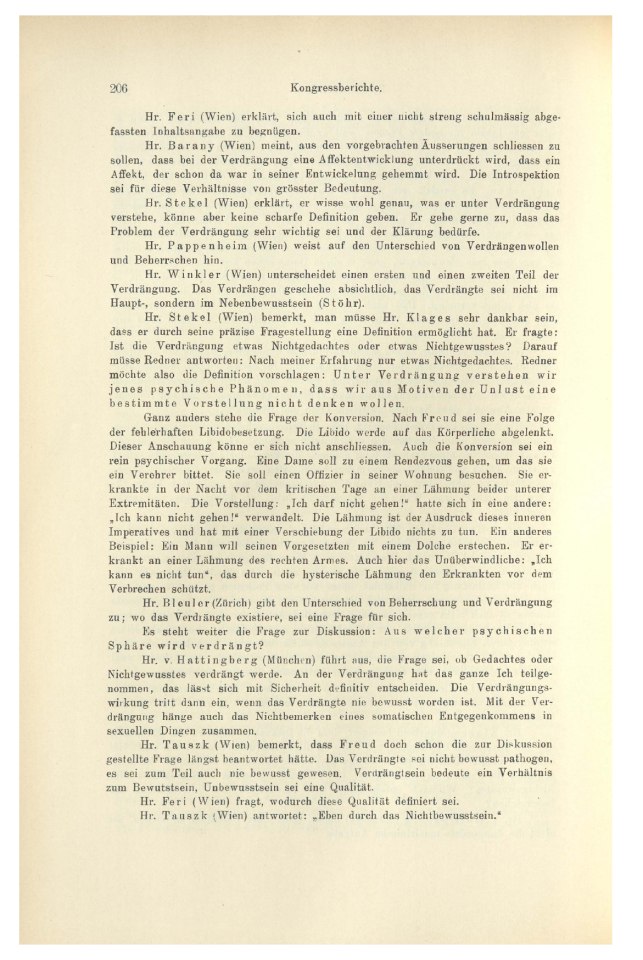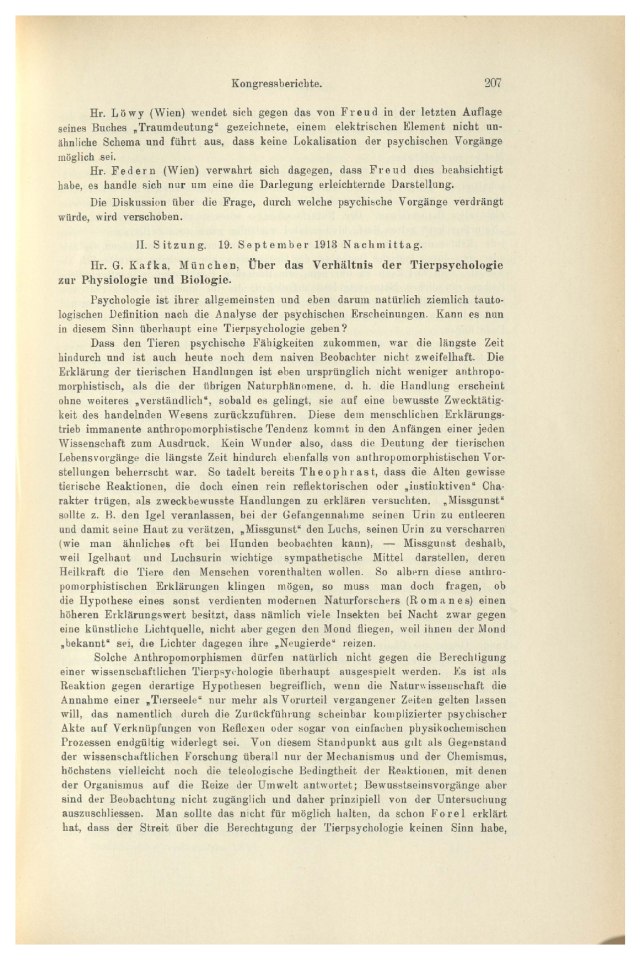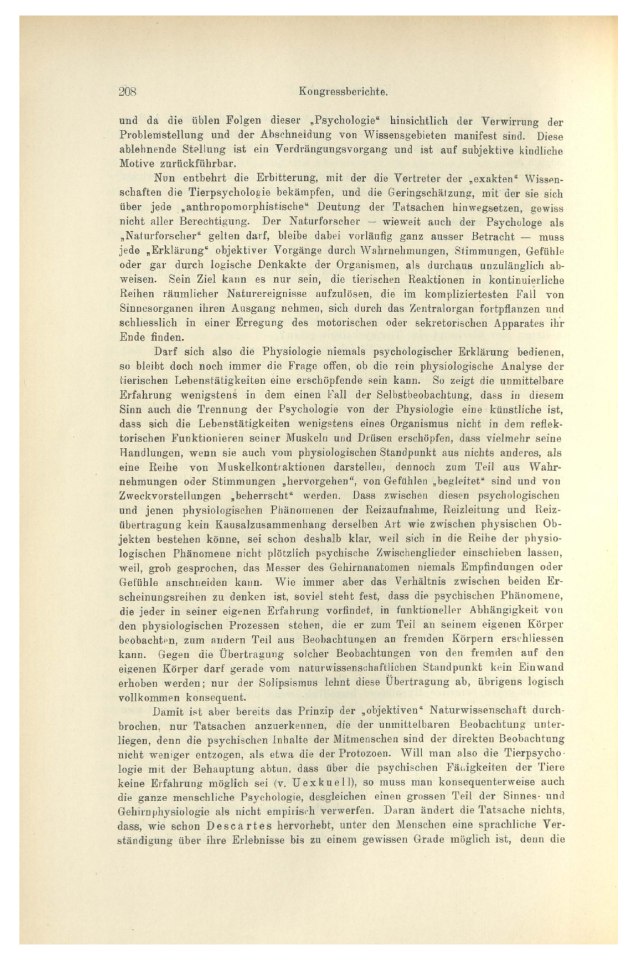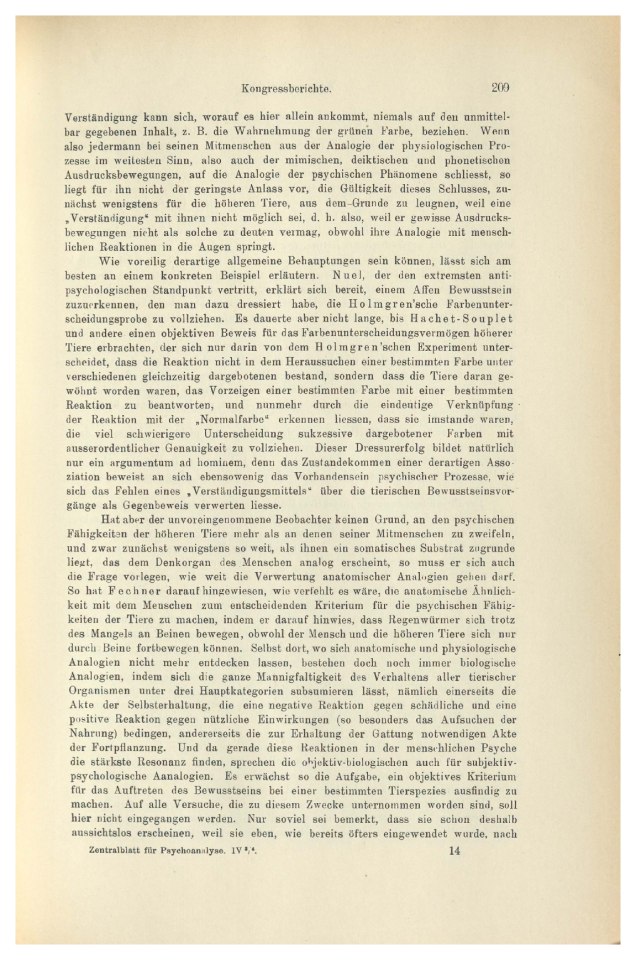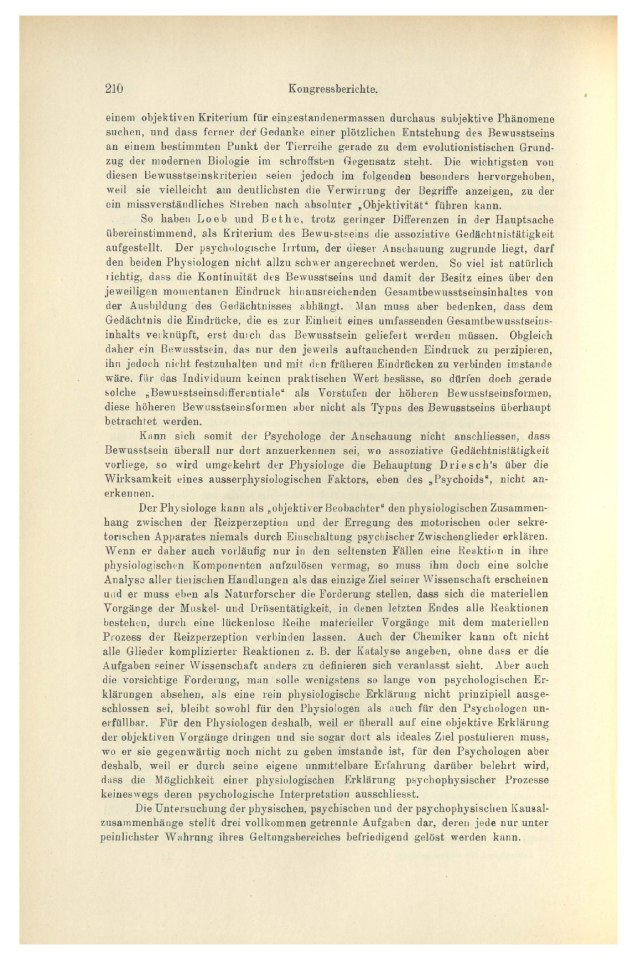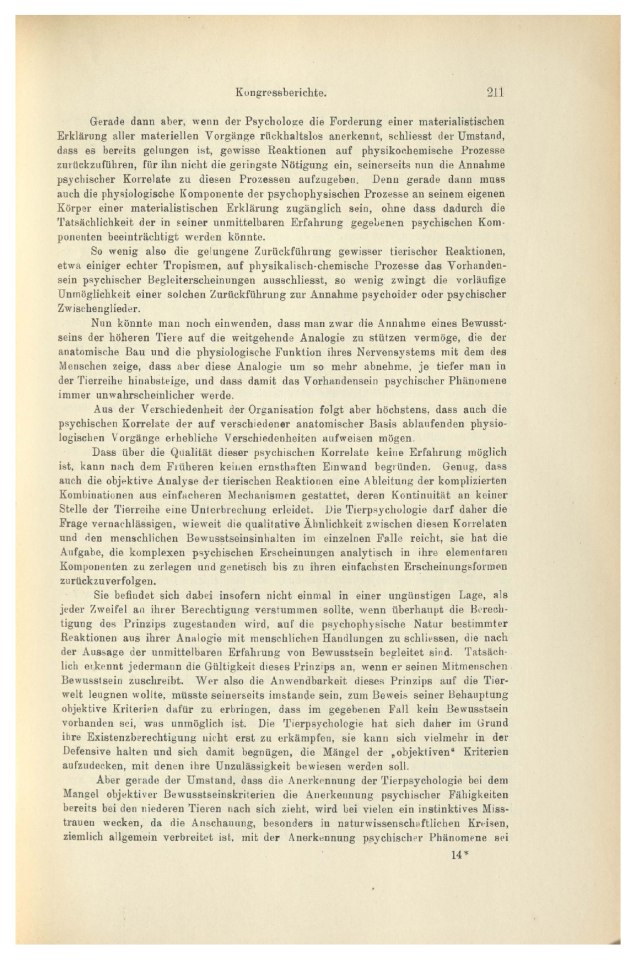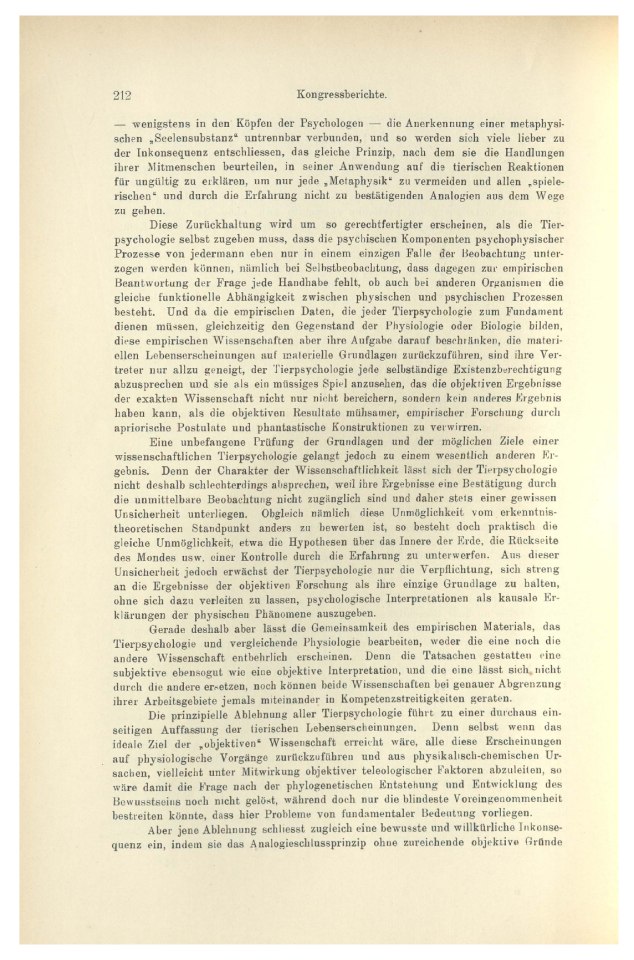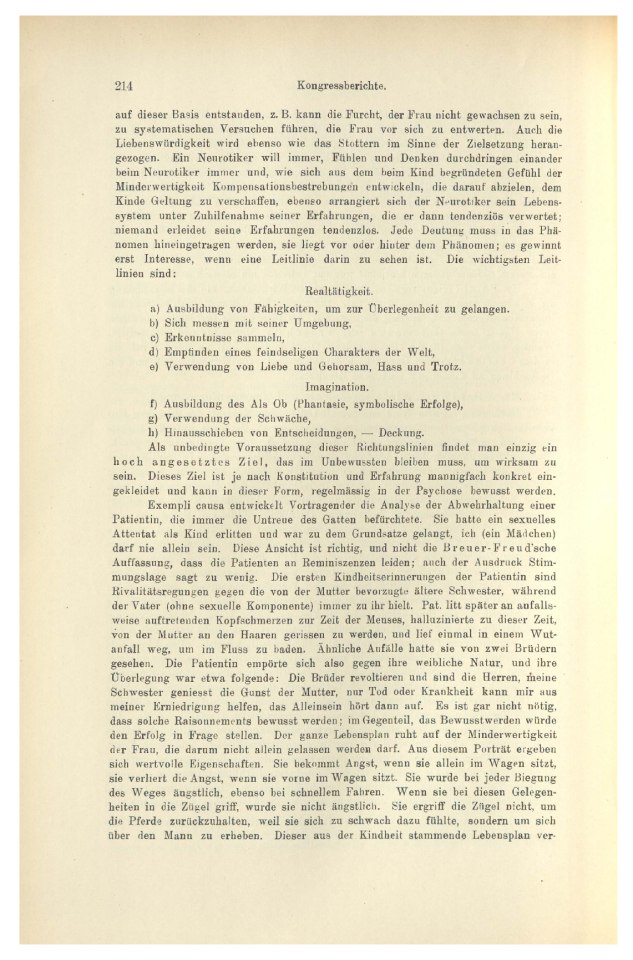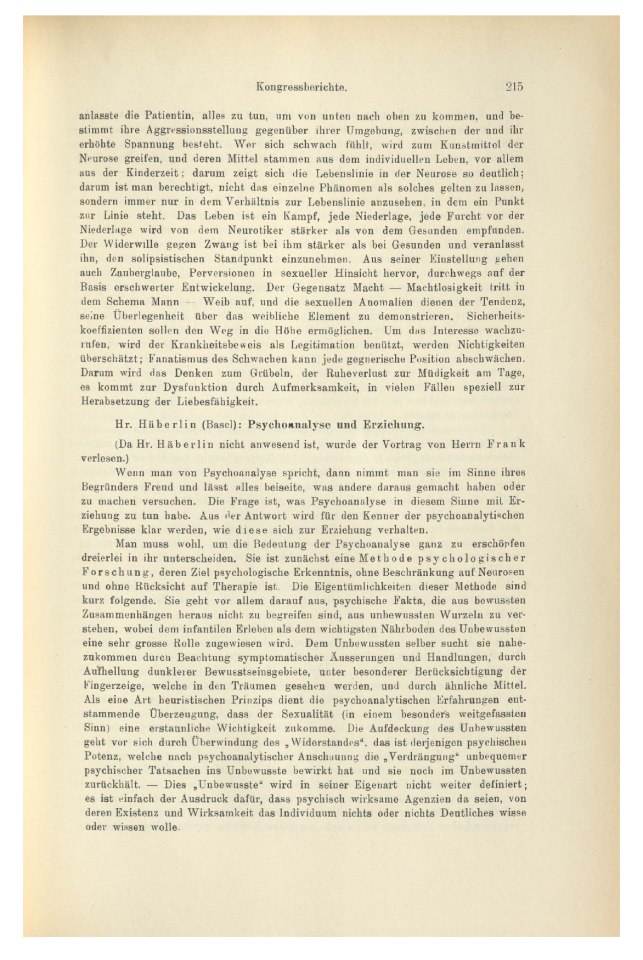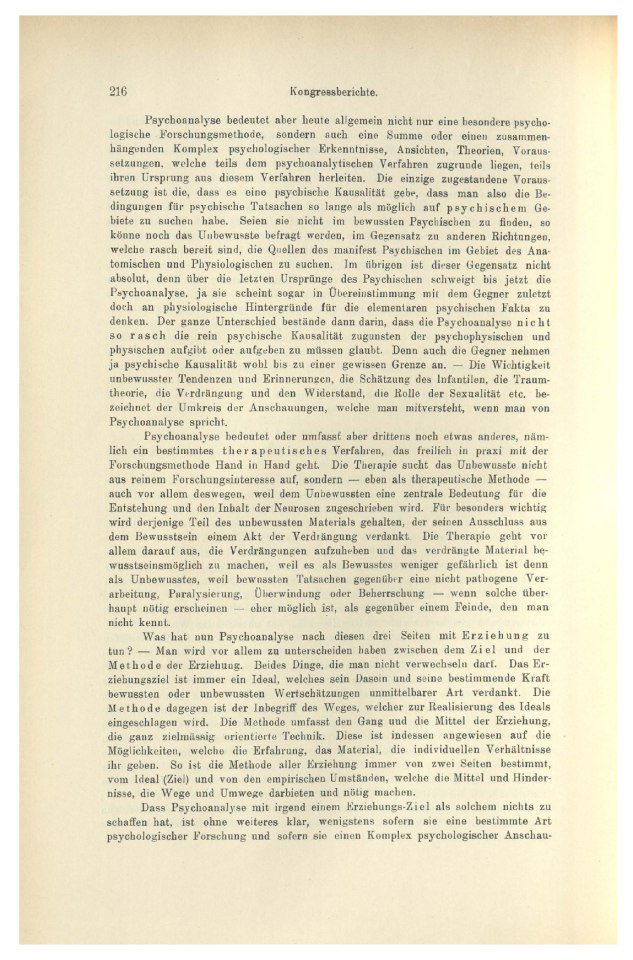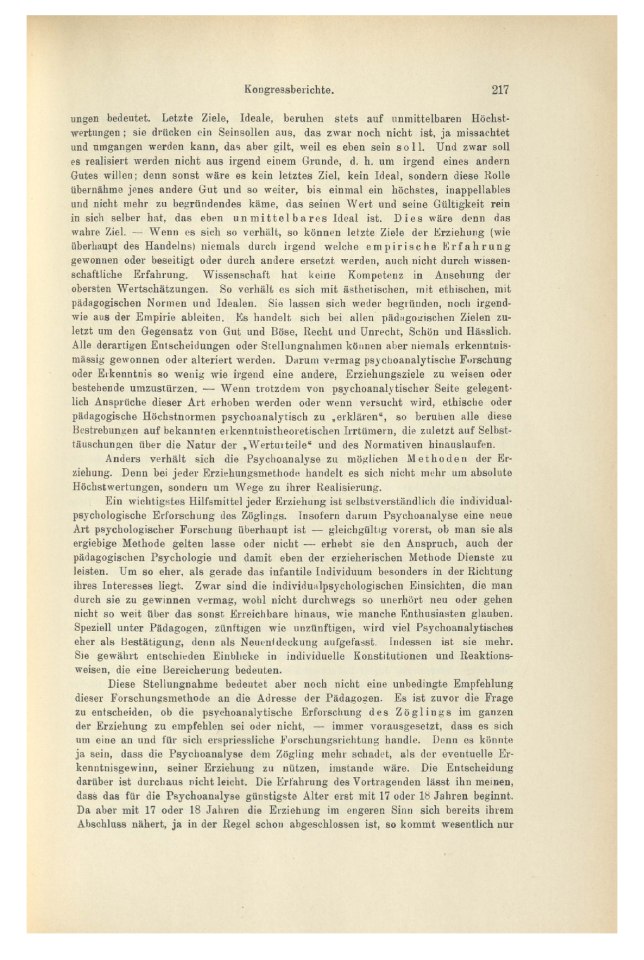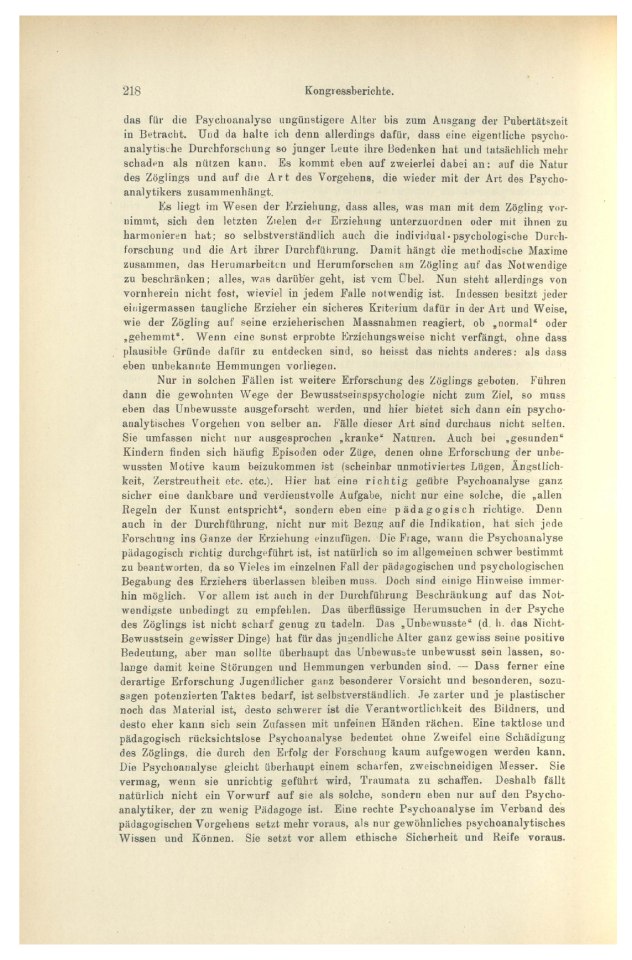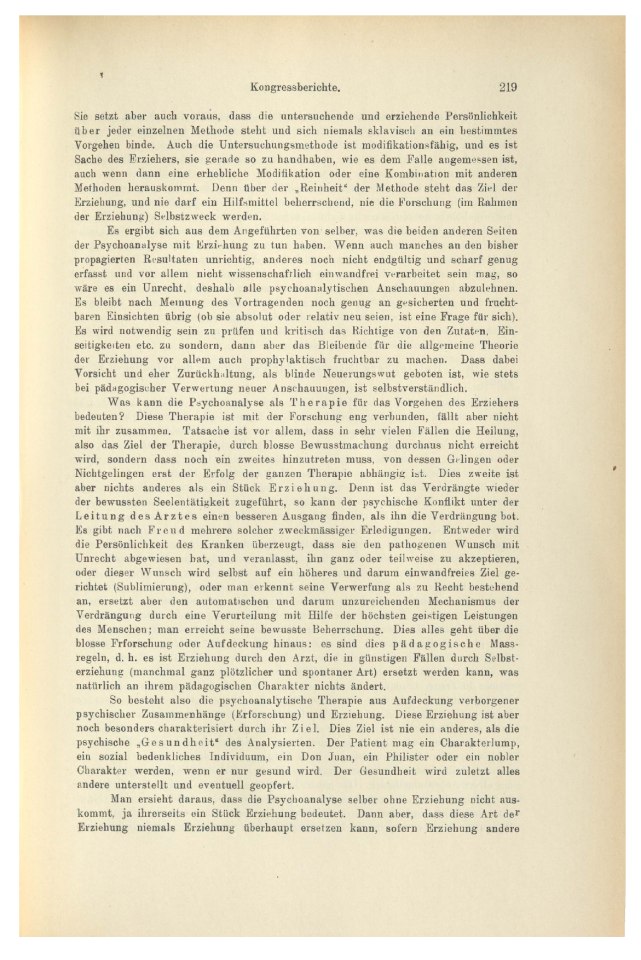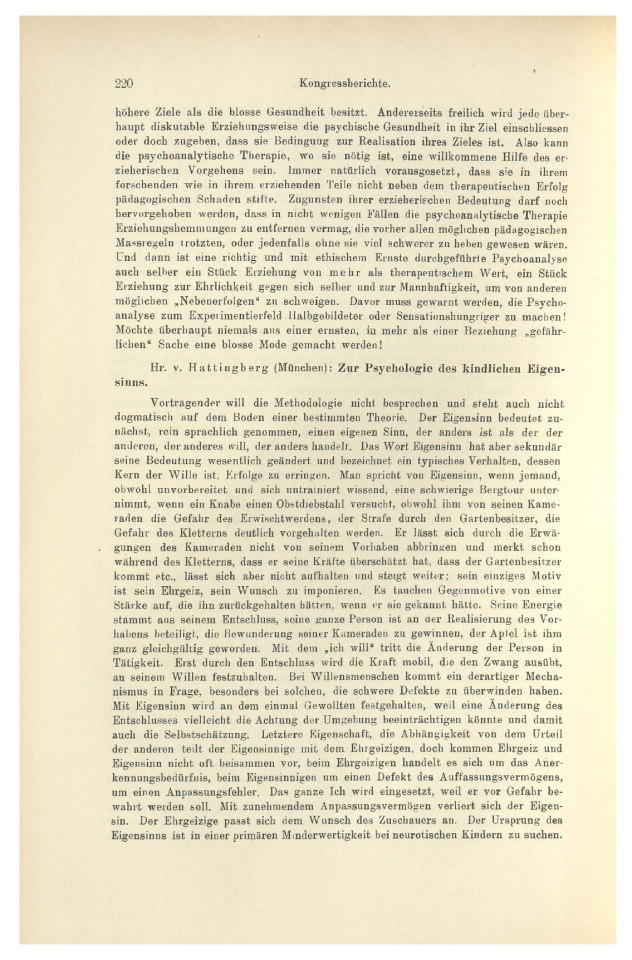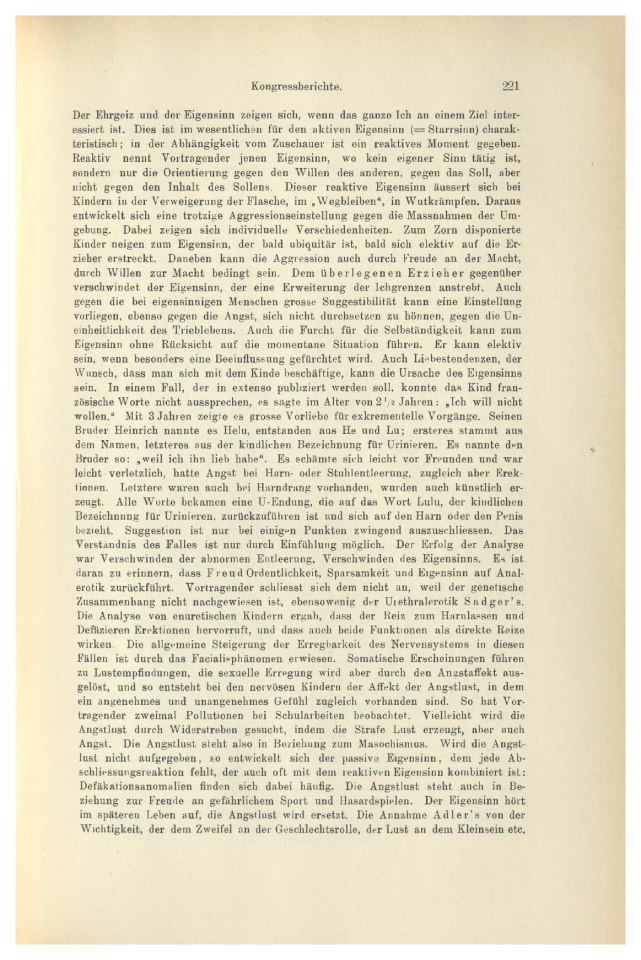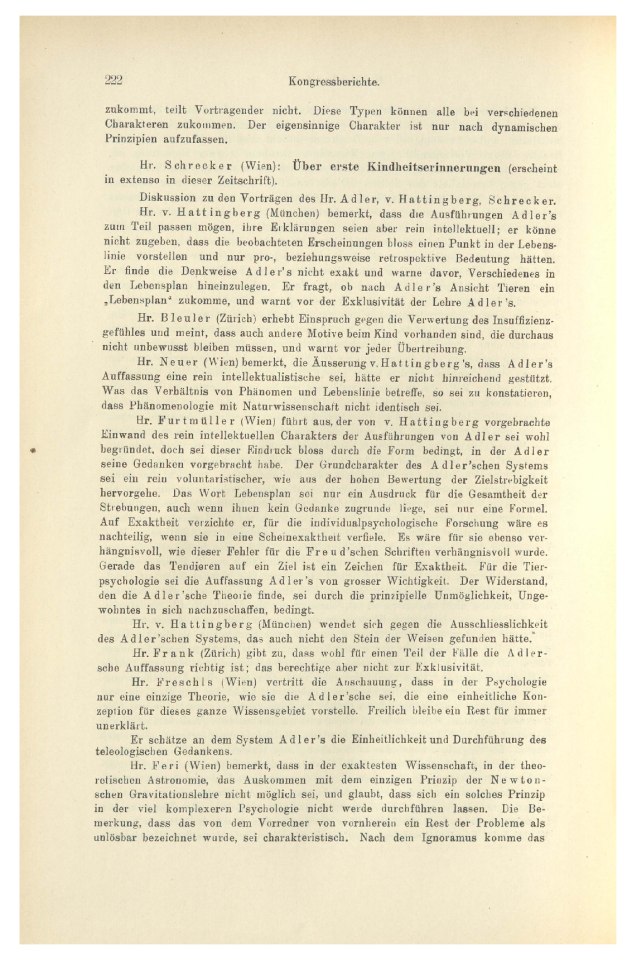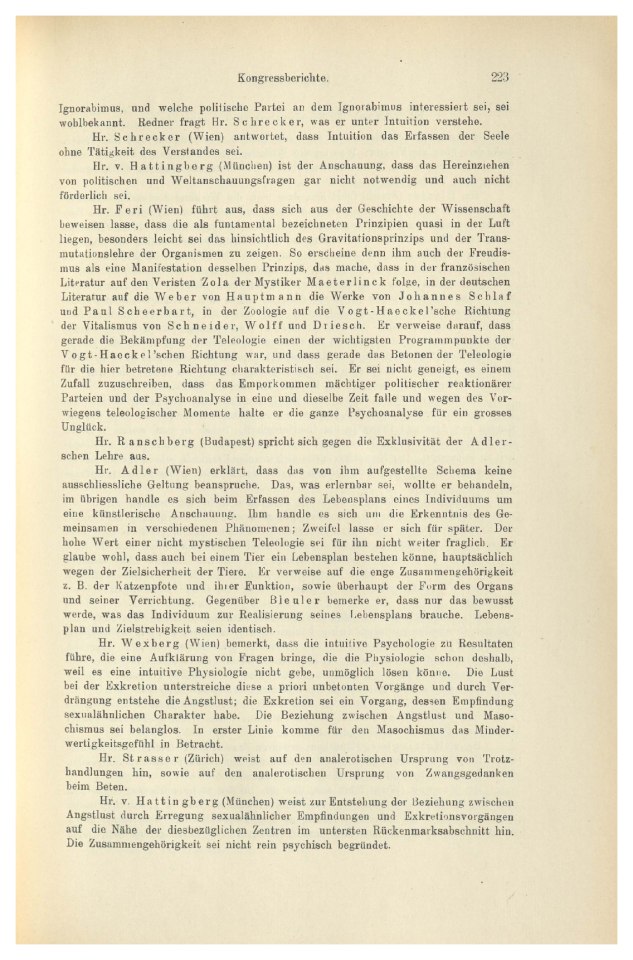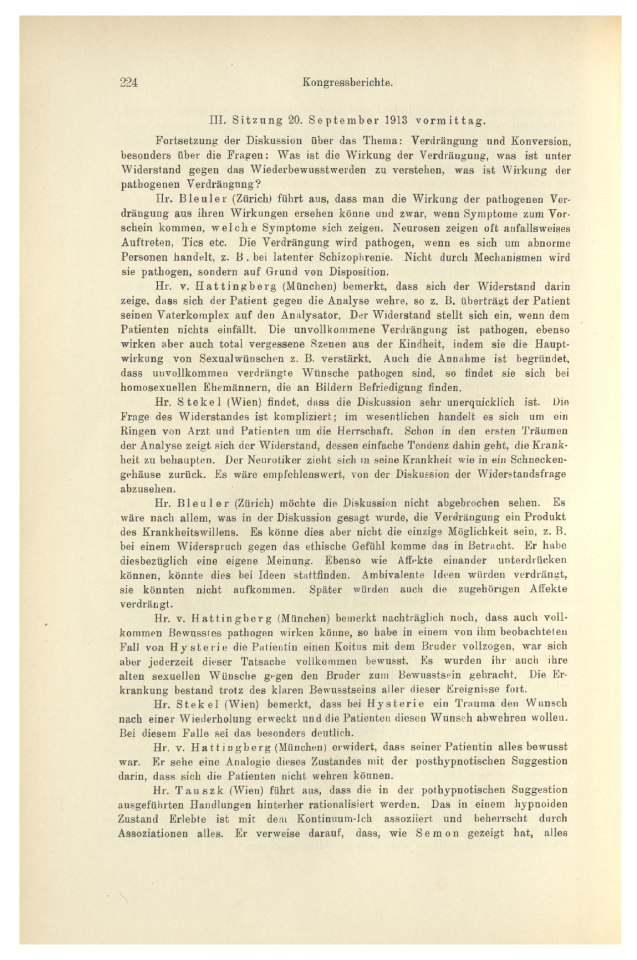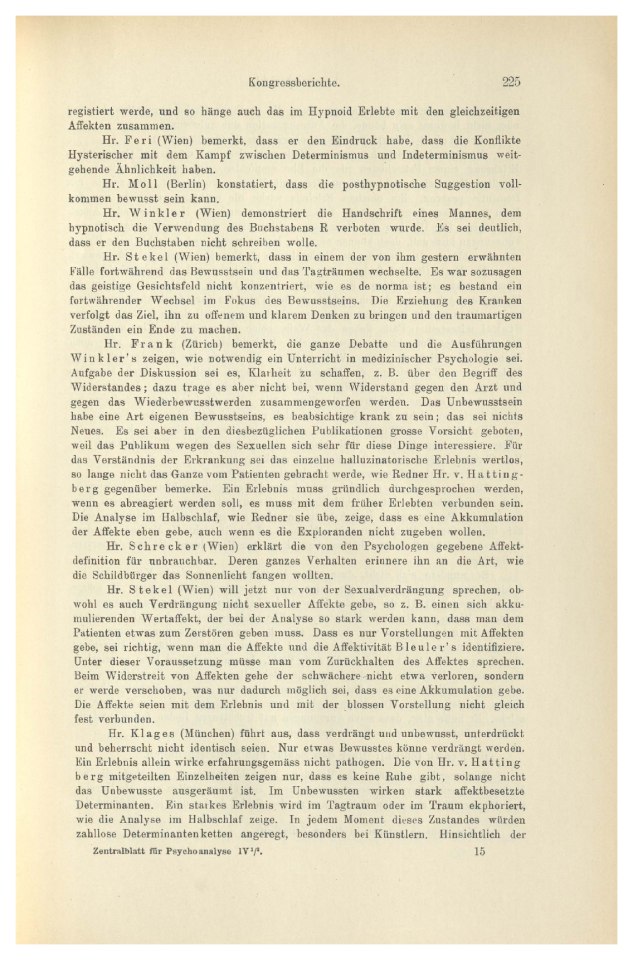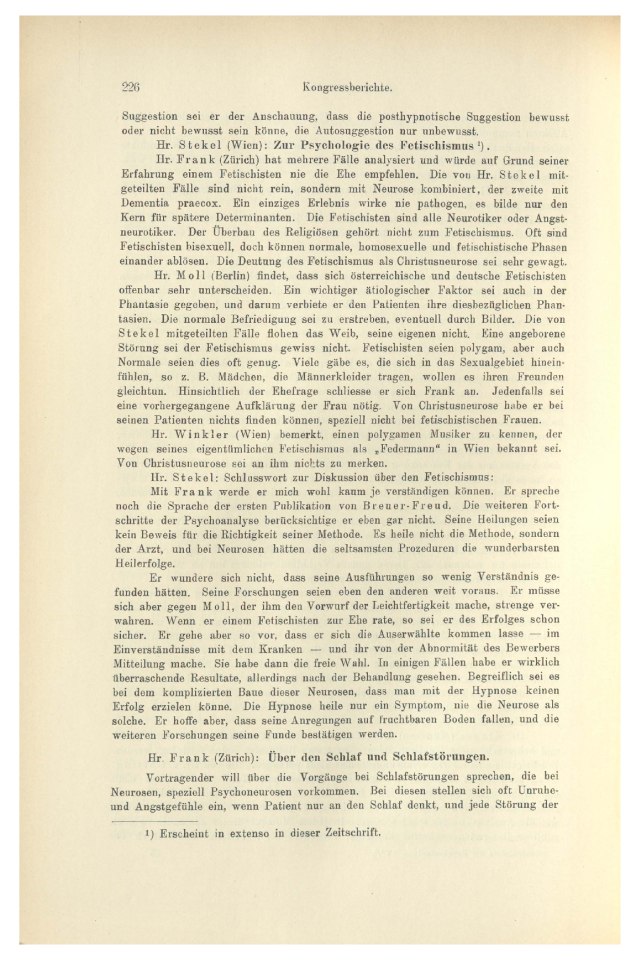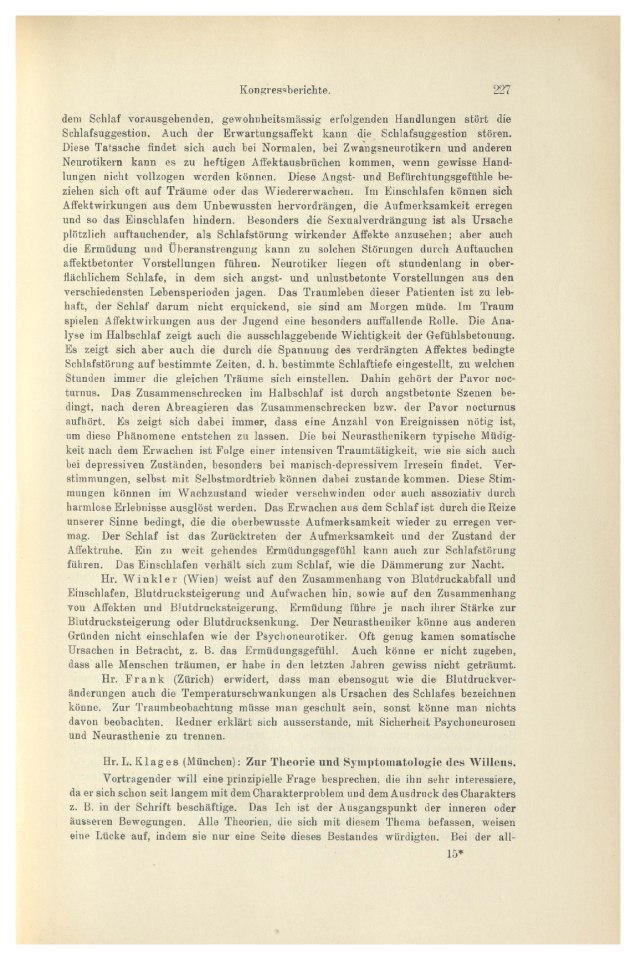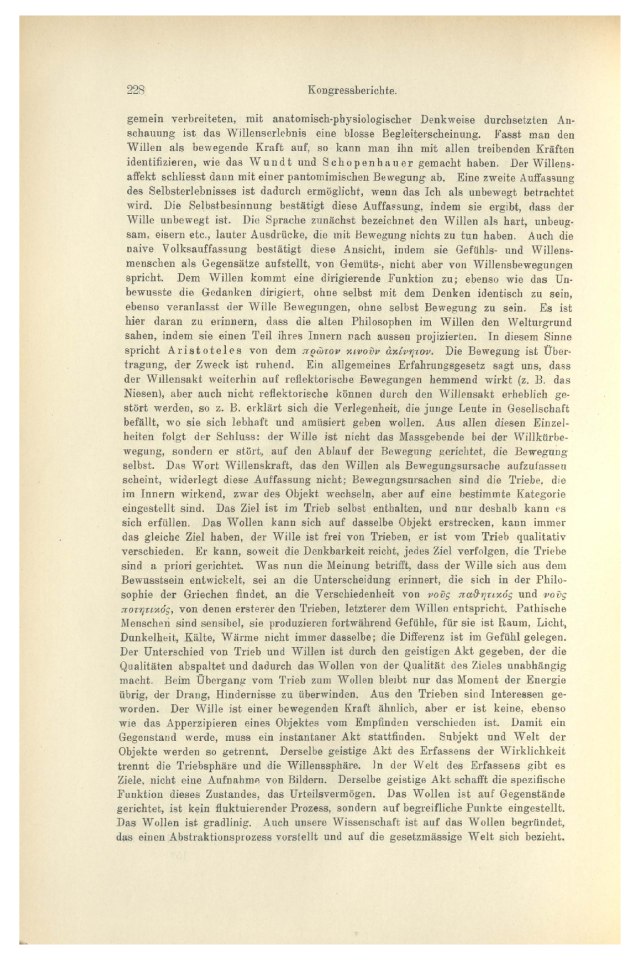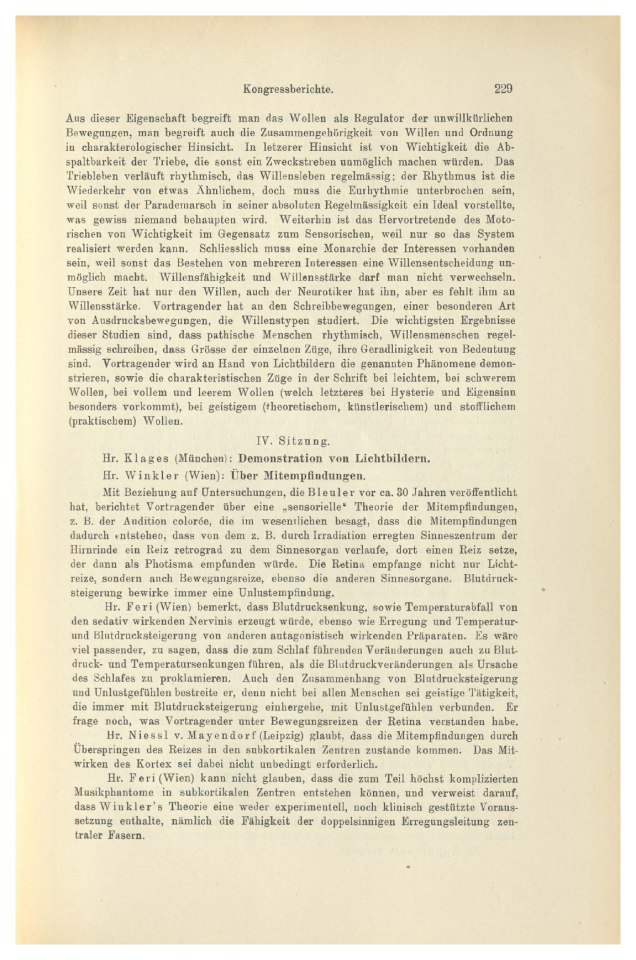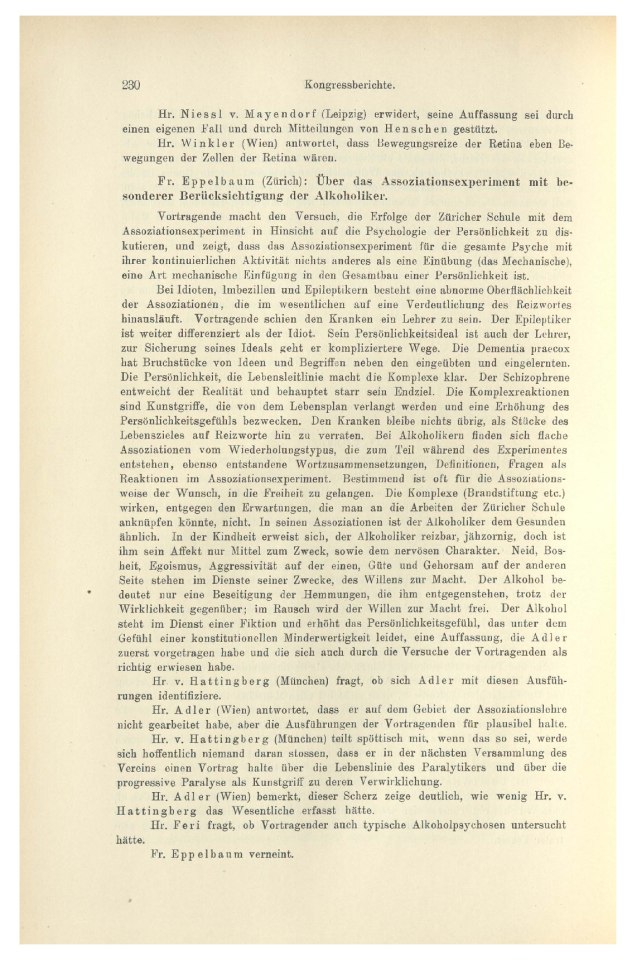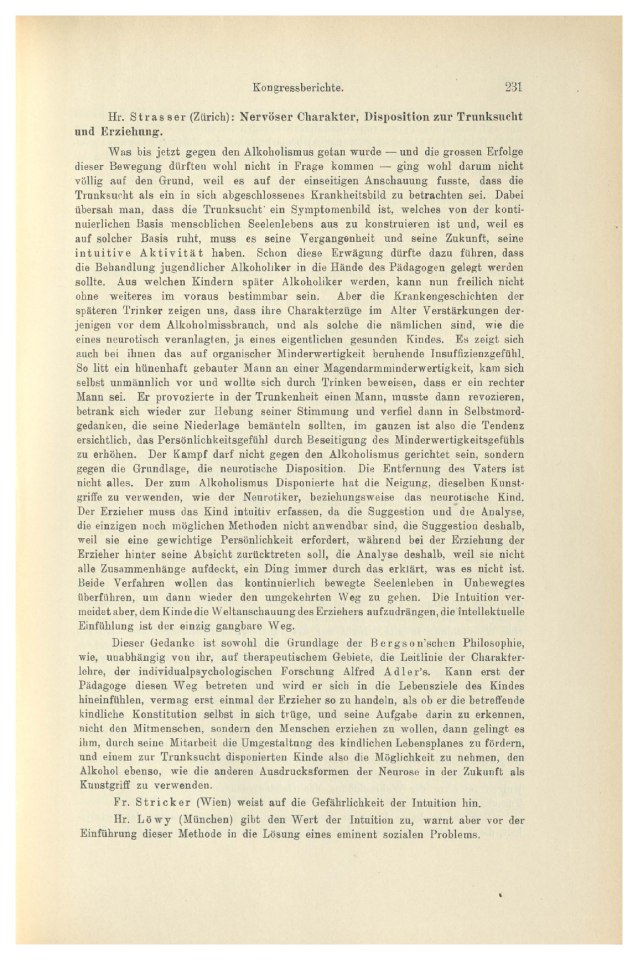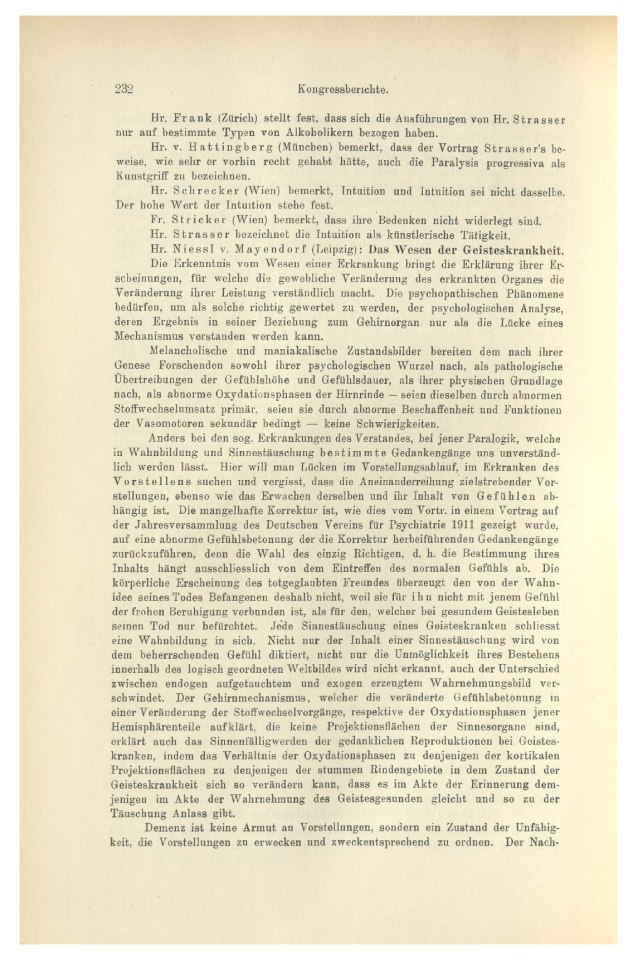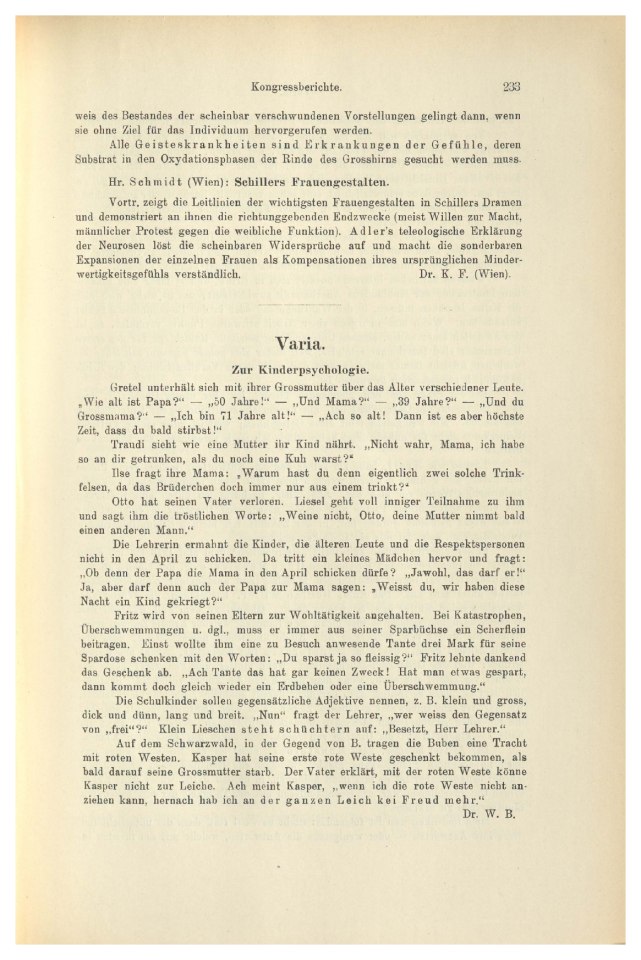S.
Referate und Kritiken. 193
des Vergessens = funktionales Symbol) aus, die sie so „ungern“ (im Traume wird
das betont) verlässt.Wer ist es aber, dem Pauline im Unterbewusstsein den Tod wünscht? Über
wessen Gräber setzt sie fliegend hinweg? Wer hat aktuellen Anspruch auf Mord-
gedanken? Wir werden es erraten, wenn wir erfahren, dass der von Pauline geliebte
Richard verheiratet ist und Kinder hat. Auf die Frau Richards zielen die unbe-
wussten Mordgedanken in erster Linie; auf die Kinder in zweiter Linie, denn sie
sind der Grund, warum sich Richard nicht entschliessen konnte, sich von seiner
Frau scheiden zu lassen. Der eben genannten Hindernisse und der daraus fliessenden
moralischen Bedenken wegen brach Pauline ihren Umgang mit Richard ab; zur Zeit
des Traumes glaubte sie — und nun kommen wir zu einem Hauptschlüssel der funk-
tionalen Symbolik dieses Traumes — Richard und alles, was sich auf ihn bezieht,
bereits vergessen zu haben. Sie ist in Beziehung zu einem andern getreten, den
sie schützenswert und liebenswert findet, und bei dem jene Bedenklichkeiten nicht zu-
treffen. Aber vor einigen Tagen, als sie von ferne Richard erblickte, wurde sie selt-
sam aufgeregt; es wunderte sie, dass das Andenken in ihr noch so lebendig sei.
Also die Toten kommen wieder. Hier haben wir die aktuelle Basis des Traumes.
Der Friedhof bedeutet nicht bloss, wie ich eingangs sagte, begrabene Hoffnungen,
sondern auch die begrabenen Erinnerungen (allerdings auch Hoffnungen) an Richard,
die sie geisterhaft umwittern, und über die sie dann fliegend hinwegsetzt.Autoreferat.
Jahresversammlung des „Internationalen Vereins fiir
medizinische Psychologie und Psychotherapie
in Wien am 19. und 20. September 1913.Die Sitzungen wurden im Hörsaal der psychiatrischen und Nervenklinik von
Hofrat Prof. Dr. J. v. Wagner-Jauregg abgehalten,I. Sitzung 19. September 1913, Vormittag.
Hr. Bleuler-Ziirich begrüsst die Anwesenden und schliesst aus der Gegen-
wart der zahlreichen Giste, dass das Interesse fiir die Sache, die der Verein ver-
tritt, gross ist und ständig wächst. Die Fächer, um deren Propagierung und Ver-
breitung er sich bemüht, sind bisher im akademischen Unterricht vollständig ver-
nachlissigt, sowohl zum Schaden der Psychiatrie, als zum Schaden der anderen
medizinischen Fächer. In diesen Versammlungen des Vereins sollen alle Richtungen
zu Worte kommen, ein Prinzip, das der Verein immer festzehalten hat, dessen
weitere Geltung schon darum erforderlich ist, weil heute auf dem Gebiete der medi-
zinischen Psychologie sichtlich Widersprüche vorliegen. Es ist auf dem ganzen
Arbeitsgebiet viel Neues zu tun, es gilt objektiv und unparteiisch zu sein, schon
darum, um jeder Verknöcherung vorzubeugen, die mit absoluter Notwendigkeit dann
eintritt, wenn man eine einzige Theorie von vornherein als richtig anerkennt, inner-
halb dieser bleibt und alle anderen Meinungen ausschliesst.Als Vorsitzender des Vereins dankt Bleuler den Kollegen in Wien, die sich
um das Zustandekommen des Kongresses bemüht haben, den HHr. Prof. Raimann,
Prof. v. Wagner, der dem Verein den Hörsaal seiner Klinik zur Verfügung ge-
stellt hat, Prof, Obersteiner als Präsidenten des Wiener Vereins für Psychiatrie
und Neurologie. Der Vorsitzende bedauert, dass die HHr. Prof. Bernheim undZentralblatt für Psychoanalyse. IV */* 13
S.
194 Kongressberichte.
Prof. Forel nicht anwesend sein können, und teilt mit, dass Dr. Bonjour seine
Abwesenheit entschuldigt hat, wodurch der von Bonjour angekiindigte Vortragentfällt.
Bleuler-Zürich hált den Eróffnungsvortrag:
Die Notwendigkeit eines medizinisch-psychologischen Unterrichts.In der naiven Medizin spielt die Psychologie eine wichtige Rolle; psychische
Einflüsse in der Ätiologie der Symptome und Symptomgruppen werden als Selbst-
verständlichkeiten angenommen. Der Medizinmann der „Wilden“ und der Pfuscher
in der modernen Grossstadt sind in diesem Punkte vollständig einig, im Gegensatz
zur Schulmedizin, die nur chemische, physikalische und infektiöse Prozesse kennt.
Die Möglichkeit, Mikroben und Gifte zu demonstrieren, ihre Wirkungen experimentell
zu studieren und zu analysieren, hat einerseits zu ungerechter Überschätzung dieser
Seite der Medizin geführt, andererseits die psychologische Auffassung in Misskredit
gebracht. Psychologische Auffassungen von Symptomen sind schwer zu beweisen;
eine der besten Methoden, wenn nicht die einzige, ist der Nachweis des Erfolges
der psychischen Behandlung. Die moderne Medizin trachtet die Intuition auszu-
schliessen, und die Denkweise des Arztes von heute geht in ganz anderer Richtung.
Die enormen Fortschritte in der Technik der Krankenuntersuchung und -behandlung
haben das instinktive Verständnis der Erkrankungen geschädigt; der Vergleich mit
dem Seefahrer liegt nahe, der im Besitz von Kompass und Karte ausgezeichnet
fährt, ohne diese Hilfsmittel aber sich nicht zu orientieren vermag; ebenso kann
die Medizin im Geltungsbereiche ihrer physikalischen, chemischen und bakterio-
logischen Methoden Grosses leisten, aber eben nur in diesem. Gewiss ist heute die
bakteriologische 'lyphusdiagnose sehr gut ausgebildet; aber die Typhus-
diagnose war auch vor Beginn der bakteriologischen Ara sehr gut möglich. Die
unbewusste psychische Funktion ist ein Nebenprodukt des Umganges mit den Neben-
menschen, von welchem man im alltäglichen Leben instruktiv Gebrauch macht, aber
die „Wissenschaft“ kann Instinkte nicht brauchen, sie verlangt „objektive“ Methoden,
sie will auch in der Psychiatrie nichts von psychischen Wirkungen wissen und
nicht die psychischen Ursachen geistiger Störungen zugeben, während es klar ist,
dass psychische Wirkungen eine latente Psychose manifest machen können. Die
Medizin ist ein Torso, wenn die Seele konsequent nicht beachtet wird. Die Medizin
hat den Instinkt durch nichts ersetzt, sie hat im Gegenteil sogar eine Psycho-
phobie geschaffen, die zu schweren Schädigungen führen kann, Bei einer erwerbenden
Frau, bei der ein Tortikollis (freilich nervöser Natur) bestand. wurde ein Gypsver-
band angelegt; die Pat. hätte ihre Stelle verloren, wenn Vortr. nicht den fixierenden
Verband hätte entfernen lassen, als die psychische Natur des Leidens erkannt war.
Ähnlich erfuhr er von einem Falle, in dem ein Gymuasiast Rückenschmerzen (ner
vóser Natur) hatte. In beiden Fällen hatte ein Chirurg Wirbelkaries diagnostiziert,
ebenso wie in einem anderen Falle, in dem ein hypochondrischer Melancholiker über
Kuieschmerzen klagte, die Operation erwogen wurde. Die psychischen Mechanismen,
die die Entstehung von lihmender Krankheitsfurcht bedingen, sind leicht zu er-
kennen, wenn man sie einmal durchschaut hat. Viele Arzte beobachten auch den
Einfluss ihrer Worte zu wenig. Eine besondere Wichtigkeit hat nach der Erfahrung
des Vortragenden die Diagnose ,Optikusatrophie*; er kennt einen Fall, in dem diese
(von einem Ophthalmologen gestellte) Diagnose sich als falsch erwies. Von der
Verzweiflung des Kranken kann man sich nicht leicht eine Vorstellung machen,
In einem anderen Falle trat eine so weitgehende Besserung ein, dass der Kranke
leichte Arbeit ausführen konnte; der Fall war als aussichtslos bezeichnet worden.
Ein Schizophrener, in dessen Vorstellungen eine Geburtsphantasie eine grosse RolleS.
Kongressberichte. 195
spielte, klagte tiber Schmerzen in der Oberbauchgegend, die als Verlegung nach
oben zu deuten waren. Der Chirurg fand einen Schatten in der Gallenblasengegend
und schlug die Operation vor, während an der rein psychischen Genese der Schmerzen
nicht zu zweifeln war. Der wirkliche Fehler lag in diesen Fällen nicht an den
Ärzten, sondern an ihren Lehrern. Ein besonderes Kapitel bildet das Elend der
Neurosen, in denen der Wille zur Krankheit oft ein treibendes Motiv ist.Es ist gewiss sehr vorteilhaft für den Kranken, wenn man seine Konstitution
durch Diätetik und andere Heilmethoden zu kräftigen vermag; die tatsächliche
Wirkung aller dieser Prozeduren besteht darin, dass sie dem Arzte Gelegenheit zu
psychischer Behandlung geben, sei es durch Psychoanalyse, sei es durch Suggestion.
Die Hauptsache ist es, dem Patienten eine Lebensmóglichkeit geben, eine mögliche
Lebensaufgabe schaffen. In dieser Hinsicht sieht man, dass Laien oft sich Er-
krankten gegenüber viel zweckmissiger verhalten als Ärzte. Es hat gar keinen
Sinn, einen Patienten, mit dem man keinen Rapport hat, eine Mastkur machen zu
lassen. Ein Erfolg wird nur durch psychische Behandlung erzielt. Viele latent
Schizopbrene klagen über Verdauungsstorungen, die sich durch Psychoanalyse als
Geburtsphantasien erkennen lassen. Besonders wichtig ist die Berücksichtigung der
Familie, die oft z. B. durch melancholische Kranke fürchterlich gequält werden; die
Umgebung des Kranken wirkt aber oft genug auch, erzeugt oder verstärkt Krank-
heitserscheinungen, so dass man in beiden Fillen am besten tut, den Kranken aus
der Familie zu entfernen. Wichtig ist auch die Prophylaxe geistiger Störungen
durch richtige Erziehung und Berufswahl. In diesen Dingen haben die Kurpfuscher
manche Vorteile errungen, indem sie auf die Bedürfnisse der Seele eingehen, was
z. B. Pfarrern ganz besonders gut möglich ist. Es hat gar keinen Sinn, bei solchen
Übergriffen zum Kadi zu laufen, man kann nur dadurch Erfolge erzielen, dass man
mehr und Besseres bietet als die Konkurrenz; nur die medizinische Psychologie
kann da ein Gegengewicht bieten; die Psychologie, die von philosophischen Studien
ausgeht, ist für die Medizin unbrauchbar; auch die „physiologische Psychologie“ ist
für die Klinik wertlos. So müssen denn für sie eigene Lehrstühle geschaffen
werden; denn der Studierende kann sich nicht von selbst ohne Anleitung jene Kennt-
nisse über den Zusammenhang von Seele und Körper verschaffen, die er für das
Verständnis psychopathologischer Phänomene braucht; medizinische Psychologie muss
als eigenes Lehrfach behandelt werden.Die Richtung ist gegeben; Anlage und Gelegenheit für die Entwicklung der
Neurosen, Untersuchungen, unter welchen Umständen sich psychische Phänomene
bei Erkrankungen des Nervensystems, sowie bei anderen Erkrankungen entwickeln,
sind Themen der medizinischen Psychologie. Dazu muss sie darstellen, inwieweit
und in welcher Weise Ursachen von Krankheitserscheinungen psychisch bedingt
sind. Sie muss zunächst auf die Affekte eingehen (denn die Rolle der Affektivität
in der Psychopathologie ist von grösster Wichtigkeit) und zwar vor allem auf die
negativen. Unter diesen sind als pathogenetisch zunächst wieder die ambivalenten
zu nennen, Wichtiges Beobachtungsmaterial gibt die Erforschung der Mimik; Vor-
tragender verweist kurz auf die von Veraguth hervorgehobene Bedeutung der
Falten im oberen Augenlid. In zweiter Linie erst kommt der medizinischen Psycho-
logie die Betrachtung der intellektuellen Sphäre zu, die den Boden liefert, auf dem
die Affekte sich abspielen. Sie wird auch die körperlichen Ursachen der seelischen
Störungen nicht vernachlässigen dürfen, muss z. B. Magenerkrankungen als Ursache
von Störungen des Humors, Tuberkulose als Ursache einer sachlich nicht begründeten
Euphorie berücksichtigen. Sie muss die Wichtigkeit psychischer Effekte für die
Diagnostik erkennen, sie muss zeigen, dass Magenstórungen nur Symptome psychi-
scher Prozesse sein können, sie muss aber auch lehren, dass Onanie nur auf dem18*
S.
196 Kongressberichte.
Umweg über die Psyche schadet, dass die Psyche ein ausgezeichnetes Reagens fiir
Hormone ist, ebenso wie fiir Nervengifte, besonders fiir Narkotika, und fiir andere
Pharmaka, z. B. Darmmittel. Aufgabe der medizinischen Psychologie ist es weiter,
dem Arzte, der natürlich nicht über alle Methoden der Behandlung verfügen kann,
Hinweise dafür zugeben, welchem Spezialisten er den Fall zuweisen soll, ob dem Ana-
lytiker, dem Hydrotherapeuten, dem Persuaseur etc. etc. Weiterhin hat sie die
Ursachen der Krankheiten darzustellen, sie darf sich nicht mit der , Überanstrengung*
begniigen, sie muss auf die Disposition und die anderen Faktoren hinweisen, sie
muss die Wirkung des Milieus untersuchen, sie muss psychische Hygiene treiben.
Viele ungliickliche Ehen lassen sich dadurch besser und erträglicher machen, wenn
die Ärzte erkennen, dass bei so vielen Frauen nicht Bosheit oder Unverstand, son-
dern Krankheit (vor allem kommt hier die Schizophrenie in Betracht) vorliegt.
Aufgabe der medizinischen Psychologie ist es, Uberlegung an Stelle des Instinktes
zu setzen,Besondere Wichtigkeit kommt der Erziehung zu, so werden abnorme Eltern
durch ihr Beispiel schädigen. Auch die Pädagogen werden sich mit medizinischer
Psychologie beschäftigen müssen; denn ohne naturwissenschaftliche Beobachtung
auf diesem Gebiete kann man nicht vorwärtskommen. Es soll nach Möglichkeit
verhindert werden, dass geniale Menschen in der Schule unerkannt bleiben. Es
muss den Pädagogen die Wichtigkeit des Gemütslebens klar gemacht werden, die
Fragen der sexuellen Aufklärung und sexuellen Moral müssen studiert werden,
grosseres Verständnis für die forensische Psychiatrie muss erzielt werden. Auch
die psychologische Bedeutung der Genussmittel muss bearbeitet werden. Die psychi-
schen Zusammenhänge im sozialen Leben, in Dichtung und Literatur, in Geschichte
und Religion müssen dargelegt werden. Der Arzt darf dem psychologischen Stoff,
den ihm die Literatur bietet, nicht fremd gegenüber stehen, jedenfalls darf es nicht
weniger orientiert sein, als andere. Die einseitige Bildung und Denkweise muss durch
Psychologische Ausbildung ergänzt werden, so dass psychische Zusammenhänge
ebenso bekannt und vertraut sein werden, wie die chemischen und physikalischen.
Nur allgemeine psychologische Schulung kann das leisten, nur auf dieser Basis ist
ein Fortschritt möglich. Den Anfang dazu muss ein systematischer Unterricht in
der medizinischen Psychologie bilden.Diskussion: Hr. Moll (Berlin) warnt vor einer Überschätzung des Unter-
richts in der medizinischen Psychologie und weist auf die Schwierigkeit der Durch-
führung desselben hin. Vorlesungen werden nicht viel Anklang finden. Am Kranken-
bett kann das, was Bleuler gefordert hat, zum grossen Teil nicht gelehrt werden.
Und das, was am Krankenbett gelehrt werden kann, müsste bald auf einer internen
Station, z. B. wegen Optikusatrophie, bald auf einer chirurgischen Station etc.
unterrichtet werden; das setze ein so kollegiales Verhältnis voraus, wie es auf dem
Kontinent nirgends existiere, soviel er wisse, Im wesentlichen werden es doch
Psychiater sein, die diese Dinge lehren. Er wolle die Wichtigkeit des theoretischen
Kollegs nicht in Abrede stellen, bemerke aber, dass Takt und Menschenkenntnis
nicht gelehrt werden können, die Erfolge der Kurpfuscher seien gewiss nicht durch
die medizinische Psychologie bedingt. Die Psychotherapie könne ja bei Neurosen
grossen Nutzen haben, aber oft sei auch eine somatische Behandlung nötig. Die
Bedeutung des affektiven Moments gebe er gern zu, aber gerade darum seien An-
gehörige oft gar nicht beeinflussbar, ebenso wie Liebende immer den Heiratskonsens
wollen. Was die praktische Seite der Schaffung von Kollegien für medizinische
Psychologie betreffe, so glaube er, dass sich die Regierungen nicht leicht dazu ent-
schliessen werden,S.
Kongressberichte. 197
Hr. Ranschburg (Budapest) schliesst sich dem Vorschlag Ble uler's an,
fordert aber, dass auch normale Psychologie unterrichtet werde. Sie muss im
Unterricht vorausgehen, denn sonst kann es dazu kommen, dass ein Student etwas
von Geftihls-, von Willenstórungen hört, ohne etwas von den normalpsychologischen
Eigenschaften dieser Psychismen zu wissen.Hr. v. Hattingberg (Miinchen) hebt gegeniiber Moll hervor, dass der Unter-
richt in der medizinischen Psychologie die Wirkung habe, eire andere Einstellung
des Arztes zu bewirken. Wovon man nichts wisse, daran denke man nicht.Hr. Winkler (Wien) schliesst sich der Forderung Bleuler's an und teilt
mit, dass seit dem Sommer 1913 an der philosophischen Fakultit in Wien ein
psychologisches Institut bestehe, das sich sowohl mit Geschichte der Psychologie,
als auch mit experimenteller Psychologie beschäftige. Für Pädagogen sei das
Studium der Psychologie obligat, sie müssten darüber Prüfung machen; nach der
Meinung des Redners könnte leicht eine entsprechende Vorschrift für Mediziner
zustande kommen analog der auf das Studium der Physik und Chemie beziiglichen
Vorschrift.Hr. Feri (Wien) bedauert, Hr. Bleuler widersprechen zu müssen, kann
aber nicht finden, dass die Medizin als solche durch die Abtrennung der verschiedenen
Spezialfächer viel gewonnen habe, Es sei wohl zu einer früher vielleicht für un-
möglich gehaltenen Verfeinerung der Untersuchung und Behandlung gekommen,
aber davon hätten nur einzelne Organe etwas, nicht aber der kranke Mensch. Die
medizinische Psychologie, die zu den verschiedensten Fächern, der internen Medizin,
der Neurologie etc. Beziehungen aufweise, habe — davon wisse man in Wien
speziell genug — keine so bedeutenden Erfolge auf diagnostischem und therapeuti-
schen Gebiete aufzuweisen, dass man sich so leicht hin entschliessen könne, einen
besonderen Lehrer für dieses Fach in Vorschlag zu bringen, dabei wären aber in
Wien führende Persönlichkeiten auf diesem Gebiet tätig.Hr. Löwy (München) betrachtet den Vorschlag Bleuler’s vom Standpunkt
der Hochschulpädagogik. Nur ein obligates Kolleg könnte nützen, denn ein nicht
obligates über medizinische Psychologie würden nur die Wenigsten hören. Es müsste
darum auch ein Examensfach sein. Aber es würde auch das noch nicht genügen,
denn ein theoretisch gelerntes, nicht praktisch geübtes Fach würde rasch wieder
vergessen, Kin anderer Weg könnte darin bestehen, die Professorenkollegien zu
reformieren ; wie letzterer aber geschehen sollte, wäre ihm selbst unklar. Er hielte
den ganzen Vorschlag für utopistisch.Hr. Kafka (München) schliesst sich den Bemerkungen Ranschburg's an
und erklärt, es sei notwendig, einmal gerade heraus zu sagen, dass die von philo-
sophischer Seite vorgetragenen Lehren z. B. die Lipp'sche Einfühlung für die
praktische Psychologie ganz wertlos seien.Hr. Bleuler hat sich die Schwierigkeiten der ganzen Frage nicht verhehlt,
aber durch Nachgeben werde es per analogiam nicht besser. Wollte man Moll
folgen, so würden die Kinder nicht deutsch lernen, weil sie nicht auch griechisch
lernen. Man müsse gegen alle in Betracht kommenden Staaten einen konzentri-
schen Angriff unternehmen, vielleicht würde dann etwas erreicht werden.Hr. Ranschburg (Budapest): Psychologische Methoden zur Erforschung
des Verlaufes der nervösen Erregung unter normalen und pathologischen
Bedingungen.Die Wirkungen der Reize auf das zentrale Nervensystem lassen sich nach
Semon zweckmässig einteilen in: 1. synchrone Erregungen, die mit dem Reize
gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig auftreten und abklingen, und denen bei zentralenS.
198 Kongressberichte.
Erregungen die Empfindung (bzw. Wahrnehmung) entspricht; 2. in engraphische Reiz-
wirkungen, d. h. Nachwirkungen des Reizes, denen physiologisch eine erhöhte Arbeits-
fähigkeit, psychologisch die Übung, die Fähigkeit zum Wiedererkennen, zur Wieder-
erneuerung durch Ekphorie, d. h. die Funktionen des Gedáchtnisses, der Reproduktion
entsprechen. Zwischen die synchrone Phase und die eigentliche eugraphische Phase
schiebt sich die sogenannte akolute Phase ein, d. .מ psychologisch ist mit dem Er-*
lóschen des Reizes fast gleichzeitig auch das Erlebnis, die Empfindung erloschen,
physiologisch ist aber die Reizwelle noch nicht abgeklungen, sondern bedarf hierzu
einer Zeit, die — wie dies z. B. aus den Nachbildern erweisbar ist — sich auf Se-
kunden erstreckt.Der Verlauf all dieser Phasen der Erregung ist nun mittels der uns zur Ver-
fügung stehenden psychologischen Methoden am lebenden Menschen, sowohl unter
normalen, als unter pathologischen Bedingungen der Forschung in hervorragendem
Masse zugänglich. Dabei kommen zwei prinzipiell verschiedene Methoden in Betracht,
die der Reaktionszeitmessungen und die der Reihenerlernung. Erstere zunächst von
Wundt, Buccola, Kraepelin etc. angewendet, dient der Untersuchung der Er-
regungsleitung und bestimmt im allgemeinen die Dauer der Assoziations- bzw. Re-
produktionszeiten (W und, Kraepelin, Ziehen, Sommer, Aschaffenburg etc.),
im speziellen erforscht den Krregungsablauf unter der Wirkung von Affektenflüssen
(Jung, Bleulers Schule, Moravesik etc.) Letztere, von Ebbinghaus ange-
bahnt, erweist sich als geeignet zur Feststellung engraphischer Reizwirkung und hat
bei progressiver Paralyse, seniler Demenz, Korsakoffschen Psychose interessante
Resultate ergeben. Vortragender hat mit dieser Methode, die, wenn auch nicht so deutliche
Resultate gibt, wie die Prüfung von Pupillen- und Sehnenreflexen, doch objektive
Ergebnisse liefert, bei Paralytikern gearbeitet und zwar nach der Methode der organi-
schen Wortpaare. Zwei Worte, die miteinander assoziativ zusammenhängen, wurden
einem Paralytiker zur Reproduktion aufgegeben, und zwar wurde der Versuch so
lange wiederholt, bis das Resultat der Reproduktion dem eines Normalen gleich war.
Wurde dieser Versuch nach 3 Wochen wiederholt, so zeigte sich, dass nach 2 bis 3-
maliger Wiederholung der Versuch positiv ausfiel, während beim ersten Versuch
9 Wiederholungen nötig gewesen waren, um eine Reproduktion zu erzielen; dabei
konnte sich Pat. absolut nicht an die vorausgegangone Prüfung erinnern. Es musste
also etwas zurückgeblieben sein, es war also möglich, die engraphische Disposition
zu messen. Bei Korsakoff'scher Psychose haben Brodmann und Gregor mit
dieser Methode gearbeitet und gefunden, dass nach 5 Sekunden 43%, nach 3' 3,4%
reproduziert wurden. Es ergab sich also ein steiler Abfall der Retention bei An-
wendung dieser Methoden. Die gesamten auf diese Weise gewonnenen Erfahrungen
ergeben, dass sich der zeitliche Ablauf ekphorischer Prozesse mit der Erkrankung
und innerhalb dieser mit den einzelnen Stadien der Erkrankung ändert. Es ist
möglich, mit dieser Methodik dort noch Merkfåhigkeit nachzuweisen, wo alle anderen
Methoden versagen, Wie wichtig die Ergebnisse dieser Art der Funktionsprifung
für die Prognose sind, ist von vornherein klar, und ebenso evident sind ihre Vorzüge
im Vergleich zu den anderen Untersuchungsmethoden. Es ergab sich z. D. als all-
gemeines Resultat, dass um 50 Jahre herum bei Gesunden die Leistungsfühigkeit zu
sinken beginnt. Vortragender demorstriert Kurven, die die Ergebnisse seiner mit dieser
Methodik durchgeführten Untersuchungen an den Schülern der Elementarschulen in
Budapest zeigen. Zeigt man bei dieser Art von Reihenerlernung dem Untersuchten
das erste Glied eines Paares, und ist die Aufgabe gestellt, das zweite zu reproduzieren,
so findet man schon unter normalen Personen sehr grosse Unterschiede; als einer
der Faktoren, die mitbestimmend wirken, ist moralische Minderwertigkeit anzuführen.
Eine neue Methode, die Vortragender allmählich im Laufe von 13 Jahren ausgearbeitetS.
Kongressberichte. 199
hat, beschüftigt sich mit der Tütigkeit der wahrnehmenden und auffassenden Zentren.
Die Auffassung von Sinneseindrücken ist kein momentaner, sondern ein wellen-
fürmiger Prozess, indem der Reiz nicht sofort verschwindet, sondern noch eine Zeit-
Jang nachwirkt. Die Methode besteht darin, dass in einem durch einen kleinen
Sektor eines Kreises (z. B. '/is der Peripherie) bestimmten Gesichtsfeld Buchstaben,
Ziffern, Farbenscheibchen etc, erscheinen, die 1/15 Sekunde bis 3 Sekunden exponiert
bleiben, je nach dem Willen des Untersuchers. Vortragender hat auf Kreisscheiben von
Papier, die hinter, bzw. unter einer undurchsichtigen, in einem Sektor ansgeschnittenen
Scheibe rotieren, in einigen aufeinanderfolgenden Sektoren Buchstaben etc. drucken
lassen, einige Sektoren freigelassen (zur Erholung wührend des Versuches) Vor-
tragender demonstriert nun mittelst dieses Apparates mit Hilfe von Bucbstaben unter
anderem die Tatsache, dass in der Reihe nrsr die beiden r verschmelzen, so dass
die Folge nrs oder nsr gelesen wird; ähnliches wird auch an Reihen von Farben-
scheibchen gezeigt. Es zeigt sich hierbei Hemmung und Verdrüngung durch Ver-
schmelzung gleichartiger Eindrücke, während verschiedenartige Eindrücke vonein-
ander nicht beeinflusst werden. Die Dauer der homogenen Hemmung ist zahlen-
måssig genau bestimmbar und zweifellos durch deu Zustand des Zentralnervensystems
bedingt; es ist also mit dieser Methode möglich, Aufschluss über den Funktions-
zustand der Aufnahms- und Auffassungszentren zu gewinnen, und darum ergibt sich
die Forderung, mit dieser tachistoskopischen Prüfung zunächst normale Menschen
zu untersuchen. Selbstverstándlich wurden vor der Prüfung Refraktionsanomalien
korrigiert und nur Personen mit normaler (eventuell erst durch Korrektur normaler)
Sehschürfe verwendet.Diskussion: Hr. Pótzl (Wien) verweist auf den hohen Wert, den Unter-
suchungen von Kranken mit partiellen Seelenstórungen (Alexie, Agraphie etc.) haben,
um über gewisse psychologische Fragen klar orientiert zu sein. Er hat in eiuem
Falle vou reiner Wortblindheit beobachtet, dass ein Kranker wohl einzelne Buch-
staben lesen konnte, aber unfähig war, sie zu einem Worte zusammenzufassen. Ähnlich
war es bei ihm mit der Farbenwalrnehmung. Nun ist bei Normalen bei einer zu
kurzen Exposition die Entstehung einer Wahrnehmung auch unmóglich, bei diesem
Kranken war sie es auch bei einer beliebig lang dauernden Exposition. Die Obduktion
ergab in diesem Falle eine Zerstörung im Gebiet der linken Sehsphäre und der dazu-
gehörigen Balkenstrahlung. Es zeigt sich also, dass die Störung einer einfachen
Wahrnehmung kein so einfacher Prozess ist, sondern sich aus einer Gruppe von
Elementen aufbaut. Ähnliche Befunde erhebt man bei der Untersuchung von Kranken
mit sensorischer Aphasie, die sich zurückbildet, indem háufiges und lautes Sprechen
das Zustandekommen des Verständnisses zunächst eher erschwert, später aber fördert.
Die Resultate stimmen mit den von Ranschburg mitgeteilten vollkommen überein.Hr. Feri (Wien) fragt, ob Ranschburg auch Farbenblinde untersucht habe.
Hr. Ranschburg bemerkt zu den Ausführungen von Pótzl, dass fliessende
Übergänge vom Normalen zum Pathologischen führen. Die Demonstrationsmethode
sei neu, das Phänomen alt. Die von der Affoktpsychologie gegebenen Erklärungen
für die Hemmung und Förderung homologer und heterologer Reihen sind unrichtig,
speziell die für die Psychopathologie des Alltagslebens (Verlesen etc.), da, wie aus
seinem Experiment deutlich hervorgehe, durchaus keine negativen Affekte mitspielen.
Von derselben Art, wie das Pötzl eben auseinandergesetzt habe, sei die Dysarthrie
und die Dysgraphie des Paralytikers. In der jüngsten Zeit sei eine Arbeit von
Stoll aus dem Institut Marbe's erschienen, die in der homogenen Hemmung die
Ursache der Dysgraphie erblickt. Falsche Leistungen des Denkens und der ver-
mittelnden Gefühle, und die Abweichungen in pathologischen Fällen stehen mit
diesem Gesetz der homogenen Hemmung in nahem, wenn nicht ursächlichem Zu-
asmmenhang.S.
200 Kongressberichte.
Diskussion über das Thema: Verdrängung und Konversion, eingeleitet durch
folgendes Referat von Hr. Frank (Zúrich).Schon wiederholt machten sich im Verein fiir medizinische Psychologie und
Psychotherapie Bestrebungen geltend, die psychologische Terminologie zu klären.
Wenn es bisher nur bei der Anregung verblieben ist, so dürfte die Ursache lediglich
in der Schwierigkeit der Aufgabe gelegen sein. — Da sich an der Terminologie, wie
sie bis heute geworden ist, nichts mehr ändern lassen wird, so dürfte es aber an-
gezeigt sein, bei neuen Begriffen, die noch in einem Werdeprozess stehen, klirend
oder eventuell richtunggebend einzugreifen. Von diesem Gesichtspunkte ausgehend,
hielten wir es als im Interesse der Entwicklung unseres Spezialgebietes gelegen,
wenn wir unsere diesjährige Tagung zu einer allgemeinen Aussprache, besonders über
zwei Begriffe, benützen wollten, die gerade gegenwärtig in unserer Literatur eine
wesentliche Rolle spielen :Die Verdrängung und Konversion.
Diese Begriffe wurden zuerst von Breuer und Freud gebraucht und fest-
gelegt. Für einen Teil der Forscher sind diese Begriffe völlig feststehende geworden
und bezeichnen für sie ganz bestimmte Vorgänge bei gewissen Affekten, während
sie andere allgemeiner gebrauchen und teilweise auch anders auffassen, während
wiederum ein Teil von Beobachtern sie so weit gelten lassen, dass sie annehmen,
dass wohl etwas darin sei, dass man mit solchen Begriffen wohl operieren kónne,
aber das Wie und das Was ist ihnen nicht ganz klar, wáhrend wieder andere den be-
quemsten, für alle Forschungen aber sterilsten Weg der direkten Ablehnung gehen und
mit all diesen Begriffen nichts zu tun haben wollen, weil sic Vorgünge bezeichnen,
die wir nicht kontrollieren kónnen. Da wir uns auf unserem Forschungsgebiet zu
fördern suchen und uns allen einschlägigen Beobachtungen zur Verfügung stehen,
wollen wir durch einen Gedankenaustausch auf Grund unserer Erfahrungen zu einer
Klarheit über diese Vorgänge zu gelangen suchen.Ursprünglich wurde der Begriff von Breuer und Freud in dem Sinne ge-
braucht, dass es sich um ein Ausschalten peinlicher Vorstellungen aus dem Bewusst-
sein mittelst aktiven Willens handle. Durch den Willen sollte eine besonders pein-
lieh affektbetonte Vorstellung aus dem Bewusstsein ins Unbewusste gedrüngt werden
kónnen. Durch die weitere Entwicklung der Freud'schen Lehre kam es dazu, dass
sich schliesslich der Begriff der Verdrängung lediglich mit der Verdrängung sexuell
betonter Vorstellungen deckte. Die so verdrångten Affekte, nahm man an, können
unterbewusst aufgespeichert und dann zur Neubesetzung früher erlebter kórperlicher,
krankhafter Zustände benützt werden. Diese Neubesetzung wurde mit dem Ausdruck
der Konversion ins Körperliche bezeichnet. Es erhebt sich die Frage, ob der Begriff
der Konversion lediglich zu gebrauchen sei, wenn es sich um die Umwandlung eines
bestimmten Affektes — des Sexualaffektes — in bestimmte kórperliche Symptome
handelt. Wenn wir uns auf diesem Gebiete Klarheit zu verschaffen suchen wollen, so
müssen wir nach meinem Krachten auch andere hierzu gehörige Erscheinungen des Affekt-
lebens in Betracht ziehen. So wollen wir auch im Folgenden nicht von einem Affekt im
speziellen, sondern von den Affekten im allgemeinen sprechen. Nun erhebt sich gleich
von Anfang an, wenn wir von Affekten im allgemeinen sprechen, die Schwierigkeit,
zu sagen, was wir unter Affekt überhaupt verstehen, und welche psychischen Vor-
gånge wir noch oder nicht mehr zu den Affekten rechnen sollen. Es ist unmöglich,
hier auf die Ansichten und Theorien der zahlreichen Autoren einzugehen; wir würden
nicht fertig werden, wollten wir jedem Autor gegenüber Stellung nehmen, für
unseren Zweck mag es genügeu, wenn wir aus rein praktischen Gründen sagen:
Affekte sind psychische Vorgünge, bei denen uns Gefühle bewusst werden. DamitS.
Kongressberichte. 201
ist zwar wenig gesagt, aber doch so viel, dass wir uns gegenseitig verstehen können.
So kann kein Zweifel darüber bestehen, dass hierzu z. B. Freude, Sorge, Kummer,
Zorn, Libido, Eifersucht, auch das Müdigkeitsgefühl gehören. Nun aber können wir
beim Studinm der Verdrängung beobachten, wie auch andere psychische Vorgänge,
so der Wille, die Aufmerksamkeit, affektverdrängend wirken können. Bleuler
rechnet diese psychischen Vorgänge mit zu dem von ihm aufgestellten allgemeinen
Begriff der Affektivitåt. Diese Auffassung kann man teilen, wenn man sich dann
eben unter Affektivitåt nicht mehr die Affekte als solche vorstellt, sondern ihr auch
diese Funktionen zuordnet. Das mag auch deshalb berechtigt sein, weil wir beim
Wollen, ebenso wie beim Richten und Anspannen unserer Aufmerksamkeit schliesslich
doch auch ein gewisses, diese Vorgänge begleitendes Gefühl wahrnehmen. Und
gerade die Wechselwirkung dieser beiden Funktionen mit den eigentlichen Affekten
gibt einige Berechtigung zu solcher Auffassung. Es ist aber ausserordentlich schwierig
Definitionen und Begriffe aufzustellen, die unserem Sprachgebrauch nicht entsprechen,
und wir können in unserer gesamten Literatur die Beobachtung machen, dass sıch
Terminologien nicht einbürgerten, wenn sie sich dem Sprachgebrauch nicht gefügt
haben. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, heute durch einen Beschluss hierin
Klarheit zu verschaffen. Aber wer sich mit diesen psychologischen Fragen eingehend
beschäftigt hat, wird die Tatsache zugeben müssen, dass durch das Aufeinanderwirken
eines, das Bewusstsein erfüllenden Affektes und eines bewust werden wollenden zweiten
Affektes in unserer Psyche Vorgänge Platz greifen, die entweder dazu führen, dass
der zuerst bewusst gewesene Affekt durch den zweiten aus dem Bewusstsein ver-
drängt wird, oder der zuerst bewusst gewesene Affekt war von solcher Intensität,
dass der zweite, aus dem Unbewussten hervordrüngende Affekt sich nicht bewusst
machen kann. Solche Wechselspiele zwischen zwei Affekten sind wir in der Lage,
nicht selten an uns selbst zu beobachten, aber auch während der Analyse bei unseren
Patienten, besonders bei der Analyse im Halbschlaf. Bei dieser sehen wir, wie bei
der Katharsis erst wieder ein Affekt zum Abreagieren gebracht worden sein muss,
bevor der andere sich bewusst machen kann. Am allerhäufigsten haben wir Gelegen-
heit, solche Beobachtungen bei dem Zusammenwirken der Libido mit anderen Affekten,
vor allem der Angst, des Ärgers, der Wut und der Eifersucht zu machen, Bei weitem
am häufigsten kommt das Wechselspiel zwischen Angst und Libido vor; dann auch
das Aufemanderwirken des Willens und der Aufmerksamkeit auf die Libido. Es
dürfte überflüssig sein, Ihnen, die Sie alle Gelegenheit haben, diesbezügliche Be-
obachtungen zu machen, hierfür Beispiele anzuführen. Es könnten dies ja leider
niemals objektive Nachweise, sondern auch immer wieder nur Schilderungen von
solchen Vorgängen sein. Bevor wir uns nun auf die Beantwortung der Frage ein-
lassen wollen, was aus diesen verdrångten Affekten wird, wollen wir uns noch klar
darüber werden, ob es überhaupt möglich ist, dass ein bewusst gewordener Affekt
durch seine Intensität einen zweiten Affekt verhindern kann, sich bewusst zu machen.
Auch diese Frage drängt sich uns, wenn auch bei anderen Affektstörungen, am
allermeisten beim Studium sexueller Anomalien auf. In einer grossen Zahl von
Fällen können wir uns die zutage tretenden Erscheinungen nur durch die Annahme
erklären, dass ein zweiter sich bewusst machen wollender Affekt ohne Wirkung bleibt.
Ich denke hierbei an die häufig vorkommenden Fälle, wo wegen der das Bewusstsein
erfüllenden Angst Libido sich nicht bewusst machen kann, wo aber dann der über-
wiegende Teil der Erscheinungen sich nur aus unterbewusst akkumulierter, aus der
Libido stammenden Erregung erklären lässt. So können wir eine Reihe von psycho-
neurotischen Zuständen, von den einfachsten Angstzuständen bis zu den komplizier-
testen Zwangsneurosen, nur dann verstehen — und ihre Heilung bringt uns den
Schlüssel zum Verständnis — wenn wir annehmen, dass die in vielen Fällen niemalsS.
202 Kongressberichte.
bewusst gewordene Libido akkumuliert wurde und die treibende Kraft fir die patho-
logischen Erscheinungen gebildet hat. So wie es uns gelungen ist, die Hemmungen
des freien Ablaufes der Libido zu beseitigen, und die zu Angst konvertierte Libido
zum Abreagieren zu bringen, fallen sämtliche krankhaften Erscheinungen dahin,
Das sind ganz alltiigliche Fille, die wir zu beobachten und zu behandeln Gelegenheit
haben.Wir sind so an die Frage herangetreten, was aus den, entweder aus dem
Bewusstsein verdingten oder überhaupt nicht zu Bewusstsein gekommenen Erregungen
geworden ist. Wir können deren Existenz selbstverstándlich objektiv nicht nach-
weisen, so wenig wie wir durch den Augenschein die in einer elektrischen Akku-
mulatorenbatterie aufgespeicherte elektrische Batterie beobachten können. Es kann
sich deshalb für uns die Frage nur so gestalten, ob wir über genügende Beobachtungen
verfúgen, die uns berechtigen, eine Hypothese der Akkumulierung der Affekte an-
zunehmen. Meine, sich úber eine Reihe von Jahren erstreckenden Beobachtungen
sprechen unbedingt dafür. Ich könnte mir eine ganze Reihe von täglichen Beobach-
tungen nicht erkliren, weon ich nicht zu einer solchen Hypothese greifen wiirde.
Aber wir dirfen uns durchaus nicht vorstellen, dass die einzige Quelle fiir die Akku-
mulierung der Sexualaffekt sei. Es können darüber gar keine Zweifel bestehen, dass
er die Hauptquelle liefert, das ist biologisch auch leicht begreiflich. Aber bei einer
nicht geringen Anzahl von Fällen, besonders von Angstneurosen, können wir mit
Sicherheit die sexuelle Ätiologie ausschliessen, und doch findet eine Akkumulierung
statt. Hier sind es hauptsächlich die Fille, bei denen eine Verdrängung durch den
aktiven Willen stattfindet. So bei den zahlreichen Angstzuständen, wo der Patient.
der vom Arzt fiir willenlos gehalten wird, Jahre und Jahrzehnte hindurch die in ihm
anfsteigende Angst durch den Willen niederringt, d. h. verdingt. Meine Beobach-
tungen sprechen unzweifelhaft dafür, dass durch diese Vorgänge allein schon eine
Akkumulierung stattfindet. Aber es ist dıes nicht nur bei der Angst, sondern auch
bei anderen Affekten, wie Wut, Ärger, Eifersucht, innere Unruhe, Müdigkeit, Ver-
legenheit wie Befangenheit der Fall. Häufig, ja in den meisten Fällen beobachten
wir in dem nämlichen Krankheitszustand das Zusammenwirken mehrerer Affekte.
Diese Akkumulierung zeigt sich uns besonders bei der Katharsis im Halbschlafzustand.
Wir sehen, wie beim Beginne einer Behandlung die Affekte übermächtig stark zum
Abreagieren kommen, wie sie nach und nach abnehmen. Und dann wieder können
wir beobachten, wie es zu eigenartigen Affektverschiebungen kommt: Die Patienten
durchleben zuweilen Szenen wieder und sind dabei erstaunt, dass die Gemiits-
erregungen unvergleichlich stärker beim Wiederdurchleben waren, als beim Erst-
erleben. Solche Vorgänge können wir uns nicht erklären, wenn wir annehmen
würden, dass jedes Erlebnis mit dem zugehörigen Affekt als ein unveründerliches
Engramm in unserem Gehirn aufbewahrt würde. Wer eine, noch besser aber eine
Reihe von Analysen im Halbschlafzustand durchgeführt hat, wird sich klar darüber,
dass unsere affektbetonten Erlebnisse in uus so aufbewahrt werden, dass sie, sowohl
inhaltlich, wie bezüglich ihrer Affektbetonung, gegenseitig in Verbindung stehen.
Nur so können wir auch ihr Bewusstwerden durch die assoziative Anregung, die
mittels jeder der beiden Komponenten geschehen kann, verstehen. Andererseits
kónnen wir beobachten, wie bisweilen die Affekte von im Unterbewusstsen auf-
bewahrten früheren Rrlebnissen stärker, als beim primären Erlebnis waren. Diese
Verstärkung muss aus irgend einer anderen Quelle stammen. Am häufigsten be-
obachten wir dies eben, wie schon erwühnt, durch die Verdrángung und Aufspeicherung
besonders der von der Libido stammenden Erregungen. Wenn Freud früher nur
von einer Konversion ins Kérperliche sprach, und damit das Hervorrufen, das Er-
wecken lediglich kürperlicher Symptome verstand, so dürften weitere BeobachtungenS.
Kongressberichte. 203
dazu führen, diesen Begriff anders zu fassen. Wir kommen dazu, anzunehmen, dass
jeder Affekt aus nichts anderem, als aus Erregungen besteht, aus Dynamismen, die
bald den einen, bald den anderen Affekt hervorrufen und verstärken können. Wenn
wir uns doch vorstellen müssen, wie gerade körperliche Symptome rein psychisch
bedingt sein und lediglich dadurch wieder hervorgerufen werden können, dass die
entsprechend lokalisierenden Engramme wieder angeregt werden, so fällt es uns
nicht schwer, diese Vorgänge zu verallgemeinern und so zu einer einfachen Erklärung
einer Reihe von Symptomen zu kommen.Einige Beispiele mögen dazu dienen, mich Ihnen verständlicher zu machen.
So können wir bei Patienten, die uns die Symptome eines neurasthenischen Zustandes
bieten, auffallend starke Müdigkeitsgefühle konstatieren. Nicht selten finden wir im
Zusammenhang mit diesen Müdigkeitsgefühlen auch Angstzustinde und deren Be-
gleiterscheinungen. Aber die Müdigkeitsgefühle stehen so im Vordergrund, dass wir
den Symptomen nach eher von einer Miidigkeitsneurose, als von einer Angstneurose
sprechen können. Wir können aber beobachten, wie in solchen Fällen die Miidig-
keitsgefühle stärker sind, wenn die Angstgefühle geringere sind, dass aber die Müdig-
keitsgefühle verschwunden zu sein scheinen, wenn durch irgend welche Krlebnisse
assoziativ stärkere Angstparoxysmen ausgelöst werden, oder die Müdigkeitsgefühle
und das mangelhafte oder gar unmägliche Abreagieren von Libido stehen in Wechsel-
beziehungen. Ja, wenn wir Gelegenheit haben, solche Zustånde quasi in ihrer Ent-
stehung zu beobachten, so können wir direkt eine Steigerung der Müdigkeitsgefühle
mit der Verdrängung der Libido beobachten. Geradezu experimentell gestalten sich
die diesbezüglichen Beobachtungen bei den Eifersuchtsneurosen. Das gleiche gilt
von Årgerneurosen in Verbindung mit Angstzustinden oder in Verbindung mit ver-
drångter Libido. Ein ganz besonderes Gebiet für solche Beobachtungen finden wir
bei den Neurosen, die mit Schmerzempfiudungen einhergehen. Hier können wir
sehen, ja wiederum experimentell beobachten, wie ein direktes Vikariieren der ein-
zelnen Affekte Platz greifen kann, so dass der eine fiir den anderen auftreten oder
direkt durch das Erregen der einen Affektart der schon hewusst gewordene ausser-
ordentlich gesteigert werden kann.Sind wir uns über diese Vorgänge klar geworden, so werden wir uns im
weiteren über andere Begriffe, denen ich heute nicht nåhertreten möchte, verstän-
digen können. Es ist dies der Begriff von Freud: die Neubesetzung mit Affekt,
ferner die Zuriickstauung, die Ubertragung, die Determinierung, die Verankerung der
Gefühle, die Gefühlsinversion usw. Für heute schlage ich Ihnen vor, diskutieren
wir nur über die Begriffe der Verdrängung und Konversion. Wir düríten schon
Gefahr laufen, auch bei dieser Diskussion nicht zu Ende zu kommen.Hr. Bleuler (Zürich) schlägt vor, zur leichteren Durchführung der Diskussion
das Thema in eine Anzahl von Teilfragen zu zerlegen und zunächst die Frage zu
besprechen: Wird verdrängt?Hr v. Hattingberg (München) führt aus, dass die Verdrängung bei der
Hysterie keine Rolle spiele; bei dieser Krankheit handle es sich, wenn man den Aus-
druck Vogt’s gebrauchen will, um eine Dysamnesie, die Kranken können nicht ver-
gessen, Nach einem von Freud selbst angewendeten Ausdruck leiden sie an Remi-
niszenzen. Man könne die Tatsache der Verdrängung nicht gut leugnen, aber sie
würde dann unmöglich das pathogene Moment sein.Hr. Winkler (Wien) bezeichnet sich als Vertreter der von Prof. Stöhr (Wien)
repräsentierten, bzw. begründeten Schule und ist nicht in der Lage, einzelne Punkte,
wie Hr. Bleuler vorgeschlagen hat, zu besprechen, sondern will das ganze Thema
diskutieren. Er spricht sich gegen die Ansicht aus, dass Affekte durch Affekte be-
kämpft werden, und bezeichnet die Kumulierung von Affekten als unmöglich, da dieS.
204 Kongressberichte.
Affekte keine Stoffe seien. Auch die Lehre von der Vielheit der Affekte könne er
nicht gelten lassen, sondern in Übereinstimmung mit Prof. Stöhr vertrete er die
Anschauung, dass die mit den verschiedensten Namen (Freude, Kummer, Zorn,
Arger etc.) bezeichneten Affektzustände nichts anderes seien, als verschiedene Zu-
stinde des Affektes, der sich in verschiedenster Art und Weise entlade. Um
eine seiner Vorstellung ähnliche Anschauung zu zitieren, erinnere er an Goethe's
Farbenlehre, die auch nur ein Licht kenne, das aber viele Farben habe. Je nachdem
die Reizleitung zu den Blutgefässen, bzw. den vasomotorischen Zentren und Bahnen
erfolge, oder zu den Muskeln oder zu den Drüsen, werde der Affekt in verschie-
dener Weise bewusst, so mache z. B. eine Erhöhung des Blntdruckes in den Hirn-
gefässen Unlustempfindungen. Das Wesentliche liege also darin, in welche ent-
ladende Bahn der Affekt eingeleitet werde. Die Tätigkeit der Verdrängungsmecha-
nismen bestehe nun darin, dass eine oder die andere ladende Bahn unwegsam wird.
Nach Freud's Anschauung seien die Vorstellungen gewissermassen auf einer Insel
isoliert, auf die man nur mittelst Zugbrücken gelangen könne, von denen bald die
eine, bald andere herabgelassen oder aufgezogen sei. Unlustbetontes werde nicht
reproduziert, weil seine Entladungsbereitschaft zu gering sei, da ein entgegen-
stehender Widerstand vorliege. Die Unlust bedinge die Entladungsunfihigkeit; nur
durch die Entladung sei eine Entlastung möglich. Ungünstige Verhältnisse in bezug
auf die Bahnen, durch welche die Entladung erfolgt, führen zu. einer Verstürkung
der Erinnerungswirkung, ohne dass Entladung erfolgt; ebenso wie etwa bei der
Seelenblindheit wohl Ladung, aber keine Entladung der optischen Zentren stattfinde,
So sei es auch bei der Verdrüngung. Die Entladung des Affektes zentrifugal
von dem Gehirn an die Sinnesperipherie, mache Schmerzen. Die hysterische Lüh-
mung, die durch Unlust bedingte Hemmung seien Phänomene zentraler Natur. Die
charakteristische, hysterische Anomalie sei die Willensunfähigkeit.Hr. Bleuler (Zürich) bittet, nicht Auffassungen und Theorien vorzubringen,
sondern Tatsichliches.Hr.Stekel (Wien) meint, gerade die Ausführungen W inkler`s bewiesen, wie
notwendig die Errichtung von Lehrkanzeln für medizinische Psychologie wäre, wie
sie Bleuler vorgeschlagen habe. Zwischen der offiziellen experimentellen Schul-
psychologie und der praktischen Psychologie, wie sie die tägliche Beobachtung der
Kranken ergebe, liesse sich keine Brücke schlagen. Es seien zwei verschiedene
Welten. Jeder gut beobachtete praktische Fall werfe jedoch die ganze ausgeklügelte
Theorie tiber den Haufen. Er habe in den letzten Jahren seine Anschauungen über
das Unbewusste und die Verdrängung bedeutend geändert. Wir wären mit Freud
gewühnt gewesen, anzunehmen, dass unlustbetonte Vorstellungen ins Unbewusste
verdrüngt werden kónnen und dann die Quelle neurotischer Beschwerden werden.
Die unbewusste Vorstellung bedeutet also nach Freud, dass dem Kranken die Móg-
lichkeit benommen sei, sich diese Vorstellung nach Belieben bewusst zu machen.
Dies möchte er bestreiten. Er führt nun zwei Fille aus seiner Erfahrung an. Kin
Student klagt über Schlaflosigkeit, sebr leichte Ermüdbarkeit, Unfähigkeit zu lernen
und vollkommenes Verschwinden des Sexualtriebes. Während er vorher in regel-
müssigen Zwischenriiumen kohabitieren musste, verschwand dieses Bedürfnis in den
letzten. Monaten vollkommen. Stekel vermutete nun, dass der Student sein Be-
gehren auf ein bestimmtes Objekt fixiert habe, also verliebt sei. Der Kranke leugnet
jede prüsente Liebe, gibt aber zu, verliebt gewesen zu sein.Es handelte sich um ein armes Mädchen. Sein Vater habe ihm die Aussichts-
losigkeit dieser Verbindung vor Augen gestellt. Er war ein sehr armer Student und
sehnte sich nach Wohlleben und Reichtum. Seine Geldgier siegte über seine Liebe
und er sagte sich: Du darfst dieses Mädchen nicht lieben! Und von diesemS.
Kongressberichte 205
Tage an war die Liebe vollkommen geschwunden. Aber nur scheinbar, Denn er
verlor jede Libido fiir andere Frauen, weil er die eine um so heisser begehrte. Er
gab dann zu, dass er sich in Pollationstriumen mit der verlorenen Braut sehr intensiv
beschäftigte. Was war hier vor sich gegangen? War diese Liebe unbewusst? Un-
bewusst im Sinne einer Verdrängung? Nein! Der Kranke wollte seine Liebe
nicht sehen. Es handelt sich also um ein Nichtsehenwollen. Aber diese Liebe
war ihm nicht unbewusst, sie war sozusagen nebenbewusst. Der zweite Fall betrifft
einen 40jåhrigen Mann, der plötzlich impotent wurde. Die Auffassung der Ärzte
war eine beginnende Arteriosklerose. Nach einem Jabre, in dem er vollkommen im-
potent war, verliebte er sich in eine Dame, bei der er sofort heftige Erektionen hatte.
Es kam ihm zum Bewusstsein, dass er diese Dame schon seit einem Jahre liebte,
ohne es zu wissen, also unbewusst. Bei eindringlichem Befragen gibt er aber zu, er
hätte gleich beim ersten Zusammentreffen mit der Dame gedacht: In diese könntest
Du dich sofort verlieben. Und nach einer Woche sei ihm der Gedanke durch den
Kopf geschossen: Um Gottes Willen, Du wirst dich doch nicht in diese Frau ver-
lieben! Das darf nicht sein. ‥ .Wir sehen in beiden Fällen mächtige ethische Imperative, welche die deutliche
Erkenntnis der Vorstellung der liebe verhindern. In beiden Fällen besteht aber
eine unklare Erkenntnis dieser Vorstellung, welche aber durch Gegenvorstellungen
überdeckt wird, Diesen Vorgang könne man Verdrängung nennen, er sei ein Willens-
akt, der Ausgang eines Kampfes zwischen Trieb und Hemmung.Hr. Schrecker (Wien) bemerkt, dass die Schulpsychologien der verschiedenen
Richtungen erst untereinander sich verständigen müssten. Gegen das Referat von
Frank müsse er entschieden Stellung nehmen, die Psychologie unterscheide scharf
zwischen Affekt und Gefühl, sie vermenge beide Arten psychischer Zustände durch-
aus nicht. Er lehne aber auch Freud’s Anschauungen ab, weil diese keine Er-
klärungen geben; was Winkler vorgebracht habe, sei Physiologie und nicht
Psychologie.Hr. v. Hattingberg (München) wendet sich gegen die Affekttheorie der Ver-
drängung. Er halte die Affekte für Triebe, Frank für Energie, die bei der Ver-
drängung gespeichert würden, Nun hätten viele Neurotiker ganz freie Zeiten, während
welcher die gespeicherte Energie nicht wirken sollte; das leuchte ihm nicht ein.
Nach der Entlastung im Halbschlaf müsse mit dem Patienten gesprochen werden,
und die Szenen müssten ausführlich durchgenommen werden. Mit der Affekttheorie
stimme es auch nicht zusammen, dass Neurotiker Angst vor einem Krlebnis haben.
Bei der Verdrängung würden nur Affektäusserungen unterdrückt, die Affekte selbst
würden durch Einfühlung von den Aussenstehenden bemerkt. Man könne die Dys-
lexie und die zugehörigen Erscheinungen der Psychopathologie des Alltags wohl
nach Freud erklären, aber auch nach der Auffassung von Ranschburg.Hr. Feri (Wien) bemerkt, dass die verschiedenen Diskussionsredner unter
Verdrångung offenbar nicht dasselbe verstehen, und ersucht Hrn. Stekel um eine
Definition.Hr. Klages (München) bedauert, dass die Diskussion abgeirrt sei. Es handle
sich um psychische Phänomene, mit denen die ätiologisch denkende Medizin nicht viel
anfangen kønne. Dem Mediziner sei der psychische Tatbestand unbekannt. Es seien
zunächst die Fragen zu beantworten: Ist Verdrängung etwas Nichtgedachtes oder
Nichtgewusstes? Wodurch unterscheidet sich Verdrängen von Unterdrücken und
Beherrschen ?Hr. v. Hattingberg (München) meint, nach einer Definition zu suchen, sei
nicht die dringendste medizinische Aufgabe.S.
206 Kongressberichte.
Hr. Feri (Wien) erklärt, sich auch mit einer nicht streng schulmåssig abge-
fassten Inhaltsangabe zn begnügen.Hr. Barany (Wien) meint, aus den vorgebrachten Ausserungen schliessen zu
sollen, dass bei der Verdringung eine Affektentwicklung unterdriickt wird, dass ein
Affekt, der schon da war in seiner Entwickelung gehemmt wird. Die Introspektion
sei für diese Verhältnisse von grüsster Bedeutung.Hr. Stekel (Wien) erklärt, er wisse wohl genau, was er unter Verdrängung
verstehe, könne aber keine scharfe Definition geben. Er gebe gerne zu, dass das
Problem der Verdrängung sehr wichtig sei und der Klärung bediirfe.Hr. Pappenheim (Wien) weist auf den Unterschied von Verdringenwollen
und Beherrschen hin.Hr. Winkler (Wien) unterscheidet einen ersten und einen zweiten Teil der
Verdrängung. Das Verdrängen geschehe absichtlich, das Verdrångte sei nicht im
Haupt-, sondern im Nebenbewusstsein (Stöhr).Hr. Stekel (Wien) bemerkt, man müsse Hr. Klages sehr dankbar sein,
dass er durch seine präzise Fragestellung eine Definition ermöglicht hat. Er fragte:
Ist die Verdrängung etwas Nichtgedachtes oder etwas Nichtgewusstes? Darauf
miisse Redner antworten: Nach meiner Erfahrung nur etwas Nichtgedachtes. Redner
möchte also die Definition vorschlagen: Unter Verdrängung verstehen wir
jenes psychische Phänomen, dass wir aus Motiven der Unlust eine
bestimmte Vorstellung nicht denken wollen.Ganz anders stehe die Frage der Konversion, Nach Freud sei sie eine Folge
der fehlerhaften Libidobesetzung. Die Libido werde auf das Körperliche abgelenkt.
Dieser Anschauung konne er sich nicht anschliessen. Auch die Konversion sei ein
rein psychischer Vorgang. Eine Dame soll zu einem Rendezvous gehen, um das sie
ein Verehrer bittet. Sie soll einen Offizier in seiner Wohnung besuchen. Sie er-
krankte in der Nacht vor dem kritischen Tage an einer Lähmung beider unterer
Extremitäten, Die Vorstellung: „Ich darf nicht gehen!“ hatte sich in eine andere:
„Ich kann nicht gehen!“ verwandelt. Die Lähmung ist der Ausdruck dieses inneren
Imperatives und hat mit einer Verschiebung der Libido nichts zu tun. Ein anderes
Beispiel: Ein Mann will seinen Vorgesetzten mit einem Dolche erstechen. Er er-
krankt an einer Lähmung des rechten Armes. Auch hier das Uniiberwindliche: „Ich
kann es nicht tun“, das durch die hysterische Lähmung den Erkrankten vor dem
Verbrechen schützt,Hr. Bleuler (Zürich) gibt den Unterschied von Beherrschung und Verdrängung
zu; wo das Verdrängte existiere, sei eine Frage für sich.Es steht weiter die Frage zur Diskussion: Aus welcher psychischen
Sphäre wird verdrängt?Hr. v. Hattingberg (München) führt aus, die Frage sei, ob Gedachtes oder
Nichtgewusstes verdrängt werde. An der Verdrängung hat das ganze Ich teilge-
nommen, das lässt sich mit Sicherheit definitiv entscheiden, Die Verdrängungs-
wirkung tritt dann ein, wenn das Verdrängte nie bewusst worden ist. Mit der Ver-
drängung hänge auch das Nichtbemerken eines somatischen Entgegenkommens in
sexuellen Dingen zusammen,Hr. Tauszk (Wien) bemerkt, dass Freud doch schon die zur Diskussion
gestellte Frage längst heantwortet hätte. Das Verdrängte sei nicht bewusst pathogen,
es sei zum Teil auch nie bewusst gewesen. Verdrängtsein bedeute ein Verhältnis
zum Bewutstsein, Unbewusstsein sei eine Qualität.Hr. Feri (Wien) fragt, wodurch diese Qualität definiert sei.
Hr. Tauszk (Wien) antwortet: „Eben durch das Nichtbewusstsein.“
S.
Kongressberichte. 207
Hr. Lowy (Wien) wendet sich gegen das von Freud in der letzten Auflage
seines Buches „Traumdeutung“ gezeichnete, einem elektrischen Element nicht un-
ähnliche Schema und führt aus, dass keine Lokalisation der psychischen Vorgänge
möglich sei.Hr. Federn (Wien) verwahrt sich dagegen, dass Freud dies beabsichtigt
habe, es handle sich nur um eine die Darlegung erleichternde Darstellung.Die Diskussion über die Frage, durch welche psychische Vorgänge verdrängt
wiirde, wird verschoben.JL Sitzung. 19. September 1913 Nachmittag.
Hr. G. Kafka, München, Uber das Verhältnis der Tierpsychologie
zur Physiologie und Biologie.Psychologie ist ihrer allgemeinsten und eben darum natürlich ziemlich tauto-
logischen Definition nach die Analyse der psychischen Erscheinungen. Kann es nun
in diesem Sinn überhaupt eine Tierpsychologie geben?Dass den Tieren psychische Fähigkeiten zukommen, war die längste Zeit
hindurch und ist auch heute noch dem naiven Beobachter nicht zweifelhaft. Die
Erklärung der tierischen Handlungen ist eben ursprünglich nicht weniger anthropo-
morphistisch, als die der übrigen Naturphänomene, 0. h. die Handlung erscheint
ohne weiteres „verständlich“, sobald es gelingt, sie auf eine bewusste Zwecktätig-
keit des handelnden Wesens zurückzuführen. Diese dem menschlichen Erklirungs-
trieb immanente anthropomorphistische Tendenz kommt in den Anfängen einer jeden
Wissenschaft zum Ausdruck, Kein Wunder also, dass die Deutung der tierischen
Lebensvorgänge die längste Zeit hindurch ebenfalls von anthropomorphistischen Vor-
stellungen beherrscht war. So tadelt bereits Theophrast, dass die Alten gewisse
tierische Reaktionen, die doch einen rein reflektorischen oder „iustinktiven“ Cha-
rakter trügen, als zweckbewusste Handlungen zu erklären versuchten. ,Missgunst*
sollte z. В. den Igel veranlassen, bei der Gefangennahme seinen Urin zu entleeren
und damit seine Haut zu verützen, ,Missgunst“ den Luchs, seinen Urin zu verscharren
(wie man ähnliches oft bei Hunden beobachten kann), 一 Missgunst deshalb,
weil Igelbant und Luchsurin wichtige sympathetisehe Mittel darstellen, deren
Heilkraft die Tiere den Menschen vorenthalten wollen. So albern diese anthro-
pomorphistischen Erklärungen klingen mögen, so muss man doch fragen, ob
die Hypothese eines sonst verdienten modernen Naturforschers (R om a es) einen
höheren Erklárungswert besitzt, dass nämlich viele Insekten bei Nacht zwar gegen
eine künstliche Lichtquelle, nicht aber gegen den Mond fliegen, weil ihnen der Mond
„bekannt“ sei, die Lichter dagegen ihre „Neugierde“ reizen.Solche Anthropomorphismen dürfen natürlich nicht gegen die Berechtigung
einer wissenscbaftlichen Tierpsychologie überhaupt ausgespielt werden. Ks ist als
Reaktion gegen derartige Hypothesen begreiflich, wenn die Naturwissenschaft die
Annahme einer ,Tierseele“ nur mehr als Vorurteil vergangener Zeiten gelten lassen
will, das namentlich durch die Zurückführung scheinbar komplizierter psychischer
Akte auf Verknüpfungen von Reflexen oder sogar von einfachen physikochemischen
Prozessen endgültig widerlegt sei. Von diesem Standpunkt aus gilt als Gegenstand
der wissenschaftlichen Forschung überall nur der Mechanismus und der Chemismus,
hóchstens vielleicht noch die teleologische Bedingtheit der Reaktionen, mit denen
der Organismus auf die Reize der Umwelt antwortet; Bewusstseinsvorgiinge aber
sind der Beobachtung nicht zugünglich und daher prinzipiell von der Untersuchung
auszuschliessen. Man sollte das nicht für möglich halten, da schon Forel erklärt
hat, dass der Streit über die Berechtigung der Tierpsychologie keinen Sinn habe,S.
208 Kongressberichte.
und da die üblen Folgen dieser „Psychologie“ hinsichtlich der Verwirrung der
Problemstellung und der Ahschneidung von Wissensgebieten manifest sind. Diese
ablehnende Stellung ist ein Verdrüngungsvorgang und ist auf subjektive kindliche
Motive zurückführbar.Nun entbehrt die Erbitterung, mit der die Vertreter der „exakten“ Wissen-
schaften die Tierpsychologie bekämpfen, und die Geringschätzung, mit der sie sich
über jede ,anthropomorphistisehe* Deutung der Tatsachen hinwegsetzen, gewiss
nicht aller Berechtigung. Der Naturforscher — wieweit auch der Psychologe als
„Naturforscher“ gelten darf, bleibe dabei vorläufig ganz ausser Betracht — muss
jede „Erklärung“ objektiver Vorgänge durch Wahrnehmungen, Stimmungen, Gefühle
oder gar durch logische Denkakte der Organismen, als durchaus unzulünglich ab-
weisen. Sein Ziel kann es nur sein, die tierischen Reaktionen in kontinuierliche
Reihen räumlicher Naturereignisse aufzulösen, die im kompliziertesten Fall von
Sinnesorganen ihren Ausgang nehmen, sich dureh das Zentralorgan fortpflanzen und
schliesslich in einer Erregung des motorischen oder sekretorischen Apparates ihr
Ende finden.Darf sich also die Physiologie niemals psychologischer Erklürung bedienen,
so bleibt doch noch immer die Frage offen, ob die rein physiologische Analyse der
tierischen Lebenstätigkeiten eine erschópfende sein kann. So zeigt die unmittelbare
Erfahrung wenigstens in dem einen Fall der Selbstbeobachtung, dass in diesem
Sinn auch die Trennung der Psychologie von der Physiologie eine künstliche ist,
dass sich die Lebenstütigkeiten wenigstens eines Organismus nicht in dem reflek-
torischen Funktionieren seiner Muskeln und Drüsen erschôpfen, dass vielmehr seine
Handlungen, wenn sie auch vom physiologischen Standpunkt aus nichts anderes, als
eine Reihe von Muskelkontraktionen darstellen, dennoch zum Teil aus Wahr-
nehmungen oder Stimmungen „hervorgehen“, von Gefühlen „begleitet“ sind und von
Zweekvorstellangen ,beherrscht* werden. Dass zwischen diesen psychologischen
und jenen physiologischen Phänomenen der Reizaufnahme, Reizleitung und Reiz-
übertragung kein Kausalzusammenhang derselben Art wie zwischen physischen Ob-
jekten bestehen könne, sei schon deshalb klar, weil sich in die Reihe der physio-
logischen Phänomene nicht plötzlich psychische Zwischenglieder einschieben lassen,
weil, grob gesprochen, das Messer des Gehirnanatomen niemals Empfindungen oder
Gefühle anschneiden kann. Wie immer aber das Verhältnis zwischen beiden Er-
scheinungsreihen zu denken ist, soviel steht fest, dass die psychischen Phänomene,
die jeder in seiner eigenen Erfahrung vorfindet, in funktioneller Abhüngigkeit von
den physiologischen Prozessen stehen, die er zum Teil an seinem eigenen Körper
beobachten, zum andern Teil aus Beobachtungen an fremden Körpern erschliessen
kann. Gegen die Übertragung solcher Beobachtungen von den fremden auf den
eigenen Korper darf gerade vom naturwissenschaftlichen Standpunkt kein Einwand
erhoben werden; nur der Solipsismus lehnt diese Übertragung ab, übrigens logisch
vollkommen konsequent.Damit ist aber bereits das Prinzip der „objektiven“ Naturwissenschaft durch-
brochen, nur Tatsachen anzuerkennen, die der unmittelbaren Beobachtung unter-
liegen, denn die psychischen Inhalte der Mitmenschen sind der direkten Beobachtung
nicht weniger entzogen, als etwa die der Protozoen. Will man also die Tierpsycho-
logie mit der Behauptung abtun, dass über die psychischen Fäuigkeiten der Tiere
keine Erfahrung möglich sei (v. Uexkuell), so muss man konsequenterweise auch
die ganze menschliche Psychologie, desgleichen einen grossen Teil der Sinnes- und
Gehirnphysiologie als nicht empirisch verwerfen. Daran ändert die Tatsache nichts,
dass, wie schon Descartes hervorhebt, unter den Menschen eine sprachliche Ver-
ständigung über ihre Erlebnisse bis zu einem gewissen Grade möglich ist, denn dieS.
Kongressberichte. 209
Verstindigung kann sich, worauf es hier allein ankommt, niemals auf den unmittel-
bar gegebenen Inhalt, z. B. die Wahrnehmung der griinen Farbe, beziehen. Wenn
also jedermann bei seinen Mitmenschen aus der Analogie der physiologischen Pro-
zesse im weitesten Sinn, also auch der mimischen, deiktischen und phonetischen
Ausdrucksbewegungen, auf die Analogie der psychischen Phänomene schliesst, so
liegt für ihn nicht der geringste Anlass vor, die Gültigkeit dieses Schlusses, zu-
nächst wenigstens fiir die höheren Tiere, aus dem-Grunde zu leugnen, weil eine
„Verständigung“ mit ihnen nicht möglich sei, d. h. also, weil er gewisse Ausdrucks-
bewegungen nicht als solche zu deuten vermag, obwohl ihre Analogie mit mensch-
lichen Reaktionen in die Augen springt.Wie voreilig derartige allgemeine Behauptungen sein können, lässt sich am
besten an einem konkreten Beispiel erläutern. Nuel, der den extremsten anti-
psychologischen Standpunkt vertritt, erklirt sich bereit, einem Affen Bewusstsein
zuzuerkennen, den man dazu dressiert habe, die Holmgren'sche Farbenunter-
scheidungsprobe zu vollziehen. Es dauerte aber nicht lange, bis Hachet-Souplet
und andere einen objektiven Beweis für das Farbenunterscheidungsvermógen höherer
Tiere erbrachten, der sich nur darin von dem Holmgren’schen Experiment unter-
scheidet, dass die Reaktion nicht in dem Heraussuchen einer bestimmten Farbe unter
verschiedenen gleichzeitig dargebotenen bestand, sondern dass die Tiere daran ge-
wóbnt worden waren, das Vorzeigen einer bestimmten Farbe mit einer bestimmten
Reaktion zu beantworten, und nunmehr durch die eindeutige Verknüpfung -
der Reaktion mit der „Normalfarbe“ erkennen liessen, dass sie imstande waren,
die viel schwierigere Unterscheidung sukzessive dargebotener Farben mit
ausserordentlicher Genauigkeit zu vollziehen. Dieser Dressurerfolg bildet natürlich
nur ein argumentum ad hominem, denn das Zustandekommen einer derartigen Asso
ziation beweist an sich ebensowenig das Vorhandensein psychischer Prozesse, wie
sich das Fehlen eines ,Verstiindigungsmittels“ über die tierischen Bewusstseinsvor-
gånge als Gegenbeweis verwerten liesse.Hat aber der unvoreingenommene Beobachter keinen Grund, an den psychischen
Fühigkeiten der höheren Tiere mehr als an denen seiner Mitmenschen zu zweifeln,
und zwar zunächst wenigstens so weit, als ihnen ein somatisches Substrat zugrunde
liegt, das dem Denkorgan des Menschen analog erscheint, so muss er sich auch
die Frage vorlegen, wie weit die Verwertung anatomischer Analogien gehen darf,
So hat Fechner darauf hingewiesen, wie verfehlt es wäre, die anatomische Ahnlich-
keit mit dem Menschen zum entscheidenden Kriterium für die psychischen Fihig-
keiten der Tiere zu machen, indem er darauf hinwies, dass Regenwiirmer sich trotz
des Mangels an Beinen bewegen, obwohl der Mensch und die höheren Tiere sich nur
durch Beine fortbewegen können. Selbst dort, wo sich anatomische und physiologische
Analogien nicht mehr entdecken lassen, bestehen doch noch immer biologische
Analogien, indem sich die ganze Mannigfaltigkeit des Verhaltens aller tierischer
Organismen unter drei Hauptkategorien subsumieren lässt, nämlich einerseits die
Akte der Selbsterhaltung, die eine negative Reaktion gegen schädliche und eine
positive Reaktion gegen nützliche Einwirkungen (so besonders das Aufsuchen der
Nahrung) bedingen, andererseits die zur Erhaltung der Gattung notwendigen Akte
der Fortpflanzung. Und da gerade diese Reaktionen in der menschlichen Psyche
die stärkste Resonanz finden, sprechen die ohjektiv-biologischen auch für subjektiv-
psychologische Aanalogien. Es erwächst so die Aufgabe, ein objektives Kriterium
für das Auftreten des Bewusstseins bei einer bestimmten Tierspezies ausfindig zu
machen. Auf alle Versuche, die zu diesem Zwecke unternommen worden sind, soll
hier nicht eingegangen werden. Nur soviel sei bemerkt, dass sie schon deshalb
aussichtslos erscheinen, weil sie eben, wie bereits öfters eingewendet wurde, nachZentralblatt für Psychoanalyse. IV 3, *, 14
S.
210 Kongressberichte.
einem objektiven Kriterium für eingestandenermassen durchaus subjektive Phänomene
suchen, und dass ferner der Gedanke einer plótzlichen Entstehung des Bewusstseins
an einem bestimmten Punkt der Tierreihe gerade zu dem evolutionistischen Grund-
zug der modernen Biologie im schroffsten Gegensatz steht. Die wichtigsten von
diesen Bewusstseinskriterien seien jedoch im folgenden besonders hervorgehoben,
weil sie vielleicht am dentlichsten die Verwirrung der Begriffe anzeigen, zu der
ein missverstündliches Streben nach absoluter „Objektivität“ führen kann.So haben Loeb und Bethe, trotz geringer Differenzen in der Hauptsache
übereinstimmend, als Kriterium des Bewusstseins die assoziative Gedächtnistätigkeit
aufgestellt. Der psychologische Irrtum, der dieser Anschauung zugrunde liegt, darf
den beiden Physiologen nicht allzu schwer angerechnet werden, So viel ist natürlich
richtig, dass die Kontinuität des Bewusstseins und damit der Besitz eines über den
jeweiligen momentanen Eindruck hinausreichenden Gesamtbewusstseinsinhaltes von
der Ausbildung des Gedüchtnisses abhüngt. Man muss aber bedenken, dass dem
Gedächtnis die Eindrücke, die es zur Einheit eines umfassenden Gesamtbewusstseins-
inhalts verknüpft, erst durch das Bewusstsein geliefert werden müssen. Obgleich
daher ein Bewusstsein, das nur den jeweils auftauchenden Eindruck zu perzipieren,
ihn jedoch nicht festzuhalten und mit den früheren Eindrücken zu verbinden imstande
wäre, für das Individuum keinen praktischen Wert besiisse, so dürfen doch gerade
solche ;Bewusstseinsdifferentiale als Vorstufen der höheren Bewusstseinsformen,
diese hóheren Bewusstseinsformen aber nicht als Typus des Bewusstseins überhaupt
betrachtet werden.Kann sich somit der Psychologe der Anschauung nicht anschliessen, dass
Bewusstsein überall nur dort anzuerkennen sei, wo assoziative Gedüchtnistütigkeit
vorliege, so wird umgekehrt der Physiologe die Behauptung Driesch's über die
Wirksamkeit eines ausserphysiologischen Faktors, eben des ,Psychoids“, nicht an-
erkennen.Der Physiologe kann als ,objektiver Beobachter“ den physiologischen Zusammen-
hang zwischen der Reizperzeption und der Erregung des motorischen oder sekre-
torischen Apparates niemals durch Eiuschaltung psychischer Zwischenglieder erkliren.
Wenn er daher auch vorläufig nur in den seltensten Füllen eine Reaktion in ihre
physiologischen Komponenten aufzulósen vermag, so muss ihm doch eine solche
Analyse aller tierischen Handlungen als das einzige Ziel seiner Wissenschaft erscheinen
uud er muss eben als Naturforscher die Forderung stellen, dass sich die materiellen
Vorgänge der Muskel- und Drüsentätigkeit, in denen letzten Endes alle Reaktionen
bestehen, durch eine lückenlose Reihe materieller Vorgünge mit dem materiellen
Prozess der Reizperzeption verbinden lassen. Auch der Chemiker kann oft nicht
alle Glieder komplizierter Reaktionen z. B. der Katalyse angeben, ohne dass er die
Aufgaben seiner Wissenschaft anders zu definieren sich veranlasst sieht. Aber auch
die vorsichtige Forderung, man solle wenigstens so lange von psychologischen Er-
klürungen absehen, als eine rein physiologische Erklärung nicht prinzipiell ausge-
schlossen sei, bleibt sowohl für den Physiologen als auch für den Psychologen un-
erfüllbar. Für den Physiologen deshalb, weil er überall auf eine objektive Erklärung
der objektiven Vorgünge dringen und sie sogar dort als ideales Ziel postulieren muss,
wo er sie gegenwürtig noch nicht zu geben imstande ist, für den Psychologen aber
deshalb, weil er durch seine eigene unmittelbare Erfahrung darüber belehrt wird,
dass die Möglichkeit einer physiologischen Erklärung psychophysischer Prozesse
keineswegs deren psychologische Interpretation ausschliesst.Die Untersuchung der physischen, psychischen und der psychophysischen Kausal-
zusammenhänge stelit drei vollkommen getrennle Aufgaben dar, deren jede nur unter
peinlichster Wahrung ihres Geltungsbereiches befriedigend gelöst werden kann.S.
המחה =
Kongressberichte. 211
Gerade dann aber, wenn der Psychologe die Forderung einer materialistischen
Erklärung aller materiellen Vorgänge rückhaltslos anerkennt, schliesst der Umstand,
dass es bereits gelungen ist, gowisse Reaktionen auf physikochemische Prozesse
zurückzuführen, für ihn nicht die geringste Nötigung ein, seinerseits nun die Annahme
psychischer Korrelate zu diesen Prozessen aufzugeben. Denn gerade dann muss
auch die physiologische Komponente der psychophysischen Prozesse an seinem eigenen
Korper einer materialistischen Erklärung zugänglich sein, ohne dass dadurch die
Tatsächlichkeit der in seiner unmittelbaren Erfahrung gegebenen psychischen Kom-
ponenten beeinträchtigt werden könnte.So wenig also die gelungene Zurückführung gewisser tierischer Reaktionen,
etwa einiger echter Tropismen, auf physikalisch-chemische Prozesse das Vorhanden-
sein psychischer Begleiterscheinungen ausschliesst, so wenig zwingt die vorläufige
Unmöglichkeit einer solchen Zurückführung zur Annahme psychoider oder psychischer
Zwischenglieder.Nun könnte man noch einwenden, dass man zwar die Annahme eines Bewusst-
seins der höheren Tiere auf die weitgehende Analogie zu stützen vermóge, die der
anatomische Bau und die physiologische Funktion ihres Nervensystems mit dem des
Menschen zeige, dass aber diese Analogie um so mehr abnehme, je tiefer man in
der Tierreihe hinabsteige, und dass damit das Vorhandensein psychischer Phiinomene
immer unwahrscheinlicher werde.Aus der Verschiedenheit der Organisation folgt aber hôchstens, dass auch die
psychischen Korrelate der auf verschiedener anatomischer Basis ablaufenden physio-
logischen Vorgänge erhebliche Verschiedenheiten aufweisen mögen.Dass über die Qualität dieser psychischen Korrelate keine Erfahrung möglich
ist, kann nach dem Früheren keinen ernsthaften Einwand begründen. Genug, dass
auch die objektive Analyse der tierischen Reaktionen eine Ableitung der komplizierten
Kombinationen aus einfacheren Mechanismen gestattet, deren Kontinuität an keiner
Stelle der Tierreihe eine Unterbrechung erleidet. Die Tierpsychologie darf daher die
Frage vernachlässigen, wieweit die qualitative Ähnlichkeit zwischen diesen Korrelaten
und den menschlichen Bewusstseinsinhalten im einzelnen Falle reicht, sie hat die
Aufgabe, die komplexen psychischen Erscheinungen analytisch in ihre elementaren
Komponenten zu zerlegen und genetisch bis zu ihren einfachsten Erscheinungsformen
zurückzuverfolgen.Sie befindet sich dabei insofern nicht einmal in einer ungünstigen Lage, als
jeder Zweifel an ihrer Berechtigung verstummen sollte, wenn überhaupt die Berech-
tigung des Prinzips zugestanden wird, auf die psychophysische Natur bestimmter
Reaktionen aus ihrer Analogie mit menschlichen Handlungen zu schliessen, die nach
der Aussage der unmittelbaren Erfahrung von Bewusstsein begleitet sind. Tatsâch-
lich erkennt jedermann die Gültigkeit dieses Prinzips an, wenn er seinen Mitmenschen
Bewusstsein zuschreibt. Wer also die Anwendbarkeit dieses Prinzips auf die Tier-
welt leugnen wolite, müsste seinerseits imstande sein, zum Beweis seiner Behauptung
objektive Kriterien dafür zu erbringen, dass im gegebenen Fall kein Bewusstsein
vorhanden sei, was unmöglich ist. Die Tierpsychologie hat sich daher im Grund
ibre Existenzberechtigung nicht erst zu erkümpfen, sie kann sich vielmehr in der
Defensive halten und sich damit begnügen, die Mängel der „objektiven“ Kriterien
aufzudecken, mit denen ihre Unzulåssigkeit bewiesen werden soll.Aber gerade der Umstand, dass die Anerkennung der T'ierpsychologie bei dem
Mangel objektiver Bewusstseinskriterien die Anerkennung psychischer Fähigkeiten
bereits bei den niederen Tieren nach sich zieht, wird bei vielen ein instinktives Miss-
traven wecken, da die Anschauung, besonders in naturwissenschaftlichen Kreisen,
ziemlich allgemein verbreitet ist, mit der Anerkennung psychischer Phänomene sei14*
S.
212 Kongressberichte.
— wenigstens in den Köpfen der Psychologen — die Anerkennung einer metaphysi-
schen ,Seelensubstanz“ untrennbar verbunden, und so werden sich viele lieber zu
der Inkonsequenz entschliessen, das gleiche Prinzip, nach dem sie die Handlungen
ihrer Mitmenschen beurteilen, in seiner Anwendung auf die tierischen Reaktionen
fiir ungültig za erklären, um nur jede „Metaphysik“ zu vermeiden und allen „spiele-
rischen* und durch die Erfahrung nicht zu bestitigenden Analogien aus dem Wege
zu gehen.Diese Zurückhaltung wird um so gerechtfertigter erscheinen, als die Tier-
psychologie selbst zugeben muss, dass die psychischen Komponenten psychophysischer
Prozesse von jedermann eben nur in einem einzigen Falle der Beobachtung unter-
zogen werden können, nämlich bei Selbstbeobachtung, dass dagegen zur empirischen
Beantwortung der Frage jede Handhabe fehlt, ob auch bei anderen Organismen die
gleiche funktionelle Abhingigkeit zwischen physischen und psychischen Prozessen
besteht. Und da die empirischen Daten, die jeder Tierpsychologie zum Fundament
dienen müssen, gleichzeitig den Gegenstand der Physiologie oder Biologie bilden,
diese empirischen Wissenschaften aber ihre Aufgabe darauf beschränken, die materi-
ellen Lebenserscheinungen auf materielle Grundlagen zurückzuführen, sind ihre Ver-
treter nur allzu geneigt, der Tierpsychologie jede selbständige Existenzberechtigung
abzusprechen und sie als ein miissiges Spiel anzusehen, das die objektiven Ergebnisse
der exakten Wissenschaft nicht nur nicht bereichern, sondern kein anderes Krgebnis
haben kann, als die objektiven Resultate miihsamer, empirischer Forschung durch
apriorische Postulate und phantastische Konstruktionen zu verwirren.Eine unbefangene Prüfung der Grundlagen und der möglichen Ziele einer
wissenschaftlichen Tierpsychologie gelangt jedoch zu einem wesentlich anderen Kr-
gebnis. Denn der Charakter der Wissenschaftlichkeit lässt sich der Tierpsychologie
nicht deshalb schlechterdings absprechen, weil ibre Ergebnisse eine Bestitigung durch
die unmittelbare Beobachtung nicht zugänglich sind und daher stets einer gewissen
Unsicherheit unterliegen, Obgleich nämlich diese Unmöglichkeit vom erkenntnis-
theoretischen Standpunkt anders zu bewerten ist, so besteht doch praktisch die
gleiche Unmöglichkeit, etwa die Hypothesen über das Innere der Erde, die Rückseite
des Mondes usw. einer Kontrolle durch die Erfahrung zu unterwerfen. Aus dieser
Unsicherheit jedoch erwächst der Tierpsychologie nur die Verpflichtung, sich streng
an die Ergebnisse der objektiven Forschung als ihre einzige Grundlage zu halten,
ohne sich dazu verleiten zu lassen, psychologische Interpretationen als kausale Er-
klärungen der physischen Phänomene auszugeben.Gerade deshalb aber lässt die Gemeinsamkeit des empirischen Materials, das
Tierpsychologie und vergleichende Physiologie bearbeiten, weder die eine noch die
andere Wissenschaft entbehrlich erscheinen. Denn die Tatsachen gestatten eine
subjektive ebensogut wie eine objektive Interpretation, und die eine lässt sich, nicht
durch die andere ersetzen, noch können beide Wissenschaften bei genauer Abgrenzung
ihrer Arbeitsgebiete jemals miteinander in Kompetenzstreitigkeiten geraten.Die prinzipielle Ablehnung aller Tierpsychologie führt zu einer durchaus ein.
seitigen Auffassung der tierischen Lebenserscheinungen. Denn selbst wenn das
ideale Ziel der „objektiven“ Wissenschaft erreicht wäre, alle diese Erscheinungen
auf physiologische Vorgänge zurückzuführen und aus physikalisch-chemischen Ur-
sachen, vielleicht unter Mitwirkung objektiver teleologischer Faktoren abzuleiten, so
wäre damit die Frage nach der phylogenetischen Entstehung und Entwicklung des
5 noch nicht gelöst, während doch nur die blindeste Voreingenommenheit
bestreiten könnte, dass hier Probleme von fundamentaler Bedeutung vorliegen.Aber jene Ablehnung schliesst zugleich eine bewusste und willkürliche Inkonse-
quenz ein, indem sie das Analogieschlussprinzip ohne zureichende objektive GründeS.
Kongressberichte. 213
auf die Interpretation der menschlichen Handlungen beschränkt. Wer dagegen diese
Inkonsequenz und jenen. prinzipiellen Verzicht auf jede genetische Psychologie für
bedenklicher hilt, als die relative Unsicherheit, die allen Hypothesen über fremdes
Bewusstseinsleben anbaftet, wird in den Schlissen, die das objektive Verhalten der
Tiere auf ihre subjektiven Zustände zu ziehen gestattet, das Material zum Aufbau
einer durchaus selbständigen und für das allseitige Verständnis der Lebenserschei-
nungen unentbehrlichen Wissenschaft finden, die sich mit der Vülkerpsychologie in
die Aufgabe teilt, die Entstehung und Entwicklung des Bewusstseins zu erforschen.Die Entscheidung zwischen beiden Alternativen wird also letzten Endes von
der subjektiven Veranlagung des einzelnen abhängen; mit anderen Worten: der
Punkt, an dem das Wissensstreben eines jeden zur Ruhe kommt, wird eben auch
auf diesem Gebiete dadurch bestimmt werden, „was für ein Mensch er ist“.Hr. Pötzl (Wien) verweist auf die grosse Wichtigkeit, die die Beobachtung
der zirkumskripten Seelenstörungen hat. Die Seelentåtigkeit stellt sich vielfach als
Integrationsprozess dar, speziell die Sprache; bei Beseitigung der Sprachstórungen
durch Übung (nach Gutzmann's oder Fröschels’ Methode) wird reintegriert.
Wichtig wären auch für die Tierpsychologie Dressurstudien z. В. an Hunden, wie sie
in dem Oberlünder'schen Dressurbuch dargelegt sind. Die Hirnpathologie und die
Beobachtung an Tieren gibt identische Resultate.Hr. Adler (Wien): Kinderpsychologie und Neurosenforschung り .
Gemeinsam ist dem Kind und dem Мегубзеп das Moment der grösseren Un-
selbståndigkeit, aus welchem Grunde sie in grósserem Umfange auf die Dienst-
leistungen anderer angewiesen sind; Kinder nehmen die Familie in Anspruch,
Nervóse ihre Familie, ihren Arzt und ihre weitere Umgebung. In der Neurose
werden die Personen der Umgebung zu gråsseren Aufgaben herangezogen und vor
verstärkte Forderungen gestellt. In der Individualität eines Menschen sieht man
seine Vergangenheit, seine Gegenwart und sein Ziel, in seinem Modus vivendi er-
kennen wir einen Zwang zur Zielsetzung. Charakter, Wille und Symptome sind
nur Teilerscheinungen eines ununterbrochenen Anreizes zur Zielstrebigkeit, der die
verschiedensten Mittel beniitzt, auch die scheinbar widerspruchvollsten, um nur dem
gesetzten Ziel näher zu kommen. Neigung des Patienten zum Arzt, Einschränkung
auf das Haus, Heraustreten aus dem Hause, wenn es dem Patienten dienlich er-
scheint, alles das ist nur Mittel zum Zweck. Von den Neurotikern gilt der Satz:
Wenn zwei nicht dasselbe wollen, so ist es doch dasselbe. Alles planvoll Individuelle
ist Vorbereitung zur Erscheinung, oder ist Ziel und steht hinter der Erscheinung.
Die ganze Summe der zur Neurose gehörigen Phänomene ist direkt dazu vorbereitet,
damit nur der vom Patienten gewollte Ausgang garantiert werde. Das Verhältnis
von Bewusstem und Unbewusstem ist nur ein Mittel im Dienste der Gesamtpersón-
lichkeit. Die konstitutionellen Faktoren und das Milieu sind die gegebenen Elemente,
durch welche die Zielsetzung und die Lebenslinie des einzelnen bedingt ist. Ziele
und Charaktereigenschaften passen zum Ziele, und alle seelischen Phänomene können
nur als Teilerscheinungen eines Lebensplanes verstanden und erfasst werden. Die
Tatsachen des Kinderlebens sind als vorbereitende Bewegungen im Hinblick auf ein
Ziel anzusehen. Das Ziel wird von nervås disponierten Kindern bald durch Trotz,
bald durch Unterwiirfigkeit angestrebt; zur Herrschaft, zur Beachtung zu kommen,
Interesse für sich zu gewinnen, ist der Endzweck. Rivalitit gegen den jüngeren
Bruder, Trotz, Indolenz, alles muss diesem Ziel dienen, Enuresis nocturna und
Nahrungsverweigerung werden dazu herangezogen. Zwangsneurose, Fetischismus sind! Zu den Vorträgen von Adler, Håberlin, Hattingberg, Schrecker war die
„Deutsche Gesellschaft fiir Kinderheilkunde“ geladen,S.
214 Kongressberichte.
auf dieser Basis entstanden, z. B. kann die Furcht, der Frau nicht gewachsen zu sein,
zu systematischen Versuchen führen, die Frau vor sich zu entwerten. Auch die
Liebenswiirdigkeit wird ebenso wie das Stottern im Sinne der Zielsetzung heran-
gezogen. Ein Nenrotiker will immer, Fühlen und Denken durchdringen einander
beim Neurotiker immer und, wie sich aus dem beim Kind begriindeten Gefiihl der
Minderwertigkeit Kompensationsbestrebungen entwickeln, die darauf abzielen, dem
Kinde Geltung zu verschaffen, ebenso arrangiert sich der Neurotiker sein Lebens-
system unter Zuhilfenahme seiner Erfahrungen, die er dann tendenziús verwertet;
niemand erleidet seine Erfahrungen tendenzlos. Jede Deutung muss in das Phi-
nomen hineingetragen werden, sie liegt vor oder hinter dem Phiinomen; es gewinnt
erst Interesse, wenn eine Leitlinie darin zu schen ist. Die wichtigsten Leit-
linien sind:Realtitigkeit.
a) Ausbildung von Fábigkeiten, um zur Uberlegenheit zu gelangen.
b) Sich messen mit seiner Umgebung,
c) Erkenntnisse sammeln,
d) Emptinden eines feindseligen Charakters der Welt,
е) Verwendung von Liebe und Gehorsam, Hass und Trotz.
Imagination.
f) Ausbildung des Als Ob (Phantasie, symbolische Erfolge),
g) Verwendung der Schwäche,
h) Hinausschieben von Entscheidungen, — Deckung.
Als unbedingte Voraussetzung dieser Richtungslinien findet man einzig ein
hoch angesetztes Ziel, das im Unbewussten bleiben muss, um wirksam zu
sein. Dieses Ziel ist je nach Konstitution und Erfahrung mannigfach konkret ein-
gekleidet und kann in dieser Form, regelmässig in der Psychose bewusst werden.Exempli causa entwickelt Vortragender die Analyse der Abwehrhaltung einer
Patientin, die immer die Untreue des Gatten befürchtete. Sie hatte ein sexuelles
Attentat als Kind erlitten und war zu dem Grundsatze gelangt, ich (ein Mådchen)
darf nie allein sein. Diese Ansicht ist richtig, und nicht die Breuer-Freud'sche
Auffassung, dass die Patienten an Reminiszenzen leiden; auch der Ausdruek Stim-
mungslage sagt zu wenig. Die ersten Kindheitserinnerungen der Patientin sind
Rivalitåtsregungen gegen die von der Mutter bevorzugte ältere Schwester, während
der Vater (ohne sexuelle Komponente) immer zu ihr hielt. Pat. litt spåter an anfalls-
weise auftretenden Kopfschmerzen zur Zeit der Menses, halluzinierte zu dieser Zeit,
von der Mutter an den Haaren gerissen zu werden, und lief einmal in einem Wut-
anfall weg, um im Fluss zu baden. Ähnliche Anfälle hatte sie von zwei Brüdern
gesehen. Die Patientin empôrte sich also gegen ihre weibliche Natur, und ihre
Überlegung war etwa folgende: Die Brüder revoltieren und sind die Herren, meine
Schwester geniesst die Gunst der Mutter, nur Tod oder Krankheit kann mir aus
meiner Erniedrigung helfen, das Alleinsein hört dann auf. Es ist gar nicht nötig,
dass solche Raisonnements bewusst werden; im Gegenteil, das Bewusstwerden wiirde
den Erfolg in Frage stellen. Der ganze Lebensplan ruht auf der Minderwertigkeit
der Frau, die darum nicht allein gelassen werden darf. Aus diesem Porträt ergeben
sich wertvolle Eigenschaften. Sie bekommt Angst, wenn sie allein im Wagen sitzt,
sie verliert die Angst, wenn sie vorne im Wagen sitzt. Sie wurde bei jeder Biegung
des Weges ångstlich, ebenso bei schnellem Fabren. Wenn sie bei diesen Gelegen-
heiten in die Zügel griff, wurde sie nicht ängstlich. Sie ergriff die Zügel nicht, um
die Pferde zuriickzuhalten, weil sie sich zu schwach dazu fühlte, sondern um sich
über den Mann zu erheben. Dieser aus der Kindheit stammende Lebensplan ver-S.
Kongressberichte. 215
anlasste die Patientin, alles zu tun, um von unten nach oben zu kommen, und be-
stimmt ihre Aggressionsstellung gegenüber ihrer Umgebung, zwischen der und ihr
erhöhte Spannung besteht. Wer sich schwach fühlt, wird zum Kunstmittel der
Neurose greifen, und deren Mittel stammen aus dem individuellen Leben, vor allem
aus der Kinderzeit; darum zeigt sich die Lebenslinie in der Neurose so deutlich;
darum ist man berechtigt, nicht das einzelne Phänomen als solches gelten zu lassen,
sondern immer nur in dem Verhältnis zur Lebenslinie anzusehen, in dem ein Punkt
zur Linie steht. Das Leben ist ein Kampf, jede Niederlage, jede Furcht vor der
Niederlage wird von dem Neurotiker stärker als von dem Gesunden empfunden.
Der Widerwille gegen Zwang ist bei ihm stärker als bei Gesunden und veranlasst
ihn, den solipsistischen Standpunkt einzunehmen. Aus seiner Kinstellung gehen
auch Zauberglaube, Perversionen in sexueller Hinsicht hervor, durchwegs auf der
Basis erschwerter Entwickelung. Der Gegensatz Macht — Machtlosigkeit tritt in
dem Schema Mann — Weib auf, und die sexuellen Auomalien dienen der Tendenz,
seine Überlegenheit über das weibliche Element zu demonstrieren. Sicherheits-
koeffizienten sollen den Weg in die Höhe ermöglichen. Um das Interesse wachzu-
rufen, wird der Krankheitsbeweis als Legitimation benützt, werden Nichtigkeiten
überschätzt; Fanatismus des Schwachen kann jede gegnerische Position abschwáchen.
Darum wird das Denken zum Grübeln, der Ruheverlust zur Müdigkeit am Tage,
es kommt zur Dysfunktion durch Aufmerksamkeit, in vielen Füllen speziell zur
Herabsetzung der Liebesfähigkeit.Hr. Hüberlin (Basel): Psychoanalyse und Erziehung.
(Da Hr. Hüberlin nicht anwesend ist, wurde der Vortrag von Herrn Frank
verlesen.)Wenn man von Psychoanalyse spricht, dann nimmt man sie im Sinne ihres
Begründers Freud und lässt alles beiseite, was andere daraus gemacht haben oder
zu machen versuchen. Die Frage ist, was Psychoanalyse in diesem Sinne mii Er-
ziehung zu tun habe. Aus der Antwort wird für den Kenner der psychoanalytischen
Ergebnisse klar werden, wie diese sich zur Erziehung verhalten.Man muss wohl, um die Bedeutung der Psychoanalyse ganz zu erschônfen
dreierlei in ihr unterscheiden, Sie ist zunüchst eine Methode psychologischer
Forschung, deren Ziel psychologische Erkenntnis, ohne Beschrünkung auf Neurosen
und ohne Rücksicht auf Therapie ist. Die Eigentiimlichkeiten dieser Methode sind
kurz folgende. Sie geht vor allem darauf aus, psychische Fakta, die aus bewussten
Zusammenhüngen heraus nicht zu begreifen sind, aus unbewussten Wurzeln zu ver-
Stehen, wobei dem infantilen Erleben als dem wichtigsten Nührboden des Unbewussten
eine sehr grosse Rolle zugewiesen wird. Dem Unbewussten selber sucht sie nahe-
zukommen durch Beachtung symptomatischer Ausserungen und Handlungen, durch
Aufhellung dunklerer Bewusstseinsgebiete, unter besonderer Berücksichtigung der
Fingerzeige, welche in den Träumen gesehen werden, und durch ähnliche Mittel.
Als eine Art heuristischen Prinzips dient die psychoanalytischen Erfahrungen ent-
stammende Überzeugung, dass der Sexualität (in einem besonders weitgefassten
Sinn) eine erstaunliche Wichtigkeit zukomme. Die Aufdeckung des Unbewussten
geht vor sich dureh Überwindung des „Widerstandes“, das ist derjenigen psychischen
Potenz, welche nach psychoanalytischer Anschaunng die „Verdrängung“ unbequemer
psychischer Tatsachen ins Unbewusste bewirkt hat und sie noch im Unbewussten
zurückhült. — Dies ,Unbewusste* wird in seiner Eigenart nicht weiter definiert;
es ist einfach der Ausdruck dafür, dass psychisch wirksame Agenzien da seien, von
deren Existenz und Wirksamkeit das Individuum nichts oder nichts Deutliches wisse
oder wissen wolleS.
216 Kongressberichte.
Psychoanalyse bedeutet aber heute allgemein nicht nur eine besondere psycho-
logische Forschungsmethode, sondern auch cine Summe oder einen zusammen-
hängenden Komplex psychologischer Erkenntnisse, Ansichten, Theorien, Voraus-
setzungen, welche teils dem psychoanalytischen Verfahren zugrunde liegen, teils
ihren Ursprung aus diesem Verfahren herleiten. Die einzige zugestandene Voraus-
setzung ist die, dass es eine psychische Kausalität gebe, dass man also die Be-
dingungen für psychische Tatsachen so lange als möglich auf psychischem Ge-
biete zu suchen habe. Seien sie nicht im bewussten Psychischen zu finden, so
könne noch das Unbewusste befragt werden, im Gegensatz zu anderen Richtungen,
welche rasch bereit sind, die Quellen des manifest Psychischen im Gebiet des Ana-
tomischen und Physiologischen zu suchen, Im übrigen ist dieser Gegensatz nicht
absolut, denn über die letzten Ursprünge des Psychischen schweigt bis jetzt die
Psychoanalyse, ja sie scheint sogar in Übereinstimmung mit dem Gegner zuletzt
doch an physiologische Hintergründe für die elementaren psychischen Fakta zu
denken. Der ganze Unterschied bestände dann darin, dass die Psychoanalyse nicht
so rasch die rein psychische Kausalität zugunsten der psychophysischen und
physischen aufgibt oder aufgeben zu müssen glaubt. Denn auch die Gegner nehmen
ja psychische Kausalität wohl bis zu einer gewissen Grenze an. — Die Wichtigkeit
unbewusster Tendenzen und Erinnerungen, die Schätzung des Infantilen, die Traum-
theorie, die Verdrängung und den Widerstand, die Rolle der Sexualität etc. be-
zeichnet der Umkreis der Anschauungen, welche man mitversteht, wenn man von
Psychoanalyse spricht,Psychoanalyse bedeutet oder umfasst aber drittens noch etwas anderes, näm-
lich ein bestimmtes therapeutisches Verfahren, das freilich in praxi mit der
Forschungsmethode Hand in Hand geht. Die Therapie sucht das Unbewusste nicht
aus reinem Forschungsinteresse auf, sondern 一 eben als therapeutische Methode 一
auch vor allem deswegen, weil dem Unbewussten eine zentrale Bedeutung fiir die
Entstehung und den Inhalt der Neurosen zugeschrieben wird. Für besonders wichtig
wird derjenige Teil des unbewussten Materials gehalten, der seinen Ausschluss aus
dem Bewusstsein einem Akt der Verdrängung verdankt. Die Therapie geht vor
allem darauf aus, die Verdrängungen aufzuheben und das verdrängte Material be-
wusstseinsmöglich zu machen, weil es als Bewusstes weniger gefährlich ist denn
als Unbewusstes, weil bewnssten Tatsachen gegenüber eine nicht pathogene Ver-
arbeitung, Paralysierung, Überwindung oder Beherrschung — wenn solche über-
haupt nötig erscheinen — eher möglich ist, als gegenüber einem Feinde, den man
nicht kennt.Was hat nun Psychoanalyse nach diesen drei Seiten mit Erziehung zu
tun? — Man wird vor allem zu unterscheiden haben zwischen dem Ziel und der
Methode der Erziehung. Beides Dinge, die man nicht verwechseln darf. Das Er-
ziehungsziel ist immer ein Ideal, welches sein Dasein und seine bestimmende Kraft
bewussten oder unbewussten Wertschätzungen unmittelbarer Art verdankt. Die
Methode dagegen ist der Inbegriff des Weges, welcher zur Realisierung des Ideals
eingeschlagen wird. Die Methode umfasst den Gang und die Mittel der Erziehung,
die ganz zielmüssig orientierte Technik. Diese ist indessen angewiesen auf die
Möglichkeiten, welche die Erfahrung, das Material, die individuellen Verhältnisse
ihr geben. So ist die Methode aller Erziehung immer von zwei Seiten bestimmt,
vom Ideal (Ziel) und von den empirischen Umständen, welche die Mittel und Hinder-
nisse, die Wege und Umwege darbieten und nötig machen,Dass Psychoanalyse mit irgend einem Krziehungs-Ziel als solchem nichts zu
schaffen hat, ist ohne weiteres klar, wenigstens sofern sie eine bestimmte Art
psychologischer Forschung und sofern sic einen Komplex psychologischer Anschau-S.
Kongressberichte. 217
ungen bedeutet. Letzte Ziele, Ideale, beruhen stets auf unmittelbaren Hächst-
wertungen ; sie drücken ein Seinsollen aus, das zwar noch nicht ist, ja missachtet
und umgangen werden kann, das aber gilt, weil es eben sein soll. Und zwar soll
es realisiert werden nicht aus irgend einem Grunde, d. h. um irgend eines andern
Gutes willen; denn sonst wäre es kein letztes Ziel, kein Ideal, sondern diese Rolle
übernähme jenes andere Gut und so weiter, bis einmal ein höchstes, inappellables
und nicht mehr zu begründendes käme, das seinen Wert und seine Gültigkeit rein
in sich selber hat, das eben unmittelbares Ideal ist. Dies wäre denn das
wahre Ziel. 一 Wenn es sich so verhält, so können letzte Ziele der Erziehung (wie
überhaupt des Handelns) niemals durch irgend welche empirische Erfahrung
gewonnen oder beseitigt oder durch andere ersetzt werden, auch nicht durch wissen-
schaftliche Erfahrung. Wissenschaft hat keine Kompetenz in Ansehung der
obersten Wertschätzungen. So verhält es sich mit ästhetischen, mit ethischen, mit
pädagogischen Normen und Idealen. Sie lassen sich weder begründen, noch irgend-
wie aus der Empirie ableiten, Es handelt sich bei allen pidagosischen Zielen zu-
letzt um den Gegensatz von Gut und Böse, Recht und Unrecht, Schön und Hisslich.
Alle derartigen Entscheidungen oder Stellungnahmen können aber niemals erkenntnis-
mässig gewonnen oder alteriert werden. Darum vermag psychoanalytische Forschung
oder Erkenntnis so wenig wie irgend eine andere, Erziehungsziele zu weisen oder
bestehende umzustürzen. — Wenn trotzdem von psychoanalytischer Seite gelegent-
lich Ansprüche dieser Art erhoben werden oder wenn versucht wird, ethische oder
pädagogische Höchstnormen psychoanalytisch zu „erklären“, so beruhen alle diese
Bestrebungen auf bekannten erkenntnistheoretischen Irrtümern, die zuletzt auf Selbst-
täuschungen über die Natur der „Werturteile“ und des Normativen hinauslaufen.Anders verhält sich die Psychoanalyse zu möglichen Methoden der Er-
ziehung. Denn bei jeder Erziehungsmethode handelt es sich nicht mehr um absolute
Höchstwertungen, sondern um Wege zu ihrer Realisierung.Ein wichtigstes Hilfsmittel jeder Erziehung ist selbstverständlich die individual-
psychologische Erforschung des Zöglings. Insofern darum Psychoanalyse eine neue
Art psychologischer Forschung überhaupt ist — gleichgültig vorerst, ob man sie als
ergiebige Methode gelten lasse oder nicht — erhebt sie den Anspruch, auch der
pädagogischen Psychologie und damit eben der erzieherischen Methode Dienste zu
leisten. Um so eher, als gerade das infantile Individuum besonders in der Richtung
ihres Interesses liegt. Zwar sind die individualpsychologischen Einsichten, die man
durch sie zu gewinnen vermag, wohl nicht durchwegs so unerhört neu oder gehen
nicht so weit über das sonst Erreichbare hinaus, wie manche Enthusiasten glauben.
Speziell unter Pädagogen, zünftigen wie unzünftigen, wird viel Psychoanalytisches
eher als Bestätigung, denn als Neuenideckung aufgefasst. Indessen ist sie mehr.
Sie gewährt entschieden Einblicke in individuelle Konstitutionen und Reaktions-
weisen, die eine Bereicherung bedeuten.Diese Stellungnahme bedeutet aber noch nicht eine unbedingte Empfehlung
dieser Forschungsmethode an die Adresse der Pädagogen. Es ist zuvor die Frage
zu entscheiden, ob die psychoanalytische Erforschung des Zöglings im ganzen
der Erziehung zu empfehlen sei oder nicht, — immer vorausgesetzt, dass es sich
um eine an und für sich erspriessliche Forschungsrichtung handle. Denn es könnte
ja sein, dass die Psychoanalyse dem Zögling mehr schadet, als der eventuelle Er-
kenntnisgewinn, seiner Erziehung zu nützen, imstande wäre. Die Entscheidung
darüber ist durchaus nicht leicht. Die Erfahrung des Vortragenden lässt ihn meinen,
dass das für die Psychoanalyse günstigste Alter erst mit 17 oder 18 Jahren beginnt.
Da aber mit 17 oder 18 Jahren die Erziehung im engeren Sinn sich bereits ihrem
Abschluss nähert, ja in der Regel schon abgeschlossen ist, so kommt wesentlich nurS.
218 Kongressberichte.
das für die Psychoanalyse ungiinstigere Alter bis zum Ansgang der Pubertätszeit
in Betracht. Und da halte ich denn allerdings dafür, dass eine eigentliche psycho-
analytische Durchforschung so junger Leute ihre Bedenken hat und tatsächlich mehr
schaden als nützen kann. Es kommt eben auf zweierlei dabei an: auf die Natur
des Züglings und auf die Art des Vorgehens, die wieder mit der Art des Psycho-
analytikers zusammenhängt.Es liegt im Wesen der Erziehung, dass alles, was man mit dem Zógling vor-
nimmt, sich den letzten Zielen der Erziehung unterzuordnen oder mit ihnen zu
harmonieren hat; so selbstverständlich auch die individual - psychologische Durch-
forschung und die Art ihrer Durchführung. Damit hängt die methodische Maxime
zusammen, das Herumarbeiten und Herumforschen am Zógling auf das Notwendige
zu beschränken; alles, was darüber geht, ist vem Übel. Nun steht allerdings von
vornherein nicht fest, wieviel in jedem Falle notwendig ist. Indessen besitzt jeder
einigermassen taugliche Erzieher ein sicheres Kriterium dafür in der Art und Weise,
wie der ②Ggling auf seine erzieherischen Massnahmen reagiert, ob „normal“ oder
„gehemmt“. Wenn cine sonst erprobte Erzichungsweise nicht verfängt, ohne dass‚ plausible Gründe dafür zu entdecken sind, so heisst das nichts anderes: als dass
eben unbekannte Hemmungen vorliegen.Nur in solchen Fällen ist weitere Erforschung des Zöglings geboten. Führen
dann die gewohnten Wege der Bewusstseinspsychologie nicht zum Ziel, so muss
eben das Unbewusste ausgeforscht werden, und hier bietet sich dann ein psycho-
analytisches Vorgehen von selber an. Fälle dieser Art sind durchaus nicht selten.
Sie umfassen nicht nur ausgesprochen „kranke“ Naturen. Auch bei „gesunden“
Kindern finden sich häufig Episoden oder Züge, denen ohne Erforschung der unbe-
wussten Motive kaum beizukommen jst (scheinbar unmotiviertes Lügen, Ängstlich-
keit, Zerstreutheit etc. etc). Hier hat eine richtig geübte Psychoanalyse ganz
sicher eine dankbare und verdienstvolle Aufgabe, nicht nur eine solche, die „allen
Regeln der Kunst entspricht“, sondern eben eine pädagogisch richtige, Denn
auch in der Durchführung, nicht nur mit Bezug auf die Indikation, hat sich jede
Forschung ins Ganze der Erziehung einzufügen. Die Frage, wann die Psychoanalyse
pädagogisch richtig durchgeführt ist, ist natürlich so im allgemeinen schwer bestimmt
zu beantworten, da so Vieles im einzelnen Fall der pädagogischen und psychologischen
Begabung des Erziehers überlassen bleiben muss. Doch sind einige Hinweise immer-
hin möglich. Vor allem ist auch in der Durchführung Beschränkung auf das Not-
wendigste unbedingt zu empfehlen. Das überflüssige Herumsuchen in der Psyche
des Zöglings ist nicht scharf genug zu tadeln. Das ,Unbewusste“ (d. h. das Nicht-
Bewusstsein gewisser Dinge) hat für das jugendliche Alter ganz gewiss seine positive
Bedeutung, aber man sollte überhaupt das Unbewusste unbewusst sein lassen, so-
lange damit keine Störungen und Hemmungen verbunden sind. — Dass ferner eine
derartige Erforschung Jugendlicher ganz besonderer Vorsicht und besonderen, sozu-
sagen potenzierten Taktes bedarf, ist selbstverständlich. Je zarter und je plastischer
noch das Material ist, desto schwerer ist die Verantwortlichkeit des Bildners, und
desto eher kann sich sein Zufassen mit unfeinen Händen rächen. Eine taktlose und
pädagogisch rücksichtslose Psychoanalyse bedeutet ohne Zweifel eine Schädigung
des Zöglings, die durch den Erfolg der Forschung kaum aufgewogen werden kann.
Die Psychoanalyse gleicht überhaupt einem scharfen, zweischneidigen Messer. Sie
vermag, wenn sie unrichtig geführt wird, Traumata zu schaffen, Deshalb fällt
natürlich nicht ein Vorwurf auf sie als solche, sondern eben nur auf den Psycho-
analytiker, der zu wenig Pädagoge ist. Eine rechte Psychoanalyse im Verband des
pädagogischen Vorgehens setzt mehr voraus, als nur gewöhnliches psychoanalytisches
Wissen und Können. Sie setzt vor allem ethische Sicherheit und Reife voraus.S.
Kongressberichte, 219
Sie setzt aber auch voraus, dass die untersuchende und erziehende Persönlichkeit
über jeder einzelnen Methode steht und sich niemals sklavisch an ein bestimmtes
Vorgehen binde. Auch die Untersuchungsmethode ist modifikationsfåhig, und es ist
Sache des Erziehers, sie gerade so zu handhaben, wie es dem Falle angemessen ist,
auch wenn dann eine erhebliche Modifikation oder eine Kombination mit anderen
Methoden herauskommt. Denn über der „Reinheit“ der Methode steht das Ziel der
Erziehung, und nie darf ein Hilfsmittel beherrschend, nie die Forschung (im Rahmen
der Erziehung) Selbstzweck werden.Es ergibt sich aus dem Angeführten von selber, was die beiden anderen Seiten
der Psychoanalyse mit Erzi-hung zu tun haben. Wenn auch manches an den bisher
propagierten Resultaten unrichtig, anderes noch nicht endgültig und scharf genug
erfasst und vor allem nicht wissenschafrlich einwandfrei verarbeitet sein mag, so
wäre es ein Unrecht, deshalb alle psychoanalytischen Anschauungen abzulehnen.
Es bleibt nach Memung des Vortragenden noch genug an gesicherten und frucht-
baren Einsichten übrig (ob sie absolut oder relativ neu seien, ist eine Frage für sich),
Es wird notwendig sein zu prüfen und kritisch das Richtige von den Zutaten, Ein-
seitigkeiten etc. zu sondern, dann aber das Bleibende für die allgemeine Theorie
der Erziehung vor allem auch prophylaktisch fruchtbar zu machen. Dass dabei
Vorsicht und eher Zurückhultung, als blinde Neuerungswut geboten ist, wie stets
bei pädagogischer Verwertung neuer Anschauungen, ist selbstverständlich.Was kann die Psychoanalyse als Therapie für das Vorgehen des Erziehers
bedeuten? Diese Therapie ist mit der Forschung eng verbunden, fällt aber nicht
mit ihr zusammen, "Tatsache ist vor allem, dass in sehr vielen Fällen die Heilung,
also das Ziel der Therapie, durch blosse Bewusstmachung durchaus nicht erreicht
wird, sondern dass noch ein zweites hinzutreten muss, von dessen Gelingen oder
Nichtgelingen erst der Erfolg der ganzen Therapie abhängig ist. Dies zweite ist
aber nichts anderes als ein Stück Erziehung. Denn ist das Verdrängte wieder
der bewussten Seelentätigkeit zugeführt, so kann der psychische Konflikt unter der
Leitung des Arztes einen besseren Ausgang finden, als ihn die Verdrängung bot.
Es gibt nach Freud mehrere solcher zweckmässiger Erledigungen. Entweder wird
die Persönlichkeit des Kranken überzeugt, dass sie den pathogenen Wunsch mit
Unrecht abgewiesen hat, und veranlasst, ibn ganz oder teilweise zu akzeptieren,
oder dieser Wunsch wird selbst auf ein höheres und darum einwandfreies Ziel ge-
richtet (Sublimierung), oder man erkennt seine Verwerfung als zu Recht bestehend
an, ersetzt aber den automatischen und darum unzureichenden Mechanismus der
Verdrängung durch eine Verurteilung mit Hilfe der höchsten geistigen Leistungen
des Menschen; man erreicht seine bewusste Beherrschung. Dies alles geht über die
blosse Frforschung oder Aufdeckung hinaus: es sind dies pädagogische Mass-
regeln, d. h. es ist Erziehung durch den Arzt, die in günstigen Fällen durch Selbst-
erziehung (manchmal ganz plötzlicher und spontaner Art) ersetzt werden kann, was
natürlich an ihrem pädagogischen Charakter nichts ändert,So besteht also die psychoanalytische Therapie aus Aufdeckung verborgener
psychischer Zusammenhänge (Erforschung) und Erziehung. Diese Erziehung ist aber
noch besonders charakterisiert durch ihr Ziel, Dies Ziel ist nie ein anderes, als die
psychische „Gesundheit“ des Analysierten. Der Patient mag ein Charakterlump,
ein sozial bedenkliches Individuum, ein Don Juan, ein Philister oder ein nobler
Charakter werden, wenn er nur gesund wird. Der Gesundheit wird zuletzt alles
andere unterstellt und eventuell geopfert.Man ersieht daraus, dass die Psychoanalyse selber ohne Erziehung nicht aus-
kommt, ja ihrerseits ein Stück Erziehung bedeutet. Dann aber, dass diese Art der
Erziehung niemals Erziehung überhaupt ersetzen kann, sofern Erziehung andereS.
220 Kongressberichte.
höhere Ziele als die blosse Gesundheit besitzt. Andererseits freilich wird jede iiber-
haupt diskutable Erziehungsweise die psychische Gesundheit in ihr Ziel einschliessen
oder doch zugeben, dass sie Bedinguug zur Realisation ihres Zieles ist. Also kann
die psychoanalytische Therapie, wo sie nötig ist, eine willkommene Hilfe des er-
zieherischen Vorgehens sein. Immer natürlich vorausgesetzt, dass sie in ihrem
forschenden wie in ihrem erziehenden Teile nicht neben dem therapeutischen Erfolg
pädagogischen Schaden stifte. Zugunsten ihrer erzieherischen Bedeutung darf noch
hervorgehoben werden, dass in nicht wenigen Füllen die psychoanalytische Therapie
Erziehungshemmungen zu entfernen vermag, die vorher allen móglichen pädagogischen
Massregelu trotzten, oder jedenfalls ohne sie viel schwerer zn heben gewesen wären.
Und dann ist eine richtig und mit ethischem Ernste durchgeführte Psychoanalyse
auch selber ein Stück Erziehung von mehr als therapeutischem Wert, ein Stück
Erziehung zur Ehrlichkeit gegen sich selber und zur Mannhaftigkeit, um von anderen
möglichen ,Nebenerfolgen* zu schweigen. Davor muss gewarnt werden, die Psycho-
analyse zum Experimentierfeld Ilalbgebildeter oder Sensationshungriger zu machen!
Möchte überhaupt niemals aus einer ernsten, in mehr als einer Beziehung ,goführ-
lichen“ Sache eine blosse Mode gemacht werden!Hr. v. Hattingberg (München): Zur Psychologie des kindlichen Eigen-
sinns.Vortragender will die Methodologie nicht besprechen und steht auch nicht
dogmatisch auf dem Boden einer bestimmten Theorie. Der Eigensinn bedeutet zu-
nüchst, rein sprachlich genommen, einen eigenen Sinn, der anders ist als der der
anderen, der anderes will, der anders handelt. Das Wort Eigensinn hat aber sekundär
seine Bedeutung wesentlich geündert und bezeichnet ein typisches Verhalten, dessen
Kern der Wille ist, Erfolge zu erringen. Man spricht von Eigensinn, wenn jemand,
obwohl unvorbereitet und sich untrainiert wissend, eine schwierige Bergtour unter-
nimmt, wenn ein Knabe einen Obstdiebstahl versucht, obwohl ihm von seinen Kame-
raden die Gefahr des Erwisehtwerdens, der Strafe durch den Gartenbesitzer, die
Gefahr des Kletterns deutlich vorgehalten werden. Er lässt sich durch die Erwä-
gungen des Kameraden nicht von seinem Vorhaben abbrinzen und merkt schon
während des Kletterns, dass er seine Kräfte überschätzt hat, dass der Gartenbesitzer
kommt etc. lisst sich aber nicht aufhalten und steigt weiter; sein einziges Motiv
ist sein Ehrgeiz, sein Wunsch zu imponieren. Es tauchen Gegenmotive von einer
Stürke auf, die ihn zurückgehalten hütten, wenn er sie gekannt hiitte. Seine Energie
stammt aus seinem Entschluss, seine ganze Person ist an der Realisierung des Vor-
habens beteiligt, die Bewunderung seiner Kameraden zu gewinnen, der Aplel ist ihm
ganz gleichgültig geworden. Mit dem „ich will“ tritt die Änderung der Person in
Tätigkeit. Erst durch den Entschluss wird die Kraft mobil, die den Zwang ausübt,
an seinem Willen festzuhalten. Bei Willensmenschen kommt ein derartiger Mecha-
nismus in Frage, besonders bei solchen, die schwere Defekte zu überwinden haben.
Mit Eigensinn wird an dem einmal Gewollten festgehalten, weil eine Ánderung des
Entschlusses vielleicht die Achtung der Umgebung beeinträchtigen könnte und damit
auch die Selbstschützung. Letztere Eigenschaft, die Abhängigkeit von dem Urteil
der anderen teilt der Eigensinnige mit dem Ehrgeizigen, doch kommen Ehrgeiz und
Eigensinn nicht oft beisammen vor, beim Ehrgeizigen handelt es sich um das Aner-
kennungsbedürfnis, beim Eigensinnigen um einen Defekt des Auffassungsvermógens,
um einen Anpassungsfehler. Das ganze Ich wird eingesetzt, weil er vor Gefahr be-
wahrt werden soll. Mit zunehmendem Anpassungsvermügen verliert sich der Eigen-
sin. Der Ehrgeizige passt sich dem Wunsch des Zuschauers an. Der Ursprung des
Eigensinns ist in einer primären Minderwertigkeit bei neurotischen Kindern zu suchen.S.
Kongressberichte. 221
Der Ehrgeiz und der Eigensinn zeigen sich, wenn das ganze Ich an einem Ziel inter-
essiert ist. Dies ist im wesentlichen für den aktiven Eigensinn (= Starrsinn) charak-
teristisch; in der Abhingigkeit vom Zuschauer ist ein reaktives Moment gegeben.
Reaktiv nennt Vortragender jenen Eigensinn, wo kein eigener Sinn tätig ist,
sondern nur die Orientierung gegen den Willen des anderen, gegen das Soll, aber
nicht gegen den Inhalt des Sollens. Dieser reaktive Eigensinn åussert sich bei
Kindern in der Verweigerung der Flasche, im , Wegbleiben*, in Wutkrümpfen. Daraus
entwickelt sich eine trotzige Aggressionseinstellung gegen die Massnahmen der Um-
gebung. Dabei zeigen sich individuelle Verschiedenheiten. Zum Zorn disponierte
Kinder neigen zum Eigensinn, der bald ubiquitür ist, bald sich elektiv auf die Er-
zieher erstreckt. Daneben kann die Aggression auch durch Freude an der Macht,
durch Willen zur Macht bedingt sein. Dem überlegenen Erzieher gegenüber
verschwindet der Eigensinn, der eine Erweiterung der lchgrenzen anstrebt. Auch
gegen die bei eigensinnigen Menschen grosse Suggestibilitit kann eine Einstellung
vorliegen, ebenso gegen die Angst, sich nicht durchsetzen zu hünnen, gegen die Un-
einheitlichkeit des Trieblebens. Auch die Furcht für die Selbständigkeit kann zum
Eigensinn ohne Rücksicht auf die momentane Situation führen. Er kann elektiv
sein, wenn besonders eine Beeinflussung gefürchtet wird. Auch Liebestendenzen, der
Wunsch, dass man sich mit dem Kinde beschäftige, kann die Ursache des Eigensinns
sein. In einem Fall, der in extenso publiziert werden soll, konnte das Kind fran-
züsische Worte nicht aussprechen, es sagte im Alter von ⑨① Jahren: „Ich will nicht
wollen.“ Mit 3 Jahren zeigte es grosse Vorliebe für exkrementelle Vorgänge, Seinen
Bruder Heinrich nannte es Helu, entstanden aus He und Lu; ersteres stammt aus
dem Namen, letzteres aus der kindlichen Bezeichnung für Urinieren. Es nannte den
Bruder so: „weil ich ihn lieb habe“. Es schåmte sich leicht vor Freunden und war
leicht. verletzlich, hatte Angst bei Harn- oder Stuhlentleerung, zugleich aber Erek-
tionen. Letztere waren auch bei Harndrang vorhanden, wurden auch künstlich er-
zeugt. Alle Worte bekamen eine U-Endung, die auf das Wort Lulu, der kindlichen
Bezeichnnng für Urinieren, zurückzuführen ist und sich auf den Harn oder den Penis
bezieht. Suggestion ist nur bei einigen Punkten zwingend auszuschliessen. Das
Verständnis des Falles ist nur durch Einfühlung möglich. Der Erfolg der Analyse
war Verschwinden der abnormen Entleerung, Verschwinden des Eigensinns. Es ist
daran zu erinnern, dass Freud Ordentlichkeit, Sparsamkeit und Kigensinn auf Anal-
erotik zurückführt. Vortragender schliesst sich dem nicht am, weil der genetische
Zusammenhang nicht nachgewiesen ist, ebensowenig der Urethralerotik Sadger's.
Die Analyse von enuretischen Kindern ergab, dass der Reiz zum Harnlassen und
Defüzieren Erektionen hervorruft, und dass auch beide Funktionen als direkte Reize
wirken. Die allgemeine Steigerung der Erregbarkeit des Nervensystems in diesen
Füllen ist durch das Facialisphänomen erwiesen. Somatische Erscheinungen führen
zu Lustempfindungen, die sexuelle Erregung wird aber durch den Ansstaffekt aus-
gelóst, und so entsteht bei den nervósen Kindern der Affekt der Angstlust, in dem
ein anzenehmes und unangenehmes Gefühl zugleich vorhanden sind. So hat Vor-
iragender zweimal Pollutionen bei Schularbeiten beobachtet. Vielleicht wird die
Angstlust dureh Widerstreben gesucht, indem die Strafe Lust erzeugt, aher auch
Angst. Die Angstlust steht also in Beziehung zum Masochismus. Wird die Angst-
lust nicht aufgegeben, so entwickelt sich der passive Eigensinn, dem jede Ab-
schliessungsreaktion fehlt, der auch oft mit dem reaktiven Eigensinn kombiniert ist:
Defükationsanomalien finden sich dabei hüufig. Die Angstlust steht auch in Be-
ziehung zur Freude an gefährlichem Sport und Hasardspielen. Der Eigensinn hørt
im späteren Leben auf, die Angstlust wird ersetzt, Die Annahme Adler's von der
Wichtigkeit, der dem Zweifel an der Geschlechtsrolle, der Lust an dem Kleinsein etc.S.
222 Kongressberichte.
zukommt, teilt Vortragender nicht. Diese Typen können alle bei verschiedenen
Charakteren zukommen, Der eigensinnige Charakter ist nur nach dynamischen
Prinzipien aufzufassen,Hr. Schrecker (Wien): Über erste Kindheitserinnerungen (erscheint
in extenso in dieser Zeitschrift).Diskussion zu den Vorträgen des Hr. Adler, v. Hattingberg, Schrecker.
Hr. v. Hattingberg (München) bemerkt, dass dıe Ausführungen Adler’s
zum Teil passen mögen, ihre Erklärungen seien aber rein intellektuell; er könne
nicht zugeben, dass die beobachteten Erscheinungen bloss einen Punkt in der Lebens-
linie vorstellen und nur pro-, beziehungsweise retrospektive Bedeutung hätten,
Er finde die Denkweise Adler's nicht exakt und warne davor, Verschiedenes in
den Lebensplan hineinzulegen, Er fragt, ob nach Adler's Ansicht Tieren ein
„Lebensplan* zukomme, und warnt vor der Exklusivität der Lehre Adler's.Hr. Bleuler (Ziirich) erhebt Einspruch gegen die Verwertung des Insuffizienz-
gefühles und meint, dass auch andere Motive beim Kind vorhanden sind, die durchaus_ nicht unbewusst bleiben müssen, und warnt vor jeder Übertreibung.
Hr. Neuer (Wien) bemerkt, die Åusserung v. Hattingberg's, dass Adler's
Auffassung eine rein intellektualistische sei, hitte er nicht hinreichend gestützt.
Was das Verhältnis von Phänomen und Lebenslinie betreffe, so sei zu konstatieren,
dass Phünomenologie mit Naturwissenschaft nicht identisch sei.Hr. Furtmüller (Wien) führt aus, der von v. Hattingberg vorgebrachte
Einwand des rein intellektuellen Charakters der Ausführungen von Adler sei wohl
begründet, doch sei dieser Kindruck bloss durch die Form bedingt, in der Adler
seine Gedanken vorgebracht habe. Der Grundcharakter des A dler'schen Systems
Sei ein rein voluntaristischer, wie aus der hohen Bewertung der Zielstrebigkeit
hervorgehe. Das Wort Lebensplan sci nur ein Ausdruck für die Gesamtheit der
Strebungen, auch wenn ihuen kein Gedanke zugrunde liege, sei nur eine Formel.
Auf Exaktheit verzichte er, für die individualpsychologische Forschung wäre es
nachteilig, wenn sie in eine Scheinexaktheit verfiele. Es wäre fiir sie ebenso ver-
hängnisvoll, wie dieser Fehler für die Fre ud’schen Schriften verhiingnisvoll wurde.
Gerade das Tendieren auf ein Ziel ist ein Zeichen fiir Exaktheit. Fir die Tier-
psychologie sei die Auffassung A dler's von grosser Wichtigkeit. Der Widerstand,
den die A dler'sche Theorie finde, sei durch die prinzipielle Unmöglichkeit, Unge-
wohntes in sich nachzuschaffen, bedingt.Hr. v. Hattingberg (München) wendet sich gegen die Ausschliesslichkeit
des Adler'schen Systems, das auch nicht den Stein der Weisen gefunden hätte.”Hr. Frank (Zürich) gibt zu, dass wohl für einen Teil der Fülle die A dler-
sche Auffassung richtig ist; das berechtige aber nicht zur Exklusivität,Hr. Fresehls (Wien) vertritt die Anschauung, dass in der Psychologie
nur eine einzige Theorie, wie sie die Adler'sche sei, die eine einheitliche Kon-
zepiion für dieses ganze Wissensgebiet vorstelle. Freilich bleibe ein Rest für immer
unerklirt.Er schätze an dem System Adler’s die Einheitlichkeit und Durchführung des
teleologischen Gedankens.
Hr. Feri (Wien) bemerkt, dass in der exaktesten Wissenschaft, in der theo-retischen Astronomie, das Auskommen mit dem einzigen Prinzip der Newton-
schen Gravitationslehre nicht möglich sei, und glaubt, dass sich ein solches Prinzip
in der viel komplexeren Psychologie nicht werde durchführen lassen. Die Be-
merkung, dass das von dem Vorredner von vornherein ein Rest der Probleme als
unlósbar bezeichnet wurde, sei charakteristisch. Nach dem Ignoramus komme dasS.
Kongressberichte. 223
Ignorabimus, und welche politische Partei an dem Ignorabimus interessiert sei, sei
woblbekannt. Redner fragt Hr. Schrecker, was er unter Intuition verstehe,Hr. Schrecker (Wien) antwortet, dass Intuition das Erfassen der Seele
ohne Tätigkeit des Verstandes sei.Hr. у. Hattingberg (München) ist der Anschauung, dass das Hereinziehen
von politischen und Weltanschauungsfragen gar nicht notwendig und auch nicht
forderlich sei.Hr. Feri (Wien) führt aus, dass sich aus der Geschichte der Wissenschaft
beweisen lasse, dass die als funtamental bezeichneten Prinzipien quasi in der Luft
liegen, besonders leicht sei das hinsichtlich des Gravitationsprinzips und der Trans-
mutationslehre der Organismen zu zeigen. So erscheine denn ihm auch der Freudis-
mus als eine Manifestation desselben Prinzips, das mache, dass in der französischen
Literatur auf den Veristen Zola der Mystiker Maeterlinck folge, in der deutschen
Literatur auf die Weber von Hauptmann die Werke von Johannes Schlaf
und Paul Scheerbart, in der Zoologie auf die Vogt-Haeckel'sche Richtung
der Vitalismus von Schneider, Wolff und Driesch. Er verweise darauf, dass
gerade die Bekämpfung der Teleologie einen der wichtigsten Programmpunkte der
Vogt-Haeckel’schen Richtung war, und dass gerade das Betonen der Teleologie
für die hier betretene Richtung charakteristisch sei. Er sei nicht geneigt, es einem
Zufall zuzuschreiben, dass das Emporkommen mächtiger politischer reaktionårer
Parteien und der Psychoanalyse in eine und dieselbe Zeit falle und wegen des Vor-
wiegens teleologischer Momente halte er die ganze Psychoanalyse fiir ein grosses
Unglück.Hr. R anscbberg (Budapest) spricht sich gegen die Exklusivität der Adler-
schen Lehre aus.Hr. Adler (Wien) erklärt, dass das von ibm aufgestellte Schema keine
ausschliessliche Geltung beanspruche. Das, was erlernbar sei, wollte er behandeln,
im übrigen handle es sich beim Erfassen des Lebensplans eines Individuums um
eine künstlerische Anschauung, Ihm handle es sich um die Erkenntnis des Ge-
meinsamen in verschiedenen Phiinomenen; Zweifel lasse er sich fiir spiiter. Der
hohe Wert einer nicht mystischen Teleologie sei für ihn nicht weiter fraglich. Er
glaube wohl, dass auch bei einem Tier ein Lebensplan bestehen könne, hauptsächlich
wegen der Zielsicherheit der Tiere. Er verweise auf die enge Zusammengehčrigkeit
z. B. der Katzenpfote und ihrer Funktion, sowie überhaupt der Form des Organs
und seiner Verrichtung. Gegenüber Bieuler bemerke er, dass nur das bewusst
werde, was das Individuum zur Realisierung seines Lebeneplans brauche. Lebens-
plan und Zielstrebigkeit seien identisch.Hr. Wexberg (Wien) bemerkt, dass die intuitive Psychologie zu Resultaten
führe, die eine Aufklirung von Fragen bringo, die die Physiologie schon deshalb,
weil es eine intuitive Physiologie nicht gebe, unmöglich lösen könne. Die Lust
bei der Exkretion unterstreiche diese a priori unbetonten Vorgünge und durch Ver-
drüngung entstehe die Angstlust; die Exkretion sei ein Vorgang, dessen Empfindung
sexualühnlichen Charakter habe. Die Beziehung zwischen Angstlust und Maso-
chismus sei belanglos. In erster Linie komme für den Masochismus das Minder-
wertigkeitsgeffihl in Betracht.Hr. Strasser (Zürich) weist auf den analerotischen Ursprung von Trotz-
handlungen hin, sowie auf den analerotischen Ursprung von Zwangsgedanken
beim Beten.Hr. v. Hattin gberg (München) weist zur Entstehung der Beziehung zwischen
Angstlust durch Erregung sexualühnlicher Empfindungen und Exkretionsvorgüngen
auf die Nähe der diesbezüglichen Zentren im untersten Rückenmarksabschnitt hin.
Die Zusammengehórigkeit sei nicht rein psychisch begründet.S.
224 Kongressberichte.
III. Sitzung 20. September 1913 vormittag.
Fortsetzung der Diskussion über das Thema: Verdrängung und Konversion,
besonders über die Fragen: Was ist die Wirkung der Verdrüugung, was ist unter
Widerstand gegen das Wiederbewusstwerden zu verstehen, was ist Wirkung der
patbogenen Verdrängung?Hr. Bleuler (Zürich) führt aus, dass man die Wirkung der pathogenen Ver-
drängung aus ihren Wirkungen ersehen känne und zwar, wenn Symptome zum Vor-
schein kommen, welche Symptome sich zeigen. Neurosen zeigen oft anfallsweises
Auftreten, Tics etc. Die Verdrängung wird pathogen, wenn es sich um abnorme
Personen handelt, z. B. bei latenter Schizophrenie. Nicht durch Mechanismen wird
sie pathogen, sondern auf Grund von Disposition.Hr. v. Hattingberg (München) bemerkt, dass sich der Widerstand darin
zeige, dass sich der Patient gegen die Analyse wehre, so z. B. überträgt der Patient
seinen Vaterkomplex auf den Analysator. Der Widerstand stellt sich ein, wenn dem
Patienten nichts einfällt, Die unvollkommene Verdrängung ist pathogen, ebenso
wirken aber auch total vergessene Szenen aus der Kindheit, indem sie die Haupt-
wirkung von Sexualwiinschen z. В. verstärkt. Auch die Annahme ist begründet,
dass unvollkommen verdringte Wünsche pathogen sind, so findet sie sich bei
homosexuellen Ehemännern, die an Bildern Befriedigung finden.Hr. Stekel (Wien) findet, dass die Diskussion sehr unerquicklich ist. Die
Frage des Widerstandes ist kompliziert; im wesentlichen handelt es sich um ein
Ringen von Arzt und Patienten um die Herrschaft. Schon in den ersten Träumen
der Analyse zeigt sich der Widerstand, dessen einfache Tendenz dahin geht, die Krank-
heit zu behaupten. Der Neurotiker zieht sich ın seine Krankheit wie in ein Schnecken-
gehäuse zurück. Es wäre empfehlenswert, von der Diskussion der Widerstandsfrage
abzusehen.Hr. Bleuler (Zürich) möchte die Diskussion nicht abgebrochen sehen. Es
wäre nach allem, was in der Diskussion gesagt wurde, die Verdrängung ein Produkt
des Krankheitswillens. Es könne dies aber nicht die einzige Möglichkeit sein, z. B.
bei einem Widerspruch gegen das ethische Gefühl komme das in Betracht. Er habe
diesbezüglich eine eigene Meinung. Ebenso wie Affekte einander unterdrücken
können, könnte dies bei Ideen stattfinden, Ambivalente Ideen würden verdrängt,
sie könnten nicht aufkommen. Später würden auch die zugehörigen Affekte
verdrängt.Hr. v. Hattingberg (München) bemerkt nachträglich noch, dass auch voll-
kommen Bewusstes pathogen wirken könne, so habe in einem von ihm beobachteten
Fall von Hysterie die Patientin einen Koitus mit dem Bruder vollzogen, war sich
aber jederzeit dieser Tatsache vollkommen bewusst. Ks wurden ihr auch ihre
alten sexuellen Wünsche gegen den Bruder zum Bewusstsein gebracht, Die Er-
krankung bestand trotz des klaren Bewusstseins aller dieser Kreignisse fort.Hr. Stekel (Wien) bemerkt, dass bei Hysterie ein Trauma den Wunsch
nach einer Wiederholung erweckt und die Patienten diesen Wunsch abwehren wollen.
Bei diesem Falle sei das besonders deutlich.Hr. v. Hattingberg (München) erwidert, dass seiner Patientin alles bewusst
war. Er sehe eine Analogie dieses Zustandes mit der posthypnotischen Suggestion
darin, dass sich die Patienten nicht wehren können.Hr. Tauszk (Wien) führt aus, dass die in der pothypnotischen Suggestion
ausgeführten Handlungen hinterher rationalisiert werden. Das in einem hypnoiden
Zustand Erlebte ist mit dem Kontinuum-lch assoziiert und beherrscht durch
Assoziationen alles. Er verweise darauf, dass, wie Semon gezeigt hat, allesS.
Kongressberichte. - 225
registiert werde, und so hänge auch das im Hypnoid Erlebte mit den gleichzeitigen
Affekten zusammen.Hr. Feri (Wien) bemerkt, dass er den Eindruck habe, dass die Konflikte
Hysterischer mit dem Kampf zwischen Determinismus und Indeterminismus weit-
gehende Åhnlichkeit haben.Hr. Moll (Berlin) konstatiert, dass die posthypnotische Suggestion voll-
kommen bewusst sein kann.Hr. Winkler (Wien) demonstriert die Handschrift eines Mannes, dem
hypnotisch die Verwendung des Buchstabens R verboten wurde. Ks sei deutlich,
dass er den Buchstaben nicht schreiben wolle.Hr. St ekel (Wien) bemerkt, dass in einem der von ihm gestern erwähnten
Fülle fortwährend das Bewusstsein und das Tagtriumen wechselte. Es war sozusagen
das geistige Gesichtsfeld nicht konzentriert, wie es de norma ist; es bestand ein
fortwührender Wechsel im Fokus des Bewusstseins. Die Erziehung des Kranken
verfolgt das Ziel, ihn zu offenem und klarem Denken zu bringen und den traumartigen
Zuständen ein Ende zu machen.Hr. Frank (Zürich) bemerkt, die ganze Debatte und die Ausführungen
Winkler's zeigen, wie notwendig ein Unterricht in medizinischer Psychologie sei.
Aufgabe der Diskussion sei es, Klarheit zu schaffen, z. B. über den Begriff des
Widerstandes; dazu trage es aber nicht bei, wenn Widerstand gegen den Arzt und
gegen das Wiederbewusstwerden zusammengeworfen werden. Das Unbewusstsein
habe eine Art eigenen Bewusstseins, es beabsichtige krank zu sein; das sei nichts
Neues. Es sei aber in den diesbezüglichen Publikationen grosse Vorsicht geboten,
weil das Publikum wegen des Sexuellen sich sehr für diese Dinge interessiere. Für
das Verstündnis der Erkrankung sei das einzelne halluzinatorische Erlebnis wertlos,
во lange nicht das Ganze vom Patienten gebracht werde, wie Redner Hr. v. Hatting-
berg gegenüber bemerke. Ein Erlebnis muss gründlich durchgesprochen werden,
wenn es abreagiert werden soll, es muss mit dem früher Erlebten verbunden sein.
Die Analyse im Halbschlaf, wie Redner sie übe, zeige, dass es eine Akkumulation
der Affekte eben gebe, auch wenn es die Exploranden nicht zugeben wollen.Hr. Schreck er (Wien) erklärt die von den Psychologen gegebene Affekt-
definition für unbrauchbar. Deren ganzes Verhalten erinnere ihn an die Art, wie
die Schildbürger das Sonnenlicht fangen wollten.Hr. Stekel (Wien) will jetzt nur von der Sexualverdrüngung sprechen, ob-
wohl es auch Verdrängung nicht sexueller Affekte gebe, so z. B. einen sich akku-
mulierenden Wertaffekt, der bei der Analyse so stark werden kann, dass man dem
Patienten etwas zum Zerstóren geben muss. Dass es nur Vorstellungen mit Affekten
gebe, sei richtig, wenn man die Affekte und die Affektivitát Bleuler's identifiziere.
Unter dieser Voraussetzung müsse man vom Zurückhalten des Affektes sprechen.
Beim Widerstreit von Affekten gehe der schwächere-nicht etwa verloren, sondern
er werde verschoben, was nur dadurch möglich sei, dass es eine Akkumulation gebe.
Die Affekte seien mit dem Erlebnis und mit der blossen Vorstellung nicht gleich
fest verbunden.Hr. Klages (München) führt aus, dass verdrüngt und unbewusst, unterdrückt
und beherrscht nicht identisch seien. Nur etwas Bewusstes könne verdrängt werden.
Ein Erlebnis allein wirke erfahrungsgemiiss nicht pathogen. Die von Hr. v. Hatting
berg mitgeteillen Einzelheiten zeigen nur, dass es keine Ruhe gibt, solange nicht
das Unbewusste ausgeräumt ist, Im Unbewussten wirken stark affektbesetzte
Determinanten. Ein starkes Erlebnis wird im Tagtraum oder im Traum ekphoriert,
wie die Analyse im Halbschlaf zeige. In jedem Moment dieses Zustandes würden
zahllose Determinantenketten angeregt, besonders bei Künstlern, Hinsichtlich derZentralblatt für Psychoanalyse IV*/, 15
S.
996 Kongressberichte.
Suggestion sei er der Anschauung, dass die posthypnotische Suggestion bewusst
oder nicht bewusst sein könne, die Autosuggestion nur unbewusst,Hr. Stekel (Wien): Zur Psychologie des Fetischismus り .
Tr. Frank (Zürich) hat mehrere Fille analysiert und würde auf Grund seiner
Erfahrung einem Fetischisten nie die Ehe empfehlen. Die vou Hr. Stekel mit-
geteilten Fille sind nicht rein, sondern mit Neurose kombiniert, der zweite mit
Dementia praecox. Ein einziges Erlebnis wirke nie pathogen, es bilde nur den
Kern für spätere Determinanten. Die Fetischisten sind alle Neurotiker oder Angst-
neurotiker. Der Uberbau des Religiósen gehört nicht zum Fetischismus. Oft sind
Fetischisten hisexuell, doch können normale, homosexuelle und fetischistische Phasen
einander ablösen. Die Deutung des Fetischismus als Christusneurose sei sehr gewagt.Hr. Moll (Berlin) findet, dass sich österreichische und deutsche Fetischisten
offenbar sehr unterscheiden, Ein wichtiger ätiologischer Faktor sei auch in der
Phantasie gegeben, und darum verbiete er den Patienten ihre diesheziiglichen Phan-
tasien. Die normale Befriedigung sei zu erstreben, eventuell durch Bilder. Die von
Stekel mitgeteilten Fille flohen das Weib, seine eigenen nicht. Kine angeborene
Störung sei der Fetischismus gewiss nicht. Fetischisten seien polygam, aber auch
Normale seien dies oft genug. Viele gäbe es, die sich in das Sexualgebiet hinein-
fühlen, so z. B. Mädchen, die Männerkloider tragen, wollen es ihren Freunden
gleichtun. Hinsichtlich der Ehefrage schliesse er sich Frank an. Jedenfalls sei
eine vorhergegangene Aufklärung der Frau nötig. Von Christusneurose habe er bei
seinen Patienten nichts finden können, speziell nicht bei fetischistischen Frauen.Hr. Winkler (Wien) bemerkt, einen polygamen Musiker zu kennen, der
wegen seines eigentiimlichen Fetischismus als ,Federmaun in Wien bekannt sei.
Von Christusneurose sei an ihm nichts zu merken.Hr. Stekel: Schlusswort zur Diskussion über den Fetischismus:
Mit Frank werde er mich wohl kaum je verständigen können. Er spreche
noch die Sprache der ersten Publikation von Breuer-Freud. Die weiteren Fort-
schritte der Psychoanalyse beriicksichtige er eben gar nicht. Seine Heilungen seien
kein Beweis fiir die Richtigkeit seiner Methode. Es heile nicht die Methode, sondern
der Arzt, und bei Neurosen hitten die seltsamsten Prozeduren die wunderbarsten
Heilerfolge.Er wundere sich nicht, dass seine Ausführungen so wenig Verständnis ge-
funden hätten. Seine Forschungen seien eben den anderen weit voraus. Er müsse
sich aber gegen Moll, der ihm den Vorwurf der Leichtfertigkeit mache, strenge ver-
wahren. Wenn er einem Fetischisten zur Ehe rate, so sei er des Erfolges schon
sicher. Er gehe aber so vor, dass er sich die Auserwühlte kommen lasse 一 im
Einverstindnisse mit dem Kranken — und ihr von der Abnormität des Bewerbers
Mitteilung mache. Sie habe dann die freie Wahl. In einigen Fällen habe er wirklich
überraschende Resultate, allerdings nach der Behandlung gesehen. Begreiflich sei es
bei dem komplizierten Baue dieser Neurosen, dass man mit der Hypnose keinen
Erfolg erzielen könne. Die Hypnose heile nur ein Symptom, nie die Neurose als
solche. Er hoffe aber, dass seine Anregungen auf fruchtbaren Boden fallen, und die
weiteren Forschungen seine Funde bestätigen werden.Hr. Frank (Zürich): Über den Schlaf und Schlafstörungen.
Vortragender will über die Vorgänge bei Schlafstörungen sprechen, die bei
Neurosen, speziell Psychoneurosen vorkommen. Bei diesen stellen sich oft Unruhe-
und Angstgefühle ein, wenn Patient nur an den Schlaf denkt, und jede Störung der1) Erscheint in extenso in dieser Zeitschrift.
S.
Kongressberichte. 227
dem Schlaf vorausgehenden, gewohnheitsmässig erfolgenden Handlungen stört die
Schlafsuggestion. Auch der Erwartungsaffekt kann die Schlafsuggestion stören.
Diese Tatsache findet sich auch bei Normalen, bei Zwangsneurotikern und anderen
Neurotikern kann es zu heftigen Affektausbrüchen kommen, wenn gewisse Hand-
lungen nicht vollzogen werden können. Diese Angst- und Befürchtungsgefühle be-
ziehen sich oft auf Träume oder das Wiedererwachen. Im Einschlafen können sich
Affektwirkungen aus dem Unbewussten hervordrängen, die Aufmerksamkeit erregen
und so das Einschlafen hindern. Besonders die Sexualverdrängung ist als Ursache
plötzlich auftauchender, als Schlafstörung wirkender Affekte anzusehen; aber auch
die Ermüdung und Uberanstrengung kann zu solchen Störungen durch Auftauchen
affektbetonter Vorstellungen führen. Neurotiker liegen oft stundenlang in ober-
fláchlichem Schlafe, in dem sich angst- und unlustbetonte Vorstellungen aus den
verschiedensten Lebensperioden jagen. Das Traumleben dieser Patienten ist zu leb-
haft, der Schlaf darum nicht erquickend, sie sind am Morgen müde. Im Traum
spielen Affektwirkungen aus der Jugend eine besonders auffallende Rolle. Die Ana-
lyse im Halbschlaf zeigt auch die ausschlaggebende Wichtigkeit der Gefühlsbetonung.
Es zeigt sich aber auch die durch die Spannung des verdrängten Affektes bedingte
Schlafstörung auf bestimmte Zeiten, d. h. bestimmte Schlaftiefe eingestellt, zu welchen
Stunden immer die gleichen Träume sich einstellen. Dahin gehört der Pavor noc-
turnus. Das Zusammenschrecken im Halbschlaf ist durch angstbetonte Szenen be-
dingt, nach deren Abreagieren das Zusammenschrecken bzw. der Pavor nocturnus
aufhört. Ks zeigt sich dabei immer, dass eine Anzahl von Ereignissen nötig ist,
um diese Phänomene entstehen zu lassen. Die bei Neurasthenikern typische Müdig-
keit nach dem Erwachen ist Folge einer intensiven Traumtätigkeit, wie sie sich auch
bei depressiven Zuständen, besonders bei manisch-depressivem Irresein findet. Ver-
stimmungen, selbst mit Selbstmordtrieb können dabei zustande kommen. Diese Stim-
mungen können im Wachzustand wieder verschwinden oder auch assoziativ durch
harmlose Erlebnisse ausglóst werden. Das Erwachen aus dem Schlaf ist durch die Reize
unserer Sinne bedingt, die die oberbewusste Aufmerksamkeit wieder zu erregen ver-
mag. Der Schlaf ist das Zurücktreten der Aufmerksamkeit und der Zustand der
Affektruhe. Ein zu weit gehendes Ermüdungsgefühl kann auch zur Schlafstörung
führen. Das Einschlafen verhält sich zum Schlaf, wie die Dämmerung zur Nacht.
Hr. Winkler (Wien) weist auf den Zusammenhang von Blutdruckabfall und
Einschlafen, Blutdrucksteigerung und Aufwachen hin, sowie auf den Zusammenhang
von Affekten und Blutdrucksteigerung. Ermüdung führe je nach ihrer Stärke zur
Blutdrucksteigerung oder Blutdrucksenkung. Der Neurastheniker könne aus anderen
Gründen nicht einschlafen wie der Psychoneurotiker. Oft genug kamen somatische
Ursachen in Betracht, 2. B. das Ermüdungsgefühl. Auch könne er nicht zugeben,
dass alle Menschen träumen, er habe in den letzten Jahren gewiss nicht geträumt.
Hr. Frank (Zürich) erwidert, dass man ebensogut wie die Blutdruckver-
änderungen auch die Temperaturschwankungen als Ursachen des Schlafes bezeichnenkönne. Zur Traumbeobachtung müsse man geschult sein, sonst könne man nichts
davon beobachten. Redner erklärt sich ausserstande, mit Sicherheit Psychoneurosen
und Neurasthenie zu trennen.Hr. L. Klages (München): Zur Theorie und Symptomatologie des Willens.
Vortragender will eine prinzipielle Frage besprechen, die ihn sehr interessiere,
da er sich schon seit langem mit dem Charakterproblem und dem Ausdruck des Charakters
z. B. in der Schrift beschäftige. Das Ich ist der Ausgangspunkt der inneren oder
äusseren Bewegungen, Alle Theorien, die sich mit diesem Thema befassen, weisen
eine Lücke auf, indem sie nur eine Seite dieses Bestandes würdigten. Bei der all-15%
S.
228 Kongressberichte.
gemein verbreiteten, mit anatomisch-physiologischer Denkweise durchsetzten An-
schauung ist das Willenserlebnis eine blosse Begleiterscheinung. Fasst man den
Willen als bewegende Kraft auf, so kann man ihn mit allen treibenden Kräften
identifizieren, wie das Wundt und Schopenhauer gemacht haben. Der Willens-
affekt schliesst dann mit einer pantomimischen Bewegung ab. Eine zweite Auffassung
des Selbsterlebnisses ist dadurch ermöglicht, wenn das Ich als unbewegt betrachtet
wird. Die Selbstbesinnung bestätigt diese Auffassung, indem sie ergibt, dass der
Wille unbewegt ist. Die Sprache zunächst bezeichnet den Willen als hart, unbeug-
sam, eisern etc., lauter Ausdrücke, die mit Bewegung nichts zu tun haben. Auch die
naive Volksauffassung bestätigt diese Ansicht, indem sie Gefühls- und Willens-
menschen als Gegensätze aufstellt, von Gemiits-, nicht aber von Willensbewegungen
spricht. Dem Willen kommt eine dirigierende Funktion zu; ebenso wie das Un-
bewusste die Gedanken dirigiert, ohne selbst mit dem Denken identisch zu sein,
ebenso veranlasst der Wille Bewegungen, ohne selbst Bewegung zu sein. Es ist
hier daran zu erinnern, dass die alten Philosophen im Willen den Welturgrund
sahen, indem sie einen Teil ihres Innern nach aussen projizierten. In diesem Sinne
spricht Aristoteles von dem oorow עקסעוא åxlvnrov. Die Bewegung ist Über-
tragung, der Zweck ist ruhend. Ein allgemeines Erfahrungsgesetz sagt uns, dass
der Willensakt weiterhin auf reflektorische Bewegungen hemmend wirkt (z. B. das
Niesen) aber auch nicht reflektorische kónnen durch den Willensakt erheblich ge-
stort werden, so z. B. erklärt sich die Verlegenheit, die junge Leute in Gesellschaft
befüllt, wo sie sich lebhaft und amüsiert geben wollen. Aus allen diesen Einzel-
heiten folgt der Schluss: der Wille ist nicht das Massgebende bei der Willkürbe-
wegung, sondern er stört, auf den Ablauf der Bewegung gerichtet, die Bewegung
selbst. Das Wort Willenskraft, das den Willen als Bewegungsursache aufzufasseu
Scheint, widerlegt diese Auffassung nicht; Bewegungsursachen sind die Triebe, die
im Innern wirkend, zwar des Objekt wechseln, aber auf eine bestimmte Kategorie
eingestellt sind. Das Ziel ist im Trieb selbst enthalten, und nur deshalb kann es
sich erfüllen. Das Wollen kann sich auf dasselbe Objekt erstrecken, kann immer
das gleiche Ziel haben, der Wille ist frei von Trieben, er ist vom Trieb qualitativ
verschieden. Er kann, soweit die Denkbarkeit reicht, jedes Ziel verfolgen, die Triebe
sind a priori gerichtet. Was nun die Meinung betrifft, dass der Wille sich aus dem
Bewusstsein entwickelt, sei an die Unterscheidung erinnert, die sich in der Philo-
sophie der Griechen findet, an die Verschiedenheit von voüs za$nruzós und voös
mortis, von denen ersterer den Trieben, letzterer dem Willen entspricht. Pathische
Menschen sind sensibel, sie produzieren fortwührend Gefühle, für sie ist Raum, Licht,
Dunkelheit, Kälte, Wärme nicht immer dasselbe; die Differenz ist im Gefühl gelegen.
Der Unterschied von Trieb und Willen ist durch den geistigen Akt gegeben, der die
Qualitäten abspaltet und dadurch das Wollen von der Qualität des Zieles unabhängig
macht. Beim Übergang vom Trieb zum Wollen bleibt nur das Moment der Energie
übrig, der Drang, Hindernisse zu überwinden. Aus den Trieben sind Interessen ge-
worden. Der Wille ist einer bewegenden Kraft ähnlich, aber er ist keine, ebenso
wie das Apperzipieren eines Objektes vom Empfinden verschieden ist. Damit ein
Gegenstand werde, muss ein instantaner Akt stattfinden. Subjekt und Welt der
Objekte werden so getrennt, Derselbe geistige Akt des Erfassens der Wirklichkeit
trennt die Triebsphåre und die Willenssphüre. In der Welt des Erfassens gibt es
Ziele, nicht eine Aufnahme von Bildern. Derselbe geistige Akt schafft die spezifische
Funktion dieses Zustandes, das Urteilsvermógen. Das Wollen ist auf Gegenstünde
gerichtet, ist kein fluktuierender Prozess, sondern auf begreifliche Punkte eingestellt.
Das Wollen ist gradlinig. Auch unsere Wissenschaft ist auf das Wollen begründet,
das einen Abstraktionsprozess vorstellt und auf die geseizmüssige Welt sich bezieht.S.
Kongressberichte. 229
Aus dieser Eigenschaft begreift man das Wollen als Regulator der unwillkiirlichen
Bewegungen, man begreift auch die Zusammengehórigkeit von Willen und Ordnung
in charakterologischer Hinsicht. In letzerer Hinsicht ist von Wichtigkeit die Ab-
spaltbarkeit der Triebe, die sonst ein Zweckstreben unmöglich machen würden. Das
Triebleben verläuft rhythmisch, das Willensleben regelmässig; der Rhythmus ist die
Wiederkehr von etwas Ahnlichem, doch muss die Eurhythmie unterbrochen sein,
weil sonst der Parademarsch in seiner absoluten Regelmiissigkeit ein Ideal vorstellte,
was gewiss niemand behaupten wird. Weiterhin ist das Hervortretende des Moto-
rischen von Wichtigkeit im Gegensatz zum Sensorischen, weil nur so das System
realisiert werden kann. Schliesslich muss eine Monarchie der Interessen vorhanden
sein, weil sonst das Bestehen von mebreren Interessen eine Willensentscheidung un-
möglich macht. Willensfähigkeit und Willensstärke darf man nicht verwechseln.
Unsere Zeit hat nur den Willen, auch der Neurotiker hat ihn, aber es fehlt ihm an
Willensstárke. Vortragender hat an den Schreibbewegungen, einer besonderen Art
von Ausdrucksbewegungen, die Willenstypen studiert. Die wichtigsten Ergebnisse
dieser Studien sind, dass pathische Menschen rhythmiseh, Willensmenschen regel-
miissig schreiben, dass Grösse der einzelnen Züge, ihre Geradlinigkeit von Bedeutung
sind. Vortragender wird an Hand von Tichtbildern die genannten Phänomene demon-
strieren, sowie die charakteristischen Züge in der Schrift bei leichtem, bei schwerem
Wollen, bei vollem und leerem Wollen (welch letzteres bei Hysterie und Migensinnbesonders vorkommt), bei geistigem (theoretischem, künstlerischem) und stofflichem
(praktischem) Wollen.IV. Sitzung.
Hr. Klages (Miinchen): Demonstration von Lichtbildern.
Hr. Winkler (Wien): Uber Mitempfindungen.
Mit Beziehung auf Untersuchungen, die Bleuler vor ca. 30 Jahren veröffentlicht
hat, berichtet Vortragender über eine „sensorielle* Theorie der Mitempfindungen,
み B. der Audition colorée, die im wesentlichen besagt, dass die Mitempfindungen
dadurch entstehen, dass von dem z. B. durch Irradiation erregten Sinneszentrum der
Hirnrinde ein Reiz retrograd zu dem Sinnesorgan verlaufe, dort einen Reiz setze,
der dann als Photisma empfunden wiirde. Die Retina empfange nicht nur Licht-
reize, sondern anch Bewegungsreize, ebenso die anderen Sinnesorgane. Blutdruck-
steigerung bewirke immer eine Unlustempfindung.Hr. Feri (Wien) bemerkt, dass Blutdrucksenkung, sowie Temperaturabfall von
den sedativ wirkenden Nervinis erzeugt wiirde, ebenso wie Erregung und Temperatur-
und Blutdrucksteigerung von anderen autagonistiseh wirkenden Präparaten. Es wäre
viel passender, zu sagen, dass die zum Schlaf führenden Veränderungen auch zu Blut.
druck- und Temperatursenkungen führen, als die Blutdruckveränderungen als Ursache
des Schlafes zu proklamieren, Auch den Zusammenhang von Blutdrucksteigerung
und Unlustgefühlen bestreite er, denn nicht bei allen Menschen sei geistige Tätigkeit,
die immer mit Blutdrucksteigerung einhergehe, mit Unlustgefúhlen verbunden. Er
frage noch, was Vortragender unter Bewegungsreizen der Retina verstanden habe.Hr. Niessl v. Mayendorf (Leipzig) glaubt, dass die Mitempfindungen durch
Uberspringen des Reizes in den subkortikalen Zentren zustande kommen. Das Mit-
wirken des Kortex sei dabei nicht unbedingt erforderlich.Hr. Feri (Wien) kann nicht glauben, dass die zum Teil höchst komplizierten
Musikphantome in subkortikalen Zentren entstehen können, und verweist darauf,
dass Winkler’s Theorie eine weder experimentell, noch klinisch gestützte Voraus-
setzung enthalte, nämlich die Fähigkeit der doppelsinnigen Erregungsleitung zen-
traler Fasern,S.
230 Kongressberichte.
Hr. Niessl v. Mayendorf (Leipzig) erwidert, seine Auffassung sei durch
einen eigenen Fall und durch Mitteilungen von Henschen gestiitzt.Hr. Winkler (Wien) antwortet, dass Bewegungsreize der Retina eben Be-
wegungen der Zellen der Retina wären.Fr. Eppelbaum (Zürich): Uber das Assoziationsexperiment mit be-
sonderer Beriicksichtigung der Alkoholiker.Vortragende macht den Versuch, die Erfolge der Züricher Schule mit dem
Assoziationsexperiment in Hinsicht auf die Psychologie der Persönlichkeit zu dis-
kutieren, und zeigt, dass das Assoziationsexperiment fiir die gesamte Psyche mit
ihrer kontinuierlichen Aktivi nichts anderes als eine Einübung (das Mechanische),
eine Art mechanische Finfiigung in den Gesamtbau einer Persönlichkeit ist.Bei Idioten, Imbezillen und Epileptikern besteht eine abnorme Oberflichlichkeit
der Assoziationén, die im wesentlichen auf eine Verdeutlichung des Reizwortes
hinauslauft. Vortragende schien den Kranken ein Lehrer zu sein. Der Epileptiker
ist weiter differenziert als der Idiot. Sein Persünlichkeitsideal ist auch der Lehrer,
zur Sicherung seines Ideals geht er kompliziertere Wege. Die Dementia praecox
hat Bruchstücke von Ideen und Begriffen neben den eingeübten und eingelernten.
Die Persónlichkeit, die Lebensleitlinie macht die Komplexe klar. Der Schizophrene
entweicht der Realität und behauptet starr sein Endziel. Die Komplexreaktionen
sind Kunstgriffe, die von dem Lebensplan verlangt werden und eine Erhóhung des
Persónlichkeitsgefühls bezwecken. Den Kranken bleibe nichts übrig, als Stücke des
Lebenszieles auf Reizworte hin zu verraten. Bei Alkoholikern finden sich flache
Assoziationen vom Wiederholungstypus, die zum Teil wührend des Experimentes
entstehen, ebenso entstandene Wortzusammensetzungen, Definitionen, Fragen als
Reaktionen im Assoziationsexperiment. Bestimmend ist oft für die Assoziations-
weise der Wunsch, in die Freiheit zu gelangen. Die Komplexe (Brandstiftung etc.)
wirken, entgegen den Erwartungen, die man an die Arbeiten der Züricher Schule
anknüpfen kónnte, nicht. In seinen Assoziationen ist der Alkoholiker dem Gesunden
ähnlich. In der Kindheit erweist sich, der Alkoholiker reizbar, jåhzornig, doch ist
ihm sein Affekt nur Mittel zum Zweck, sowie dem nervósen Charakter. Neid, Bos-
heit, Egoismus, Aggressivitit auf der einen, Güte und Gehorsam auf der anderen
Seite stehen im Dienste seiner Zwecke, des Willens zur Macht. Der Alkohol be-
deutet nur eine Beseitigung der Hemmungen, die ihm entgegenstehen, trotz der
Wirklichkeit gegenüber; im Rausch wird der Willen zur Macht frei. Der Alkohol
steht im Dienst einer Fiktion und erhöht das Persänlichkeitsgefühl, das unter dem
Gefühl einer konstitutionellen Minderwertigkeit leidet, eine Auffassung, die Adler
zuerst vorgetragen habe und die sich auch durch die Versuche der Vortragenden als
richtig erwiesen habe.Hr. v. Hattingberg (München) fragt, ob sich Adler mit diesen Ausfüh-
rungen identifiziere.Hr. Adler (Wien) antwortet, dass er auf dem Gebiet der Assoziationslehre
nicht gearbeitet habe, aber die Ausführungen der Vortragenden für plausibel halte.Hr. v. Hattingberg (München) teilt spüttisch mit, wenn das so sei, werde
sich hoffentlich niemand daran stossen, dass er in der nüchsten Versammlung des
Vereins einen Vortrag halte über die Lebenslinie des Paralytikers und über die
progressive Paralyse als Kunstgriff zu deren Verwirklichung.Hr. Adler (Wien) bemerkt, dieser Scherz zeige deutlich, wie wenig Hr. v.
Hattingberg das Wesentliche erfasst hiitte.Hr. Feri fragt, ob Vortragender auch typische Alkoholpsychosen untersucht
hätte.Fr. Eppelbaum verneint.
S.
Kongressberichte. | 231
Hr. Strasser (Zürich): Nervöser Charakter, Disposition zur Trunksucht
und Erziehung,Was bis jetzt gegen den Alkoholismus getan wurde — und die grossen Erfolge
dieser Bewegung dürften wohl nicht in Frage kommen — ging wohl darum nicht
völlig auf den Grund, weil es auf der einseitigen Anschauung fusste, dass die
Trunksucht als ein in sich abgeschlossenes Krankheitsbild zu betrachten sei. Dabei
übersah man, dass die Trunksucht‘ ein Symptomenbild ist, welches von der konti-
nuierlichen Basis menschlichen Seelenlebens aus zu konstruieren ist und, weil es
auf solcher Basis ruht, muss es seine Vergangenheit und seine Zukunft, seine
intuitive Aktivität haben. Schon diese Erwägung dürfte dazu führen, dass
die Behandlung jugendlicher Alkoholiker in die Hände des Pädagogen gelegt werden
sollte, Aus welchen Kindern später Alkoholiker werden, kann nun freilich nicht
ohne weiteres im voraus bestimmbar sein. Aber die Krankengeschichten der
späteren Trinker zeigen uns, dass ihre Charakterzüge im Alter Verstärkungen der-
jenigen vor dem Alkoholmissbrauch, und als solche die nämlichen sind, wie die
eines neurotisch veranlagten, ja eines eigentlichen gesunden Kindes. Es zeigt sich
auch bei ihnen das auf organischer Minderwertigkeit beruhende Insuffizienzgefühl,
So litt ein hünenhaft gebauter Mann an einer Magendarmminderwertigkeit, kam sich
selbst unmännlich vor und wollte sich durch Trinken beweisen, dass er ein rechter
Mann sei. Er provozierte in der Trunkenheit einen Mann, musste dann revozieren,
betrank sich wieder zur Hebung seiner Stimmung und verfiel dann in Selbstmord-
gedanken, die seine Niederlage bemänteln sollten, im ganzen ist also die Tendenz
ersichtlich, das Persönlichkeitsgefühl durch Beseitigung des Minderwertigkeitsgefühls
zu erhöhen. Der Kampf darf nicht gegen den Alkoholismus gerichtet sein, sondern
gegen die Grundlage, die neurotische Disposition. Die Entfernung des Vaters ist
nicht alles. Der zum Alkoholismus Disponierte hat die Neigung, dieselben Kunst-
griffe zu verwenden, wie der Nenrotiker, beziehungsweise das neurotische Kind,
Der Erzieher muss das Kind intuitiv erfassen, da die Suggestion und dıe Analyse,
die einzigen noch möglichen Methoden nicht anwendbar sind, die Suggestion deshalb,
weil sie eine gewichtige Persönlichkeit erfordert, während bei der Erziehung der
Erzieher hinter seine Absicht zurücktreten soll, die Analyse deshalb, weil sie nicht
alle Zusammenhänge aufdeckt, ein Ding immer durch das erklärt, was es nicht ist.
Beide Verfahren wollen das kontinuierlich bewegte Seelenleben in Unbewegtes
überführen, um dann wieder den umgekehrten Weg zu gehen. Die Intuition ver-
meidet aber, dem Kinde die Weltanschauung des Erziehers aufzudrängen, die intellektuelle
Einfühlung ist der einzig gangbare Weg.Dieser Gedanke ist sowohl die Grundlage der Bergson’schen Philosophie,
wie, unabhängig von ihr, auf therapeutischem Gebiete, die Leitlinie der Charakter-
lehre, der individualpsychologischen Forschung Alfred Adler’s. Kann erst der
Pädagoge diesen Weg betreten und wird er sich in die Lebensziele des Kindes
hineinfühlen, vermag erst einmal der Erzieher so zu handeln, als ob er die betreffende
kindliche Konstitution selbst in sich trüge, und seine Aufgabe darin zu erkennen,
nicht den Mitmenschen, sondern den Menschen erziehen zu wollen, dann gelingt es
ihm, durch seine Mitarbeit die Umgestaltung des kindlichen Lebensplanes zu fördern,
und einem zur Trunksucht disponierten Kinde also die Möglichkeit zu nehmen, den
Alkohol ebenso, wie die anderen Ausdrucksformen der Neurose in der Zukunft als
Kunstgriff zu verwenden.Fr. Stricker (Wien) weist auf die Gefährlichkeit der Intuition hin.
Hr. Löwy (München) gibt den Wert der Intuition zu, warnt aber vor der
Einführung dieser Methode in die Lösung eines eminent sozialen Problems.S.
232 Kongressberichte.
Hr. Frank (Zürich) stellt fest, dass sich die Ausführungen von Hr. Strasser
nur auf bestimmte Typen von Alkoholikern bezogen haben.Hr. v. Hattingberg (München) bemerkt, dass der Vortrag Strasser's be-
weise, wie sehr er vorhin recht gehabt hiitte, auch die Paralysis progressiva als
Kunstgriff zu bezeichnen,Hr. Schrecker (Wien) bemerkt, Intuition und Intuition sei nicht dasselbe.
Der hohe Wert der Intuition stehe fest. |Fr. Stricker (Wien) bemerkt, dass ihre Bedenken nicht widerlegt sind.
Hr. Strasser bezeichnet die Intuition als künstlerische Tätigkeit.
Hr. Niessl v. Mayendorf (Leipzig): Das Wesen der Geisteskrankheit.
Die Erkenntnis vom Wesen einer Erkrankung bringt die Erklärung ihrer Er-
scheinungen, für welche die gewebliche Veründerung des erkrankten Organes die
Veränderung ihrer Leistung verständlich macht. Die psychopathischen Phänomene
bedürfen, um als solche richtig gewertet zu werden, der psychologischen Analyse,
deren Ergebnis in seiner Beziehung zum Gehirnorgan nur als die Lücke eines
Mechanismus verstanden werden kann.Melancholische und maniakalische Zustandsbilder bereiten dem nach ihrer
Genese Forschenden sowohl ihrer psychologischen Wurzel nach, als pathologische
Übertreibungen der Gefühlshóhe und Gefühlsdauer, als ihrer physischen Grundlage
nach, als abnorme Oxydationsphasen der Hirnrinde — seien dieselben durch abnormen
Stoffwechselumsatz primür, seien sie durch abnorme Beschaffenheit und Funktionen
der Vasomotoren sekundür bedingt — keine Schwierigkeiten.Anders bei den sog. Erkrankungen des Verstandes, bei jener Paralogik, welche
in Wahnbildung und Sinnestäuschung bestimmte Gedankengünge uns unverständ-
lich werden lüsst. Hier will man Lücken im Vorstellungsablauf, im Erkranken des
Vorstellens suchen und vergisst, dass die Aneinanderreihung zielstrebender Vor-
stellungen, ebenso wie das Erwachen derselben und ihr Inhalt von Gefühlen ab-
hängig ist. Die mangelhafte Korrektur ist, wie dies vom Vortr. in einem Vortrag auf
der Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Psychiatrie 1911 gezeigt wurde,
auf eine abnorme Gefühlsbetonung der die Korrektur herbeiführenden Gedankengånge
zurückzuführen, denn die Wahl des einzig Richtigen, d. h. die Bestimmung ihres
Inhalts hängt ausschliesslich von dem Eintreffen des normalen Gefühls ab. Die
kórpérliche Erscheinung des totgeglaubten Freundes überzeugt den von der Wahn-
idee seines Todes Befangenen deshalb nicht, weil sie für ihn nicht mit jenem Gefühl
der frohen Beruhigung verbunden ist, als für den, welcher bei gesundem Geistesleben
seinen Tod nur befürchtet. Jede Sinneståuschung eines Geisteskranken schliesst
eine Wabnbildung in sich. Nicht nur der Inhalt einer Sinnestäuschung wird von
dem beherrschenden Gefühl diktiert, nicht nur die Unmöglichkeit ihres Bestehens
innerhalb des logisch geordneten Weltbildes wird nicht erkannt, auch der Unterschied
zwischen endogen aufgetauchtem und exogen erzeugtem Wahrnehmungsbild ver-
schwindet. Der Gehirnmechanismus, welcher die veründerte Gefühlsbetonung in
einer Veränderung der Stoffwechselvorgünge, respektive der Oxydationsphasen jener
Hemisphärenteile aufklärt, die keine Projektionsflichen der Sinnesorgane sind,
erklirt auch das Sinnenfülligwerden der gedanklichen Reproduktionen bei Geistes-
kranken, indem das Verhiiltnis der Oxydationsphasen zu denjenigen der kortikalen
Projektionsflächen zu denjenigen der stummen Rindengebiete in dem Zustand der
Geisteskrankheit sich so verändern kann, dass es im Akte der Erinnerung dem-
jenigen im Akte der Wahrnehmung des Geistesgesunden gleicht und so zu der
Täuschung Anlass gibt.Demenz ist keine Armut an Vorstellungen, sondern ein Zustand der Unfähig-
keit, die Vorstellungen zu erwecken und zweckentsprechend zu ordnen. Der Nach-S.
Kongressberichte. 233
weis des Bestandes der scheinbar verschwundenen Vorstellungen gelingt dann, wenn
sie ohne Ziel fiir das Individuum hervorgerufen werden.Alle Geisteskrankheiten sind Erkrankungen der Gefühle, deren
Substrat in den Oxydationsphasen der Rinde des Grosshirns gesucht werden muss.Hr. Schmidt (Wien): Schillers Frauengestalten.
Vortr, zeigt die Leitlinien der wichtigsten Frauengestalten in Schillers Dramen
und demonstriert an ihnen die richtunggebenden Endzwecke (meist Willen zur Macht,
männlicher Protest gegen die weibliche Funktion). Adler's teleologische Erklärung
der Neurosen löst die scheinbaren Widersprüche auf und macht die sonderbaren
Expansionen der einzelnen Frauen als Kompensationen ihres ursprünglichen Minder-
wertigkeitsgefühls verständlich. Dr. K. F. (Wien).Varia.
Zur Kinderpsychologie.Gretel unterhält sich mit ihrer Grossmutter über das Alter verschiedener Leute.
„Wie alt ist Papa?" 一 „50 Jahre!" — „Und Mama?" 一 „39 Jahre?" — „Und du
Grossmama ?* — „Ich bin 71 Jahre alt!" — „Ach so alt! Dann ist es aber höchste
Zeit, dass du bald stirbst!* «Traudi sieht wie eine Mutter ihr Kind nährt. „Nicht wahr, Mama, ich habe
so an dir getrunken, als du noch eine Kuh warst?“Ilse fragt ihre Mama: „Warum hast du denn eigentlich zwei solche Trink-
felsen, da das Briiderchen doch immer nur aus einem trinkt?“Otto hat seinen Vater verloren. Liesel geht voll inniger Teilnahme zu ihm
und sagt ihm die tróstlichen Worte: „Weine nicht, Otto, deine Mutter nimmt bald
einen anderen Mann.“Die Lebrerin ermahnt die Kinder, die ålteren Leute und die Respektspersonen
nicht in den April zu schicken. Da tritt ein kleines Midchen hervor und fragt:
„Ob denn der Papa die Mama in den April schicken dürfe? ,,Jawohl, das darf er!“
Ja, aber darf denn auch der Papa zur Mama sagen: ,Weisst du, wir haben diese
Nacht ein Kind gekriegt?“Fritz wird von seinen Eltern zur Wohltåtigkeit angehalten. Bei Katastrophen,
Uberschwemmungen u. dgl., muss er immer aus seiner Sparbiichse ein Scherflein
beitragen. Kinst wollte ihm eine zu Besuch anwesende Tante drei Mark für seine
Spardose schenken mit den Worten: „Du sparst ja so fleissig?" Fritz lehnte dankend
das Geschenk ab. „Ach Tante das hat gar keinen Zweck! Hat man etwas gespart,
dann kommt doch gleich wieder ein Erdbeben oder eine Überschwemmung.“Die Schulkinder sollen gegensåtzliche Adjektive nennen, z. B. klein und gross,
dick und dünn, lang und breit. „Nun“ fragt der Lehrer, „wer weiss den Gegensatz
von „frei“?“ Klein Lieschen steht schüchtern anf: ,,Besetzt, Herr Lehrer.“Auf dem Schwarzwald, in der Gegend von B. tragen die Buben eine Tracht
mit roten Westen. Kasper hat seine erste rote Weste geschenkt bekommen, als
bald darauf seine Grossmutter starb. Der Vater erklärt, mit der roten Weste könne
Kasper nicht zur Leiche. Ach meint Kasper, „wenn ich die rote Weste nicht an-
ziehen kann, hernach hab ich an der ganzen Leich kei Freud mehr,“Dr; W. B.
zb4191434
193
–233