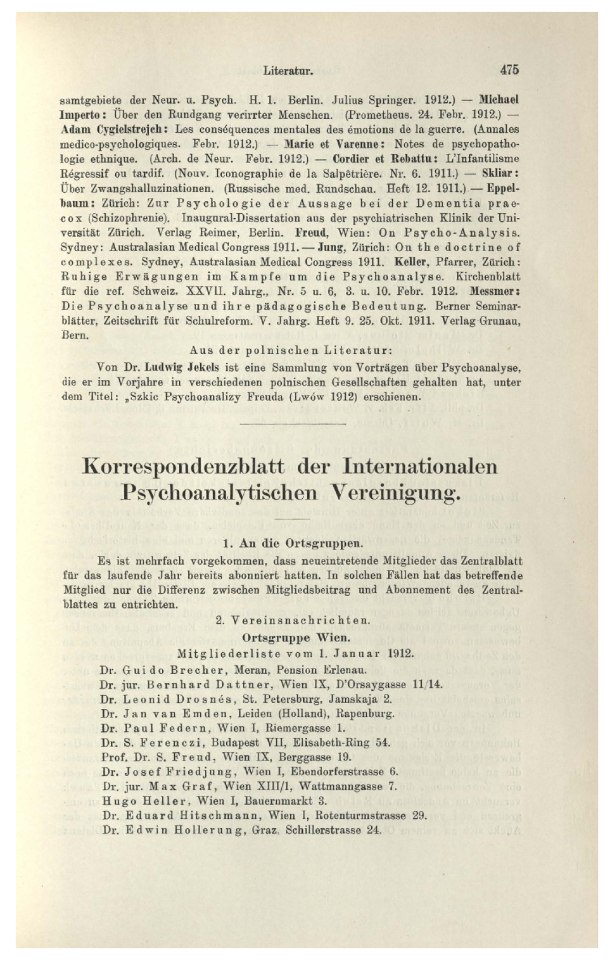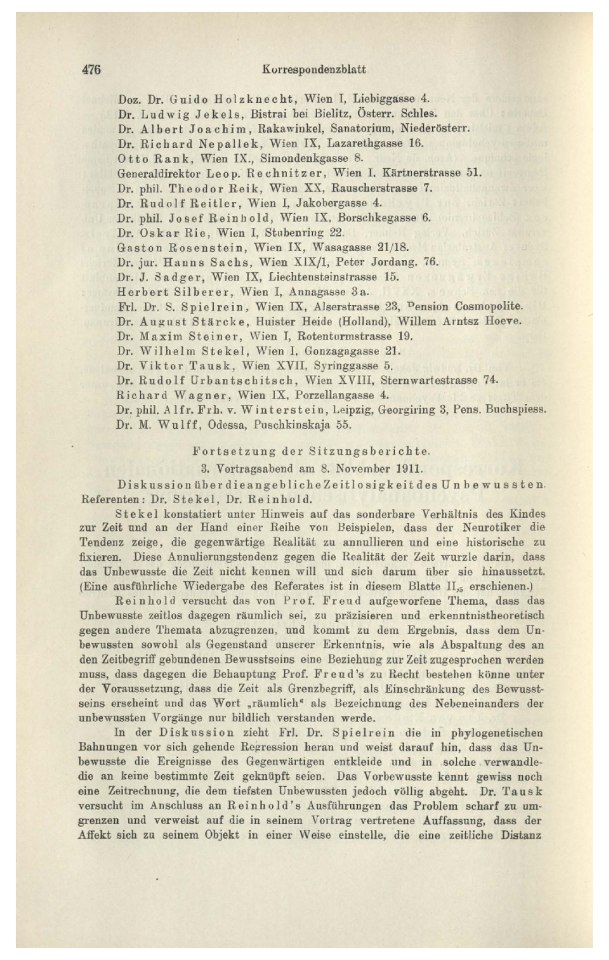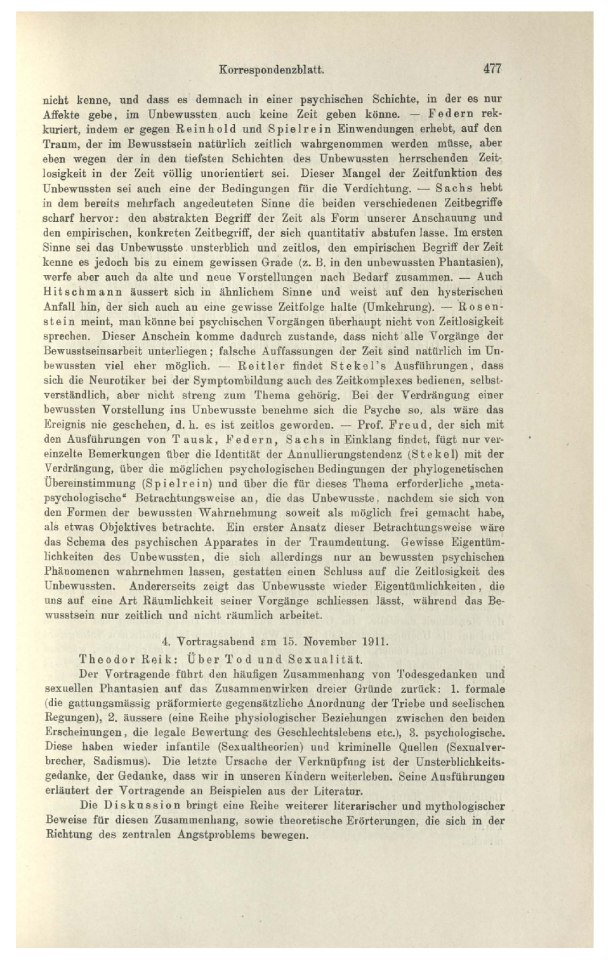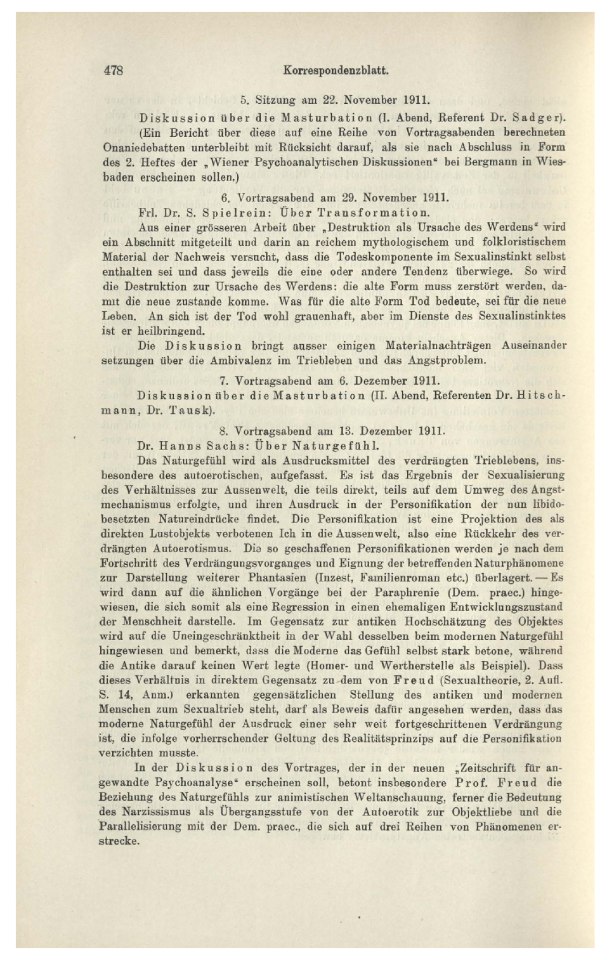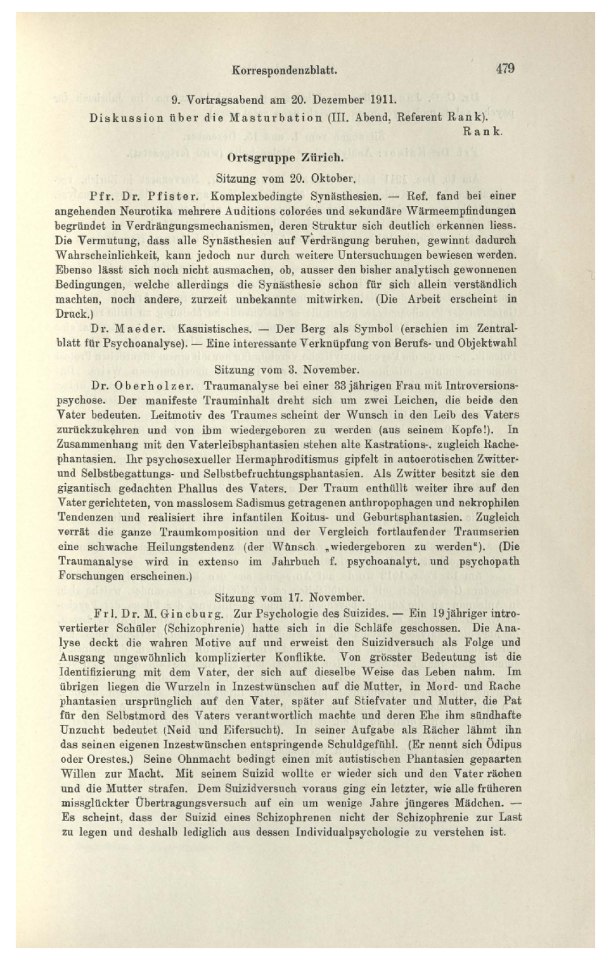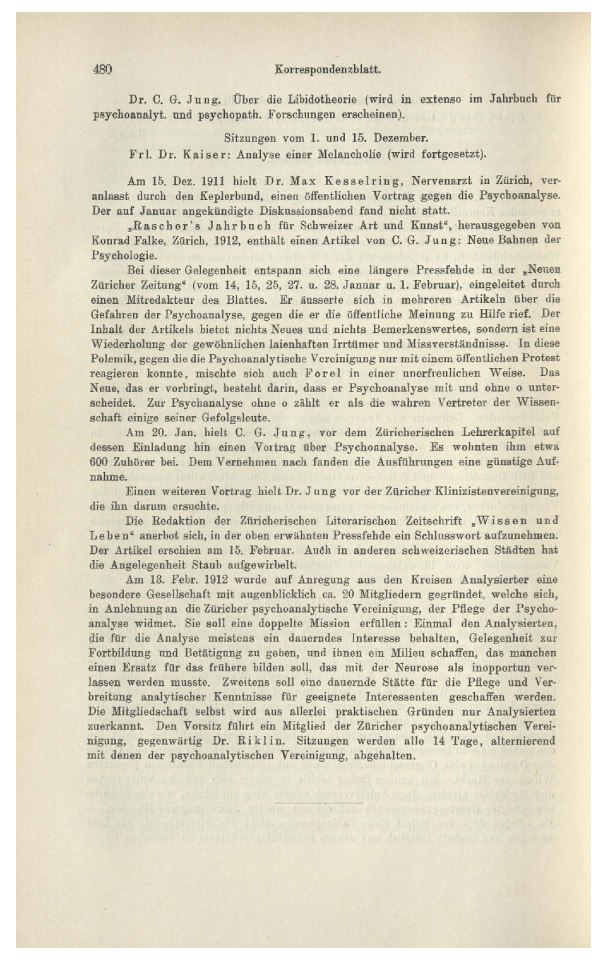S.
475
Literatur.
samtgehichte der Neur. u. Psych. H. 1. Berlin. Julius Springer. 1912.) — Michael
Impetto: Über den Rundgang verirrter Menschen. (Prometheus. 24. Febr. 1912. —
Adam Cyglejstrefeli: Les conséquences mentales des émotions de la guerre. (Annales
medico-psychologiques. Febr. 1912.) — Marie et Varenne: Notes de psychopatho-
logie ethnique. (Arch. de Neur. Febr. 1912.) — Cuvier et Raoults: L'infantilisme
Régressif et tardif. (Nouv. iconographie de la Salpetriere. Nr. 6. 1911.) — Skliar:
Über Zwangshalluzinationen. (Russische med. Rundschau. Heft 12. 1911.) — Eppel-
baum: Zürich. Zur Psychologie der Aussage bei der Dementia prae-
cox (Schizophrenie). Inauguraldissertation aus der psychiatrischen Klinik der Uni-
versität Zürich. Verlag Reimer, Berlin. Freud, Wien. On Psycho-Analysis.
Sydney: Australasian Medical Congress 1911. — Jung, Zürich: On the doctrine of
complexes. Sydney: Australasian Medical Congress 1911. Kieler, Pfarrer, Zürich:
Kritische Erwägungen im Kampfe um die Psychoanalyse. Kirchenblatt
für die ref. Schweiz. XXVII. Jahrg. Nr. 5 u. 6. 3. u. 10. Febr. 1912. Messner:
Die Psychoanalyse und ihre pädagogische Bedeutung. Berner Seminar-
blätter, Zeitschrift für Schulreform. V. Jahrg. Heft 9. 23. Okt. 1911. Verlag Grunau,
Bern.
Aus der polnischen Literatur:
Von Dr. Ludwig Jekels ist eine Sammlung von Verträgen über Psychoanalyse,
die er im Vorjahre in verschiedenen polnischen Gesellschaften gehalten hat, unter
dem Titel: Sakle Psychoanalizy Freuda (Lwów 1912) erschienen.
Korrespondenzblatt der Internationalen
Psychoanalytischen Vereinigung.
1. An die Ortsgruppen.
Es ist mehrfach vorgekommen, dass austretende Mitglieder das Zentralblatt
für das laufende Jahr bereits aboniert hatten. In solchen Fällen hat das betreffende
Mitglied nur die Differenz zwischen Mitgliedsbeitrag und Abonnement des Zentral-
blattes zu entrichten.
2. Vereinsnachrichten.
Ortsgruppe Wien.
Mitgliederliste vom 1. Januar 1912.
Dr. Guido Brecher, Meran, Pension Erlenau.
Dr. jur. Bernhard Dattner, Wien IX, D'Orsaygasse 11/14.
Dr. Leoniid Drabkin, St. Petersburg, Plasskaja 2.
Dr. Jan van Emden, Leiden (Holland), Rapenburg.
Dr. Paul Federn, Wien I, Riemergasse 1.
Dr. S. Ferenczi, Budapest VII, Elisabeth Ring 54.
Prof. Dr. S. Freud, Wien IX, Berggasse 19.
Dr. Josef Friedjung, Wien I, Ebendorferstrasse 6.
Dr. jur. Max Graf, Wien XIII/1, Wattmanngasse 7.
Hugo Heller, Wien I, Bauernmarkt 5.
Dr. Eduard Hitschmann, Wien I, Rotenturmstrasse 29.
Dr. Edwin Hollerung, Graz, Schillerstrasse 24.```
S.
476
Korrespondenzblatt
Dox. Dr. Guido Holzknecht, Wien I, Liebiggasse 4.
Dr. Ludwig Jekels, Bistrai bei Bielitz, Österr. Schles.
Dr. Albert Joachim, Rakawinik, Sanatorium, Niederösterr.
Dr. Richard Nepalek, Wien IX, Währingergasse 16.
Otto Rank, Wien IX, Tendlergasse 5.
Generaldirektor Leop. Rechnitzer, Wien I, Kärntnerstrasse 51.
Dr. phil. Theodor Reik, Wien XX, Rauscherstrasse 7.
Dr. Rudolf Reitler, Wien I, Lakohenagasse 4.
Dr. phil. Josef Reinhold, Wien IX, Porchbekgasse 6.
Dr. Oskar Rie, Wien I, Stobening 22.
Gaston Rosenstein, Wien IX, Wasagasse 21/18.
Dr. jur. Hans Sachs, Wien VI/II, Peter Jordang. 76.
Dr. J. Seidzer, Wien IX, Liechtensteinstrasse 19.
Herbert Silberer, Wien I, Annagasse 3a.
Frl. Dr. S. Spielrein, Wien IX, Alserstrasse 23, Pension Cosmopolite.
Dr. August Stärcke, Huinter Heide (Holland), Willem Arntsz Hoeve.
Dr. Maxim Steiner, Wien I, Rotenturmstrasse 19.
Dr. Wilhelm Stekel, Wien I, Gonzagaasse 31.
Dr. Viktor Tausk, Wien XVII, Syringgasse 5.
Dr. Rudolf Urbantschitsch, Wien XVIII, Hernwartesstrasse 74.
Richard Wagner, Wien IX, Porzellangasse 4.
Dr. phil. Alfr. Frh. v. Winterstein, Leipzig, Georgining 3, Pens. Bachspiess.
Dr. M. Wulff, Odessa, Puschkinskaja 55.
Fortsetzung der Sitzungsberichte.
3. Vortragsabend am 8. November 1911.
Diskussion über die Angelegenheit „Zeitlosigkeit des Unbewussten.
Referenten: Dr. Stekel, Dr. Reinhold.
Stekel konstatiert unter Hinweis auf das sonderbare Verhältnis des Kindes
zur Zeit und an der Hand einer Reihe von Beispielen, dass der Neurotiker die
Tendenz zeige, die gegenwärtige Realität zu annullieren und eine historische zu
setzen. Diese Annulierungsdendenz gegen die Realität der Zeit wurzle darin, dass
das Unbewusste die Zeit nicht kennen will und sich darum über sie hinaussetzt.
(Eine ausführliche Wiedergabe des Referates ist in diesem Blatte II. erschienen.)
Reinhold vergleicht das von Prof. Freud aufgeworfene Thema, dass das
Unbewusste zeitlos dagegen räumlich ist, zu präzisieren und erkenntnistheoretisch
gegen andere Gegensätze abzugrenzen, und kommt zu dem Ergebnis, dass dem Un-
bewussten sowohl als Gegenstand unserer Erkenntnis, wie als Abspaltung des an
den Zeitbegriff gebundenen Bewusstseins eine Beziehung zur Zeit zugesprochen werden
muss, dass dagegen die Behauptung Prof. Freuds, zu Recht bestehen könne unter
der Voraussetzung, dass die Zeit als Grenzbegriff, als Einschränkung des Bewusst-
seins erscheint und das Wort „räumlich" als Bezeichnung des Nebeneinanders der
unbewussten Vorgänge nur bildlich verstanden werde.In der Diskussion zieht Fr. S. Spielrein die in phylogenetischen
Bahnungen vor sich gehende Regression heran und weist darauf hin, dass das Un-
bewusste als Ereignisse des Gegenwärtigen empfindet und in solche verdrängte,
die an keine bestimmte Zeit gekoppelt seien. Das Vorbewusste kennt dagegen noch
eine Zeitrechnung, die dem tiefsten Unbewussten jedoch völlig abgeht. Dr. Tausk
versucht im Anschluss an Reinhold's Ausführungen das Problem scharf zu um-
grenzen und verweist auf die in seinem Vortrag vertretene Auffassung, dass der
Affekt sich zu seinem Objekt in einer Weise einstelle, die eine zeitlose Distanz```
S.
477
Korrespondenzblatt.
nicht kenne, und dass es demnach in einer psychischen Schichte, in der es nur
Affekte gebe, im Unbewussten auch keine Zeit geben könne. Federn rek-
kurriert, indem er gegen Reinhold und Spielrein Einwendungen erhebt, auf den
Traum, der im Bewusstsein natürlich zeitlich wahrgenommen werden müsse, aber
eben wegen der in den tiefen Schichten des Unbewussten herrschenden Zeit-
losigkeit in der Zeit völlig unorientiert sei. Dieser Mangel der Zeitfunktion des
Unbewussten sei auch eine der Bedingungen für die Verdichtung. Sachs hebt
in dem bereits mehrfach angedeuteten Sinne die beiden verschiedenen Zeitbegriffe
scharf hervor: den abstrakten Begriff der Zeit, an Feen unser Anschauung und
den empirischen Zeitbegriff, der sich quantitativ abrufen lasse. Im ersten
Sinne sei das Unbewusste unsterblich und zeitlos, den empirischen Begriff der Zeit
kenne es jedoch bis zu einem gewissen Grade (z. B. in den unbewussten Phantasien),
werfe aber auch da alte und neue Vorstellungen nach Belieben zusammen. nach
Hitschmann äussert sich in ähnlichem Sinne und weist auf den hysterischen
Anfall hin, der sich auch an eine gewisse Zeitfolge halte (Umkehrung). Rosen-
stein meint, man könne bei psychischen Vorgängen überhaupt nicht von Zeitlosigkeit
sprechen. Dieser Ansicht könne dadurch zugestimmt, dass nicht alle Vorgänge der
Bewusstseinsarbeit unterliegen; falsche Auffassungen der Zeit sind natürlich im Un-
bewussten viel eher möglich. Reitler findet Stekel's Ausführungen, dass
sich die Neurotiker bei der Symptombildung auch der Zeitkomplexes bedienen, selbst-
verständlich, aber nicht streng zum Thema gehörig. Bei der Verdrängung einer
bewussten Vorstellung ins Unbewusste bewirke auch die Psyche so, als wäre das
Ereignis nie geschehen, d. h. es ist zeitlos geworden. Frei Freud, der sich mit
den Ausführungen von Sachs, Federn, Sachs in Einklang findet, fügt nur ver-
einzelte Bemerkungen über die Identität der Annäherungsdendenz (Stekel) mit der
Verdrängung, über die möglichen psychologischen Bedingungen der psychogenetischen
Übereinstimmung (Spielrein) und über die für dieses Thema erforderliche „meta-
psychologische" Betrachtungsweise zu, die das Unbewusste, nachdem sie sich von
den Formen der bewussten Wahrnehmung soweit als möglich frei gemacht habe,
als etwas Objektives betrachte. Ein erster Ansatz dieser Betrachtungsweise wäre
das Schema des psychischen Apparats in der Traumdeutung. Gewisse Eigentüm-
lichkeiten des Unbewussten, die sich allerdings nur an bewussten psychischen
Phänomenen wahrnehmen lassen, gestatten einen Schluss auf die Zeitlosigkeit des
Unbewussten. Anderseits zeigt das Unbewusste wieder Eigentümlichkeiten, die
uns auf eine Art Räumlichkeit seiner Vorgänge schliessen lässt, während das Be-
wusstsein nur zeitlich und nicht räumlich arbeitet.
Vortragsabend am 15. November 1911.
Theodor Reik: Über Tod und Sexualität.
Der Vortragende führt den häufigen Zusammenhang von Todesgedanken und
sexuellen Phantasien auf den Zusammenwirken dreier Gründe zurück: 1. formale
(die gattungsmässig prätormine gegensätzliche Anordnung, der Triebe und seelischen
Regungen), unsere innere Reihe physiologischer Bedingungen zwischen den beiden
Erscheinungen, die legale Bewertung des Geschlechtslebens etc.; 3. psychologische.
Diese haben wieder infantile (Sexualtheorien) und kriminelle Quellen (Sexualver-
brechen, Sadismus). Die letzte Ursache der Verknüpfung ist der Unsterblichkeits-
gedanke, der Psyche, dass wir in unseren Kindern weiterleben. Seine Ausführungen
erläutert der Vortragende an Beispielen aus der Literatur.Die Diskussion bringt eine Reihe weiterer literarischer und mythologischer
Beweise für diesen Zusammenhang, sowie theoretische Erörterungen, die sich in der
Richtung des zentralen Angstproblems bewegen.S.
Korrespondenzblatt. 478
5. Sitzung am 22. November 1911.
Diskussion über die Masturbation (I. Abend, Referent Dr. Sadger).
(Ein Bericht über diese auf eine Reihe von Vortragsabenden berechneten
Onaniebatten unterbleibt mit Rücksicht darauf, als sie nach Abschluss in Form
des 2. Heftes der „Wiener Psychoanalytischen Diskussionen" bei Bergmann in Wies-
baden erscheinen sollen).
6. Vortragsabend am 29. November 1911.
Frl. Dr. S. Spielrein: Über Transformation.
Aus einer grösseren Arbeit über „Destruktion als Ursache des Werdens" wird
ein Abschnitt mitgeteilt und darin an reichem mythologischem und folkloristischem
Material der Nachweis versucht, dass die Todeskomponente im Sexualinstinkt selbst
enthalten sei und dass jeweils die eine oder andere Tendenz überwiege. So wird
die Destruktion zur Ursache des Werdens; die alte Form muss zerstört werden, da-
mit die neue zustande komme. Was für die alte Form Tod bedeute, sei für die neue
Leben. An sich sei der Tod wohl grauenhaft, aber im Dienste des Sexualinstinkts
ist er heilbringend.
Die Diskussion bringt ausser einigen Materialnachträgen Auseinander-
setzungen über die Ambivalenz im Triebleben und das Angstproblem.
7. Vortragsabend am 6. Dezember 1911.
Diskussion über die Masturbation (II Abend, Referenten Dr. Hitsch-
mann, Dr. Tausk).
8. Vortragsabend am 13. Dezember 1911.
Dr. Hanns Sachs: Über Naturgefühl.
Das Naturgefühl wird als Ausdrucksmittel des verdrängten Trieblebens, ins-
besondere des autoerotischen, aufgefasst. Es ist das Ergebnis der Sexualisierung
des Verhältnisses zur Aussenwelt, die teils direkt, teils auf dem Umweg des Angst-
mechanismus erfolge, und ihren Ausdruck in der Personifikation der nun libido-
besetzten Natur eindrücke findet. Die Personifikation ist eine Projektion des als
direktes Lustobjekt' verborrenen Ich in die Aussenwelt, also eine Rückkehr des ver-
drängten Autoerotismus. Die so geschaffenen Personifikationen werden je nach dem
Fortschritt des Verdrängungsvorganges und Eignung der betreffenden Naturphänome-
zur Darstellung weiterer Phantasien (Inzest, Familienroman etc.) überlagert. Es
wird dann auf die ähnlichen Vorgänge bei der Paraphrenie (Dem. praec.) hinge-
wiesen, die sich somit als eine Regression in einen ehemaligen Entwicklungzustand
der Menschheit darstellt. Im Gegensatz zur antiken Hochschätzung des Objekts
wird auf die Unentschlossenheit, in der Fühl denselben beim modernen Naturfühl
hingewiesen und bemerkt, dass die Moderne das Gefühl selbst stark betone, während
die Antike darauf keinen Wert legte (Homer- und Wertherstelle als Beispiel). Dass
dieses Verhältnis in direktem Gegensatz zu dem von Freud der Sexualtheorie, 2. Aufl.
S. 14 (Anm.) erkannten gegensätzlichen Stellung des antiken und modernen
Menschen zum Sexualtrieb steht, darf als Beweis dafür angesehen werden, dass das
moderne Naturgefühl der Ausdruck einer sehr weit fortgeschrittenen Verdrängung
ist, die infolge vorhergehender Geltung des Kupladens Eifersucht. (er nennt sich Ödipus
eines Orestes.) Seine Ohnmacht bedingt einen mit sadistischen Phantasien gepaarten
Willen zur Macht. Mit seinem Suizid wollte er wieder sich und den Vater lieben
und die Mutter strafen. Dem Suizidversuch voraus ging ein letzter, wie alle früheren
missglückter Übergangsversuch auf ein am wenige Jahre jüngeres Mädchen. —
Es scheint, dass der Suizid eines Schizophrenen nicht der Schizophrenie zur Last
zu lägen und deshalb lediglich aus dessen Individualpsychologie zu verstehen ist.
In der Diskussion des Vortrages, der in der neuen „Zeitschrift für an-
gewandte Psychoanalyse" erscheinen soll, betont insbesondere Prof. Freud die
Bedeutung des Naturgefühls zur primitivistischen Weltanschauung, ferner der Bedeutung
des Narzissmus als Übergangsstufe von der Autoerotik zur Objektliebe und die
Parallelisierung mit der Dem. praec., die sich auf drei Reihen von Phänomenen er-
strecke.
S.
Korrespondenzblatt. 479
9. Vortragsabend am 20. Dezember 1911.
Diskussion über die Masturbation (III. Abend, Referent Rank).
Rank.
Ortsgruppe Zürich.
Sitzung vom 20. Oktober.
Pfr. Dr. Pfister, Komplexbedingte Synästhesien. — Ref. fand bei einer
angehenden Neurotika mehrere Auditions colorées und sekundäre Wärmeempfindungen
begründet in Verdrängungsmechanismen, deren Struktur sich deutlich erkennen liess.
Die Vermutung, dass die Synästhesien auf Verdrängung beruhen, gewinnt dadurch
Wahrscheinlichkeit, kann jedoch nur durch weitere Untersuchungen erwiesen werden.
Ebenso lässt sich noch nicht ausmachen, ob, ausser den bisher analytisch gewonnenen
Bedingungen, welche allerdings die Synästhesie schon für sich allein verständlich
machen, noch andere, zurzeit unbekannte mitwirken. (Die Arbeit erscheint in
Druck).
Dr. Maeder. Kasuistisches. — Der Berg als Symbol (erschien im Zentral-
blatt für Psychoanalyse). — Eine interessante Verknüpfung von Berufs- und Objektwahl
Sitzung vom 3. November.
Dr. Oberholzer. Psychoanalyse bei einer 33 jährigen Frau mit Introversions-
psychose. Der manifeste Trauminhalt dreht sich um zwei Leichen, die beide den
Vater bedeuten. Leitmotive des Traumes scheint der Wunsch in den Leib des Vaters
zurückzukehren und von ihm wiedergeboren zu werden (aus seinem Kopfe!). In
Zusammenhang mit den Vaterschaftsfantasien stehen alle Kastrations-, zugleich Rache-
phantasien. Ihre psychosexuellen Hermaphrodismus gipfelt im unbewussten Zwittern
und Selbstbegattung und Selbstbefruchtungsphantasien. Als Zwitter besitzt sie den
gigantisch gedachten Phallus des Vaters. Der Traum enthält weiter ihre auf den
Vater gerichteten, von massivem Sadismus getragenen Embryophantasien und nekrophilen
Tendenzen und realisiert ihre infantilen Zeittos- und Geburtsphantasien. Zugleich
verrät die ganze Traumkomposition und der Vergleich fortlaufender Traumserien
eine schwache Heilungstendenz (der Wunsch „wiedergeboren zu werden“). (Die
Traumanalyse wird in extenso im Jahrbuch f. psychoanalyt. und psychopath
forschungen erscheinen.)
Sitzung vom 17. November.
Frl. Dr. M. Ginzburg. Zur Psychologie des Suizides. — Ein 19 jähriger intro-
vertierter Schüler (Schizophrenie) hatte sich in die Schläfe geschossen. Die Ana-
lyse deckt die schwere Motive auf und erweist den Suizidversuch als Folge und
Ausgang unbewältigter komplizierter Konflikte. Von grösster Bedeutung ist die
Identifizierung mit dem Vater, der sich auf dieselbe Weise das Leben nahm. Im
übrigen liegen die Wurzeln in Inzestwünschen auf die Mutter, in Mord- und Rache-
phantasien ursprünglich auf den Vater, später auf Stiefvater und Mutter, die Fal-
len den Selbstmord des Vaters verantwortlich machte und dem er sie ihre sündhafte
Unzucht bedeutet (Neid und Eifersucht). In seiner Aufgabe als Rächer lärmt ihm
das seinen eigenen Inzestwünschen entspringende Schuldgefühl. (Er nennt sich Ödipus
eines Orestes.) Seine Ohnmacht bedingt einen mit sadistischen Phantasien gepaarten
Willen zur Macht. Mit seinem Suizid wollte er wieder sich und den Vater lieben
und die Mutter strafen. Dem Suizidversuch voraus ging ein letzter, wie alle früheren
missglückter Übergangsversuch auf ein am wenige Jahre jüngeres Mädchen. —
Es scheint, dass der Suizid eines Schizophrenen nicht der Schizophrenie zur Last
zu lägen und deshalb lediglich aus dessen Individualpsychologie zu verstehen ist.
S.
480 Korrespondenzblatt.
Dr. C. G. Jung, Uber die Libidotheorie (wird in extenso im Jahrbuch fiir
psychoanalyt. und psychopath. Forschungen erscheinen).Sitzungen vom 1. und 15. Dezember.
Frl. Dr. Kaiser: Analyse einer Melancholie (wird fortgesetzt).Am 15. Dez. 1911 hielt Dr, Max Kesselring, Nervenarzt in Zürich, ver-
anlasst durch den Keplerbund, einen öffentlichen Vortrag gegen die Psychoanalyse.
Der auf Januar angekiindigte Diskussionsabend fand nicht statt.»Rascher's Jahrbuch für Schweizer Art und Kunst“, herausgegeben von
Konrad Falke, Zürich, 1912, enthält einen Artikel von C. G. Jung: Neue Bahnen der
Psychologie.Bei dieser Gelegenheit entspann sich eine lingere Pressfehde in der ,Neuen
Züricher Zeitung“ (vom 14, 15, 25, 27. u. 28. Januar u. 1. Februar), eingeleitet durch
einen Mitredakteur des Blattes. Er åusserte sich in mehreren Artikeln über die
Gefahren der Psychoanalyse, gegen die er die öffentliche Meinung zu Hilfe rief. Der
Inhalt der Artikels bietet nichts Neues und nichts Bemerkenswertes, sondern ist eine
Wiederholung der gewöhnlichen laienhaften Irrtümer und Missverständnisse. In 6
Polemik, gegen die die Psychoanalytische Vereinigung nur mit cinem öffentlichen Protest
reagieren konnte, mischte sich auch Forel in einer unerfreulichen Weise. Das
Neue, das er vorbringt, besteht darin, dass er Psychoanalyse mit und ohne o unter-
scheidet. Zur Psychanalyse ohne o zihlt er als die wahren Vertreter der Wissen-
schaft einige seiner Gefolgsleute.Am 20. Jan. hielt C. G. Jung, vor dem Ziiricherischen Lehrerkapitel auf
dessen Einladung hin einen Vortrag über Psychoanalyse. Es wohnten ihm etwa
600 Zuhörer bei. Dem Vernehmen nach fanden die Ausführungen eine günstige Auf-
nahme.Einen weiteren Vortrag hielt Dr. Jung vor der Züricher Klinizistenvereinigung,
die ihn darum ersuchte.Die Redaktion der Züricherischen Literarischen Zeitschrift „Wissen und
Leben“ anerbot sich, in der oben erwähnten Pressfehde ein Schlusswort aufzunehmen.
Der Artikel erschien am 15. Februar. Auch in anderen schweizerischen Städten hat
die Angelegenheit Staub aufgewirbelt.Am 18. Febr. 1912 wurde auf Anregung aus den Kreisen Analysierter eine
besondere Gesellschaft mit augenblicklich ca. 20 Mitgliedern gegründet, welche sich,
in Anlehnung an die Züricher psychoanalytische Vereinigung, der Pflege der Psycho-
analyse widmet. Sie soll eine doppelte Mission erfüllen: Einmal den Analysierten,
die für die Analyse meistens ein dauerndes Interesse behalten, Gelegenheit zur
Fortbildung und Betätigung zu geben, und ihnen ein Milieu schaffen, das manchen
einen Ersatz für das frühere bilden soll, das mit der Neurose als inopportun ver-
lassen werden musste. Zweitens soll eine dauernde Stätte für die Pflege und Ver-
breitung analytischer Kenntnisse für geeignete Interessenten geschaffen werden.
Die Mitgliedschaft selbst wird aus allerlei praktischen Gründen nur Analysierten
zuerkannt. Den Vorsitz führt ein Mitglied der Züricher psychoanalytischen Verei-
nigung, gegenwärtig Dr. Riklin. Sitzungen werden alle 14 Tage, alternierend
mit denen der psychoanalytischen Vereinigung, abgehalten.
zb219128
475
–480