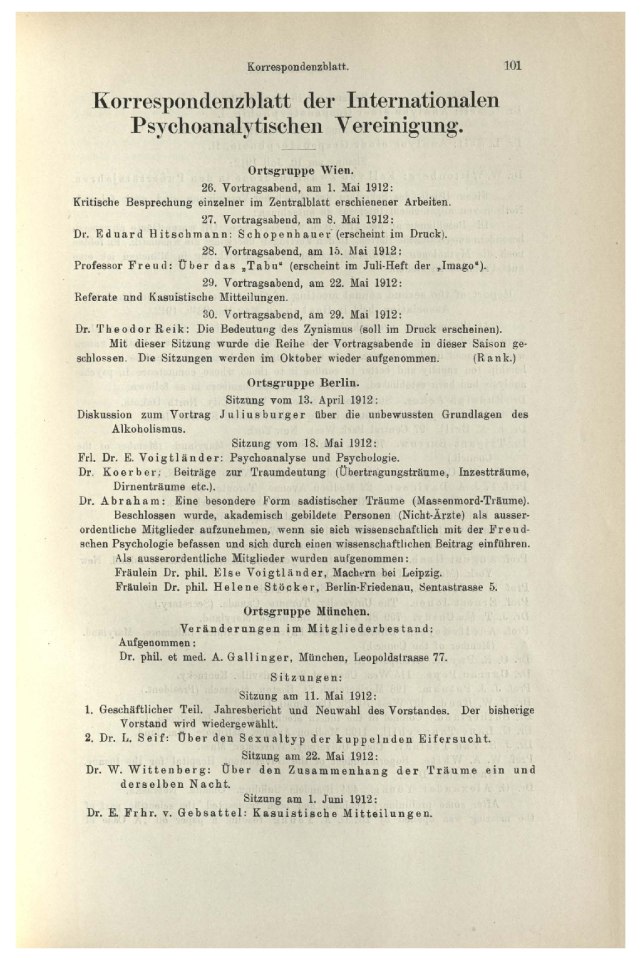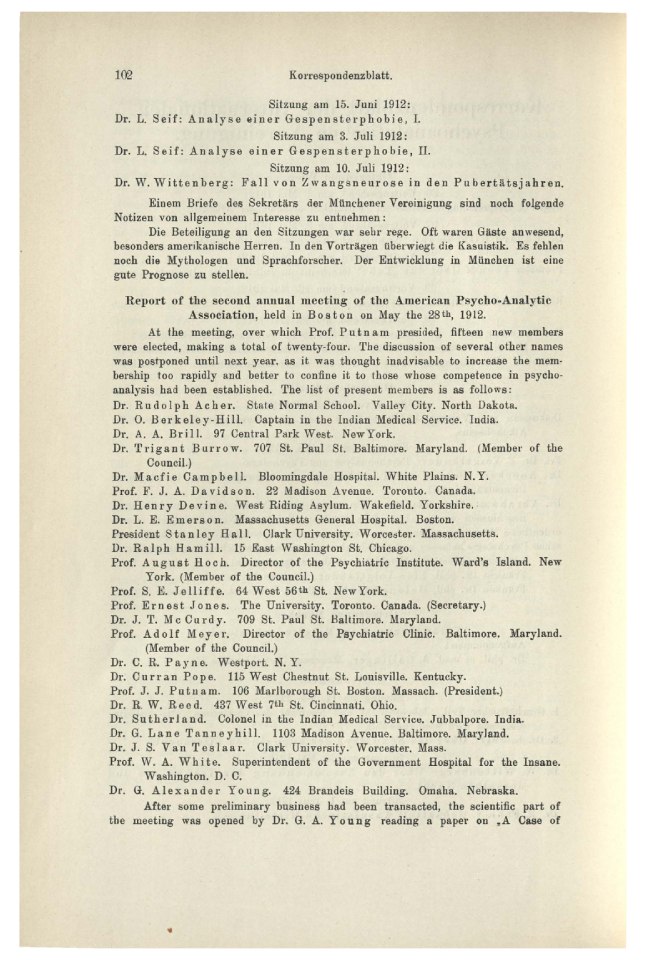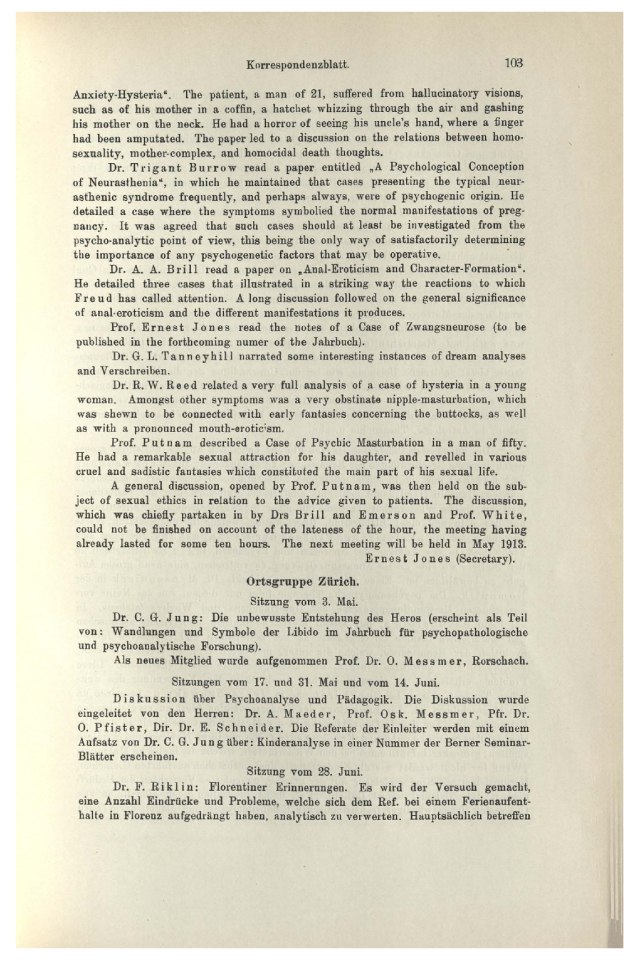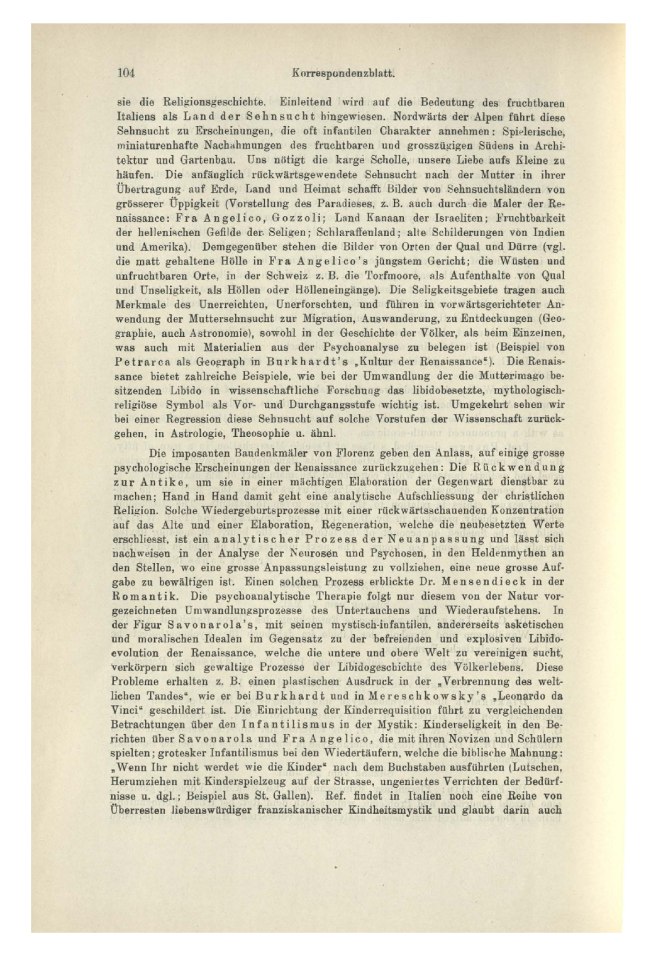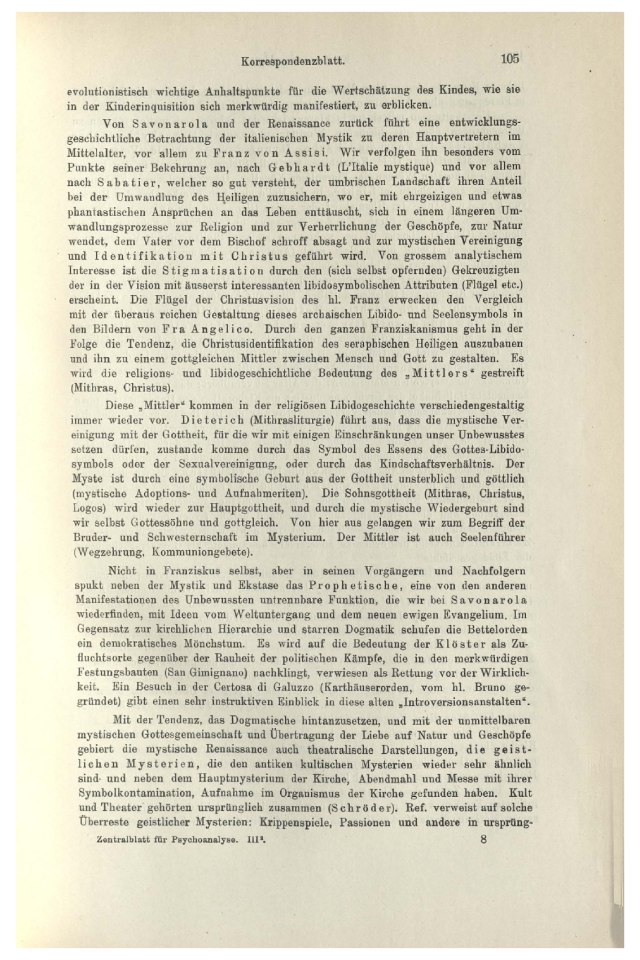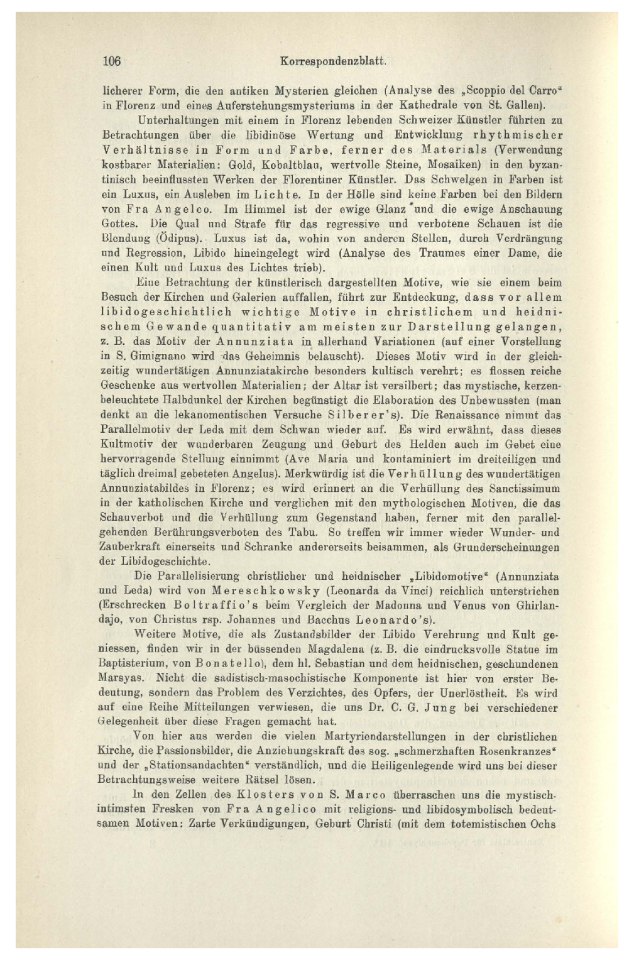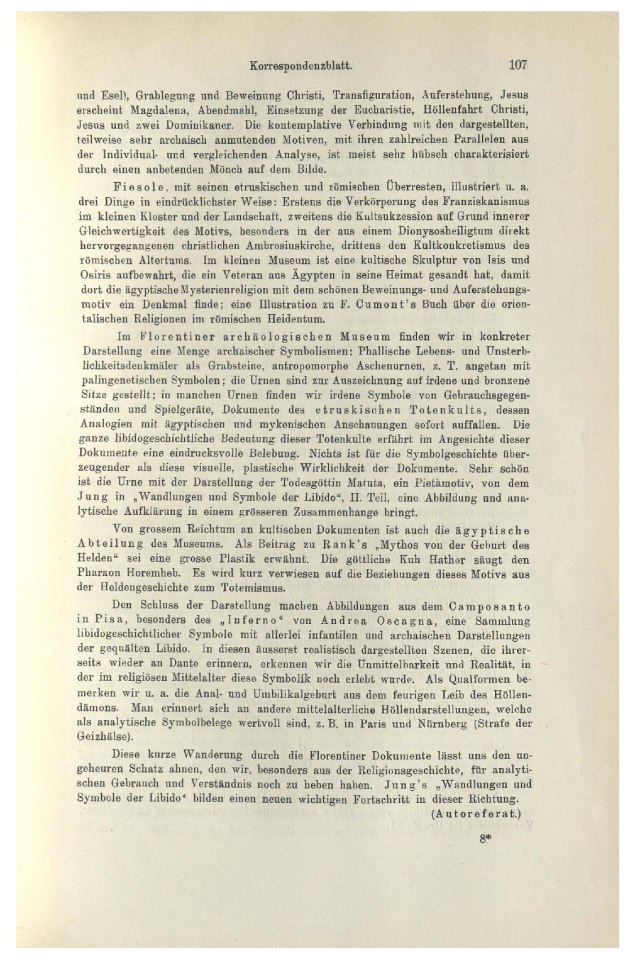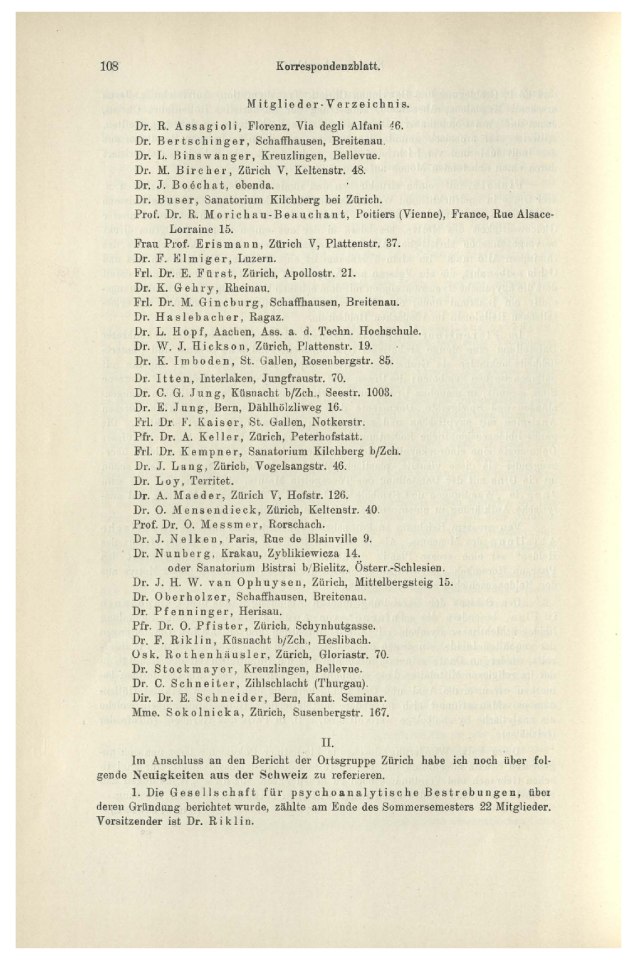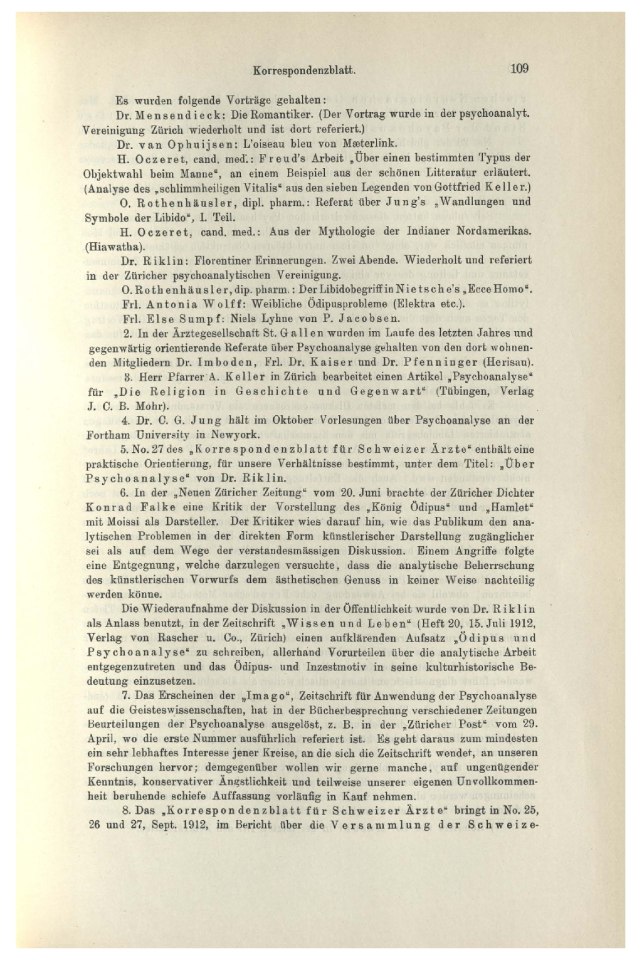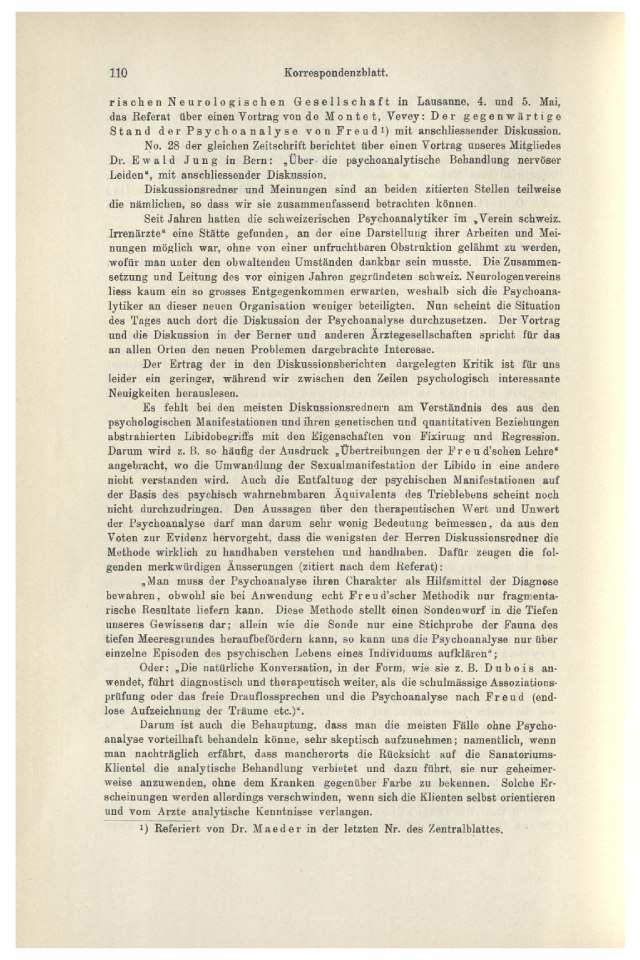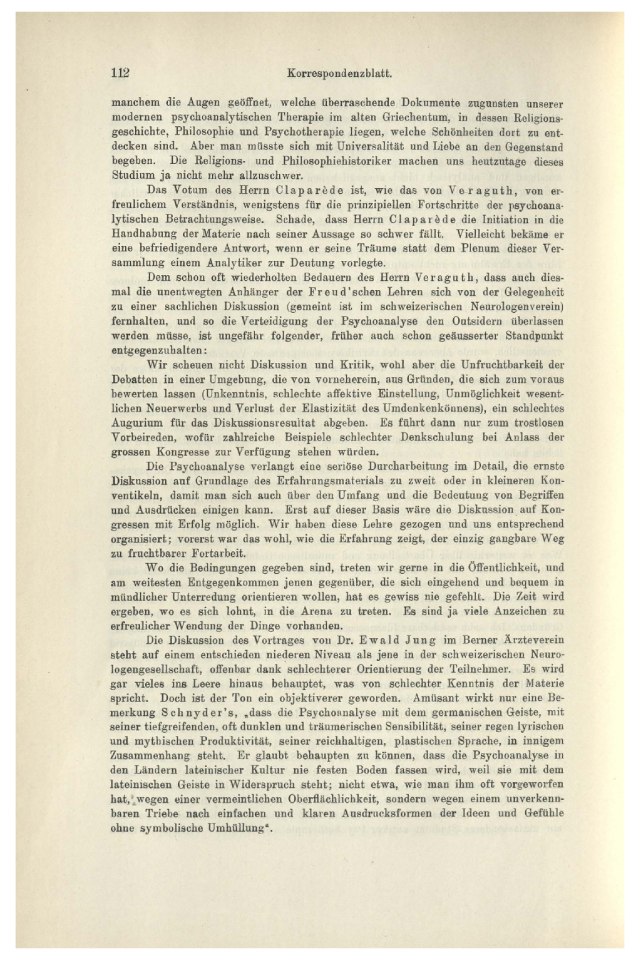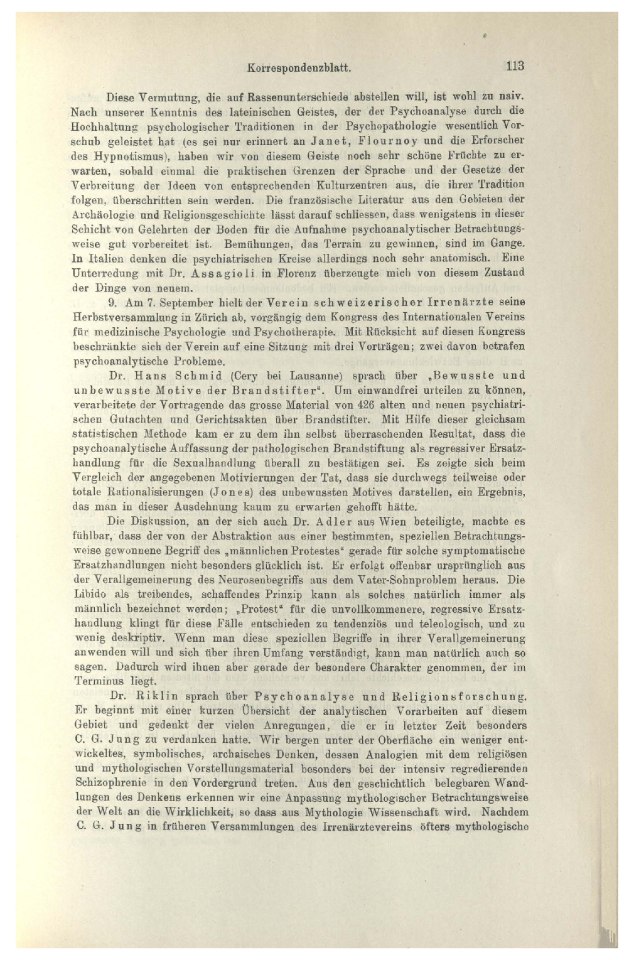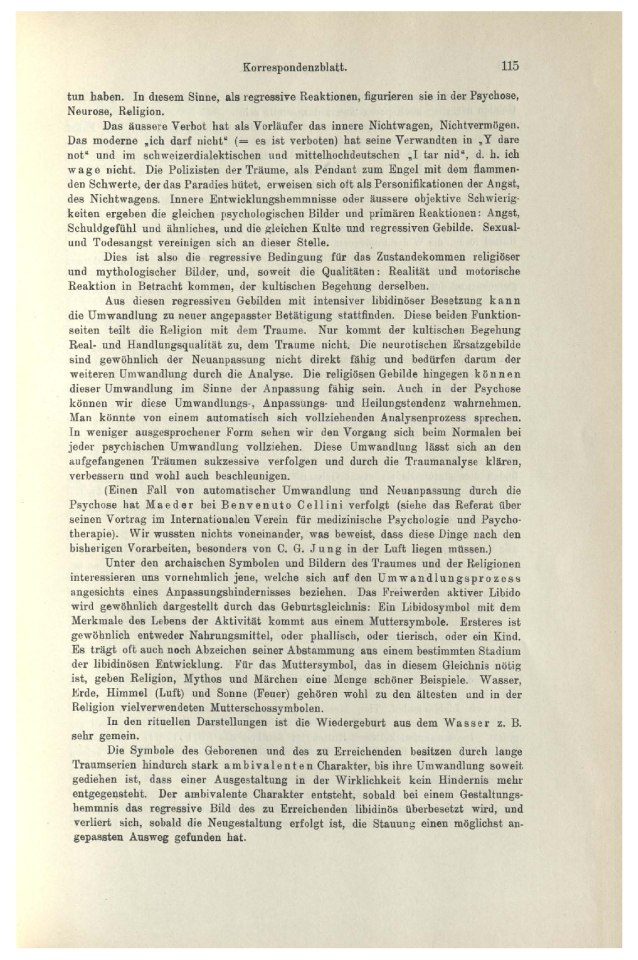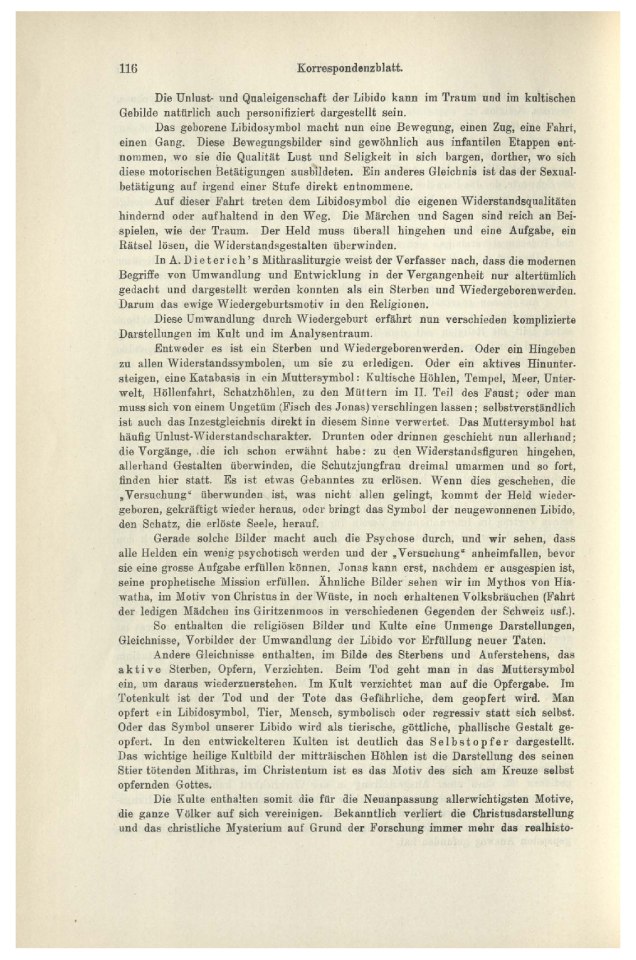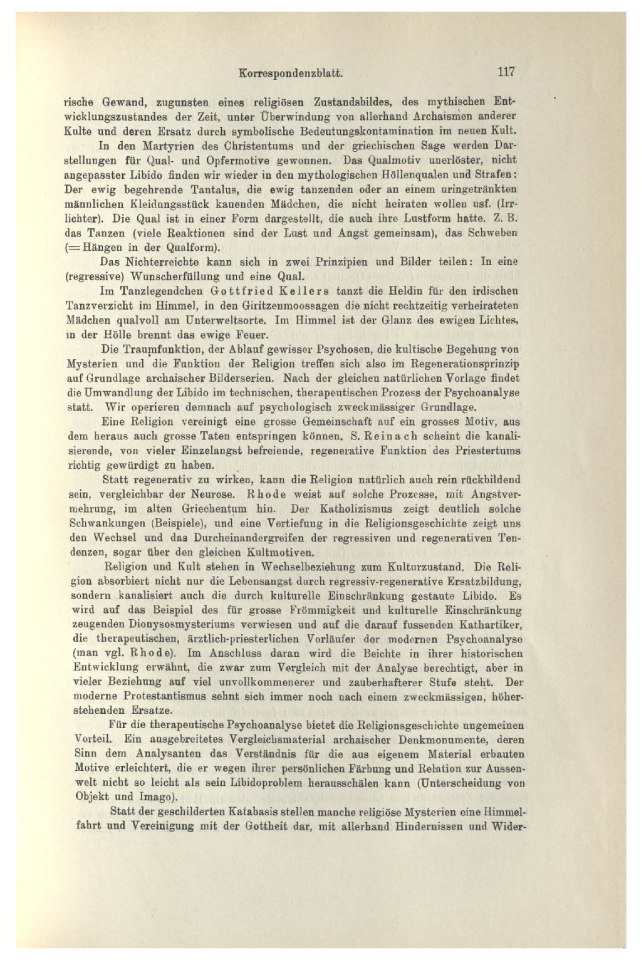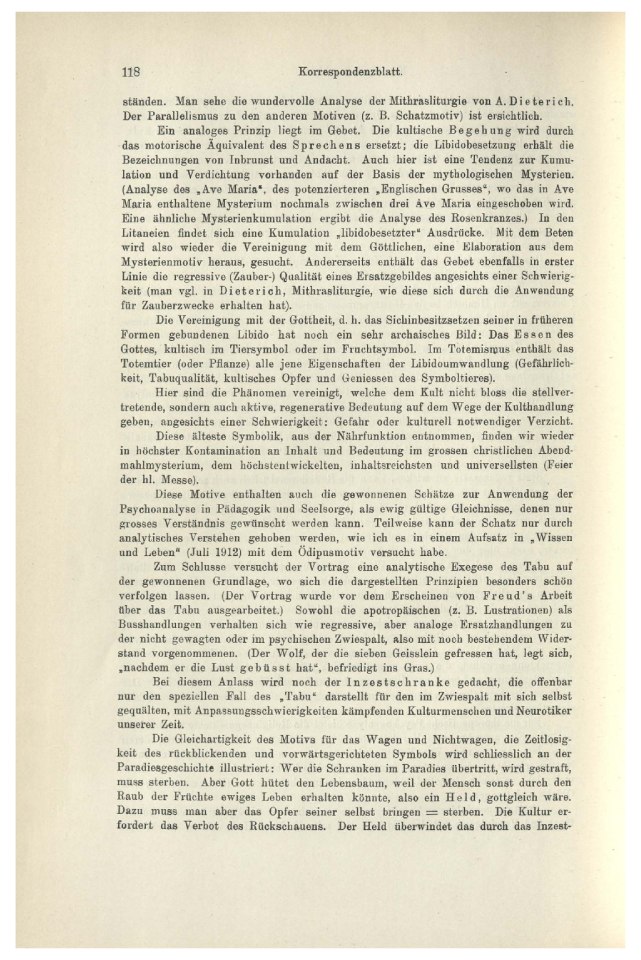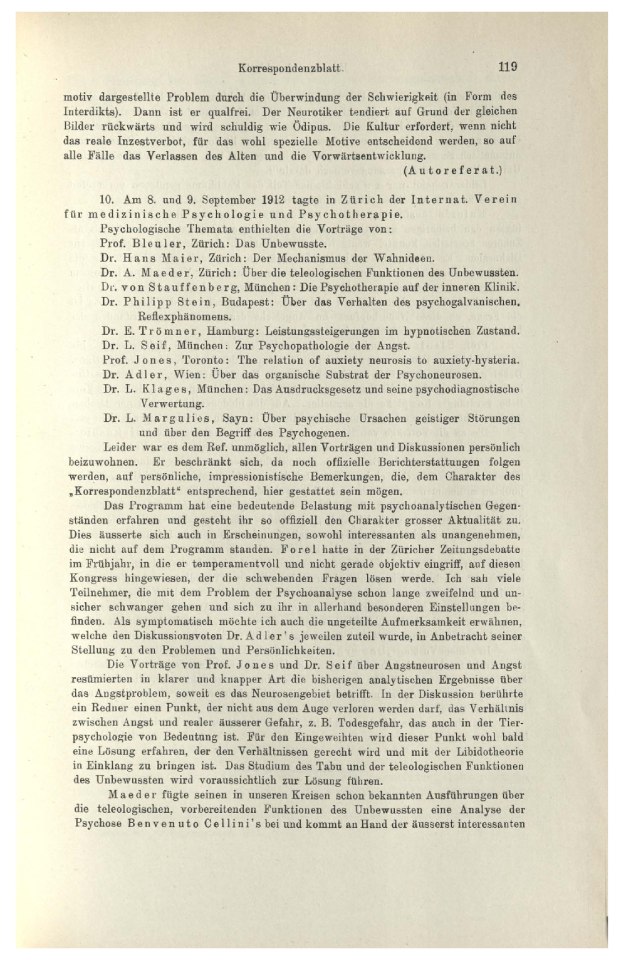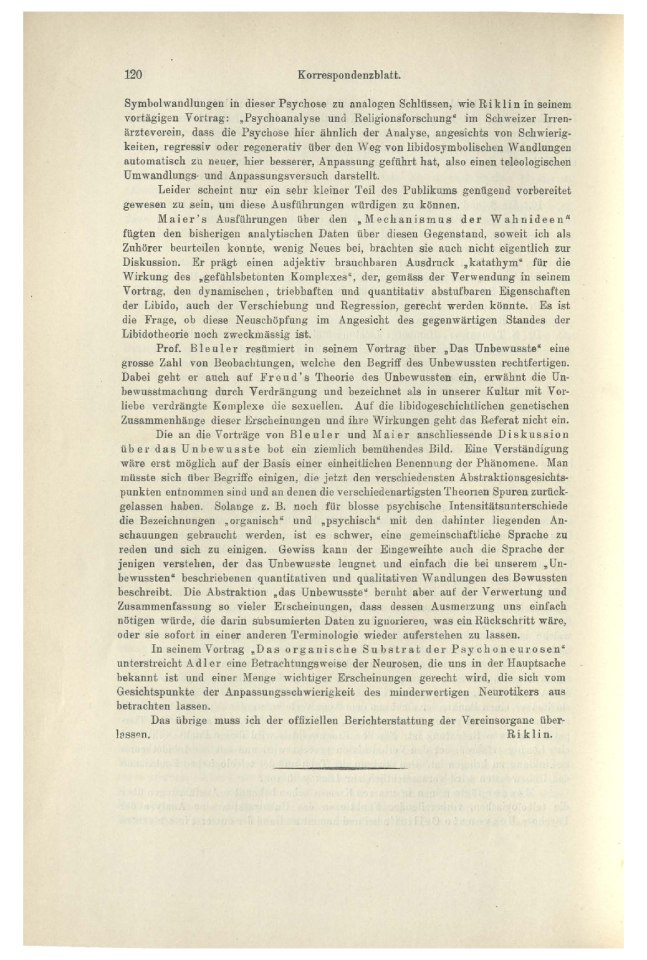S.
Korrespondenzblatt.
Korrespondenzblatt der Internationalen
Psychoanalytischen Vereinigung.Ortsgruppe Wien.
26. Vortragsabend, am 1. Mai 1912:
Kritische Besprechung einzelner im Zentralblatt erschienener Arbeiten.
27. Vortragsabend, am 8. Mai 1912:
Dr. Eduard Hitschmann: Schopenhauer (erscheint im Druck).
28. Vortragsabend, am 15. Mai 1912:
Professor Freud: Über das „Tabu" (erscheint im Juli-Heft der „Imago“).
29. Vortragsabend, am 22. Mai 1912:
Referate und kasuistische Mitteilungen.
30. Vortragsabend, am 29. Mai 1912:
Dr. Theodor Reik: Die Bedeutung des Zynismus (soll im Druck erscheinen).
Mit dieser Sitzung wurde die Reihe der Vortragsabende in dieser Saison ge-
schlossen. Die Sitzungen werden im Oktober wieder aufgenommen. (Rank.)
Ortsgruppe Berlin.
Sitzung vom 13. April 1912:
Diskussion zum Vortrag Juliusburger: Über die unbewussten Grundlagen des
Alkoholismus.
Sitzung vom 18. Mai 1912:
Frl. Dr. E. Voigtländer: Psychoanalyse und Psychologie.
Dr. Koerber: Beiträge zur Traumdeutung (Übertragungsträume, Inzestträume,
Dirnenträume etc.).
Dr. Abraham: Eine besondere Form sadistischer Träume (Massenmord-Träume).
Beschlossen wurde, akademisch gebildete Personen (Nicht-Ärzte) als ausser-
ordentliche Mitglieder aufzunehmen, wenn sie sich wissenschaftlich mit der Freud-
schen Psychologie befassen und sich durch einen wissenschaftlichen Beitrag einführen.
Als ausserordentliche Mitglieder wurden aufgenommen:
Fräulein Dr. phil. Else Voigtländer, Machern bei Leipzig.
Fräulein Dr. phil. Helene Stöcker, Berlin-Friedenau, Sentastraße 5.
Ortsgruppe München.
Veränderungen im Mitgliederbestand:
Aufgenommen:
Dr. phil. et med. A. Gallinger, München, Leopoldstrasse 77.
Sitzungen:
Sitzung am 11. Mai 1912:
1. Geschäftlicher Teil, Jahresbericht und Neuwahl des Vorstandes. Der bisherige
Vorstand wird wiedergewählt.
2. Dr. I. Seif: Über den Sexualtyp der kuppeladen Eifersucht.
Sitzung am 22. Mai 1912:
Dr. W. Wittenberg: Über den Zusammenhang der Träume ein und
derselben Nacht.
Sitzung am 1. Juni 1912:
Dr. E. Frhr. v. Gebsattel: Kasuistische Mitteilungen.
```
S.
102 Korrespondenzblatt.
Sitzung am 15. Juni 1912:
Dr. L. Seif: Analyse einer Gespensterphobie, I.
Sitzung am 3. Juli 1912:
Dr. L. Seif: Analyse einer Gespensterphobie, II.
Sitzung am 10. Juli 1912:
Dr. W. Wittenberg: Fall von Zwangsneurose in den Pubertätsjahren.Einem Briefe des Sekretärs der Münchener Vereinigung sind noch folgende
Notizen von allgemeinem Interesse zu entnehmen :Die Beteiligung an den Sitzungen war sehr rege. Oft waren Gäste anwesend,
besonders amerikanische Herren. In den Vorträgen überwiegt die Kasuistik. Es fehlen
noch die Mythologen und Sprachforscher. Der Entwicklung in Miinchen ist eine
gute Prognose zu stellen.Report of the second annual meeting of the American Psycho-Analytic
Association, held in Boston on May the 28th, 1912.At the meeting, over which Prof. Putnam presided, fifteen new members
were elected, making a total of twenty-four. The discussion of several other names
was postponed until next year, as it was thought inadvisable to increase the mem-
bership too rapidly and better to confine it to those whose competence in psycho-
analysis had been established. The list of present members is as follows:Dr. Rudolph Acher. State Normal School. Valley City. North Dakota.
Dr. 0. Berkeley-Hill. Captain in the Indian Medical Service. India.
Dr. A, A. Brill. 97 Central Park West. New York.
Dr. Trigant Burrow. 707 St. Paul St. Baltimore. Maryland. (Member of the
Council.)
Dr. Macfie Campbell. Bloomingdale Hospital. White Plains. N.Y.
Prof. F. J. A. Davidson. 22 Madison Avenue. Toronto. Canada.
Dr. Henry Devine. West Riding Asylum. Wakefield. Yorkshire.
Dr. L. E. Emerson. Massachusetts General Hospital. Boston.
President Stanley Hall. Clark University. Worcester. Massachusetts.
Dr. Ralph Hamill. 15 East Washington St. Chicago.
Prof. August Hoch. Director of the Psychiatric Institute. Ward's Island. New
York. (Member of the Council.)
Prof. 8. E. Jelliffe. 64 West 56th St. New York.
Prof. Ernest Jones. The University. Toronto. Canada. (Secretary.)
Dr. J. T. Mc Curdy. 709 St. Paul St. Baltimore. Maryland.
Prof. Adolf Meyer. Director of the Psychiatric Clinic. Baltimore. Maryland.
(Member of the Council.)
Dr. C. R. Payne. Westport. N. Y.
Dr. Curran Pope. 115 West Chestnut St. Louisville, Kentucky.
Prof. J. J. Putnam. 106 Marlborough St. Boston. Massach. (President.)
Dr. ₪ W. Reed. 437 West 7th St. Cincinnati. Ohio.
Dr. Sutherland. Colonel in the Indian Medical Service. Jubbalpore. India.
Dr. G. Lane Tanneyhill. 1103 Madison Avenue. Baltimore. Maryland.
Dr. J. 8. Van Teslaar. Clark University. Worcester, Mass.
Prof. W. A. White. Superintendent of the Government Hospital for the Insane.
‘Washington. D. C.
Dr. G. Alexander Young. 424 Brandeis Building. Omaha. Nebraska.
After some preliminary business had been transacted, the scientific part of
the meeting was opened by Dr. G. A. Young reading a paper on ,A Case of
S.
Korrespondenzblatt. 103
Anxiety-Hysteria^. The patient, a man of 21, suffered from hallucinatory visions,
such as of his mother in a coffin, a hatchet whizzing through the air and gashing
his mother on the neck. He had a horror of seeing his uncle’s hand, where a finger
had been amputated. The paper led to a discussion on the relations between homo-
sexuality, mother-complex, and homocidal death thoughts.Dr. Trigant Burrow read a paper entitled ,A Psychological Conception
of Neurasthenia“, in which he maintained that cases presenting the typical neur-
asthenic syndrome frequently, and perhaps always, were of psychogenic origin. He
detailed a case where the symptoms symbolied the normal manifestations of preg-
nancy. It was agreed that such cases should at least be investigated from the
psycho-analytic point of view, this being the only way of satisfactorily determining
the importance of any psychogenetic factors that may be operative. ⑤Dr. A. A. Brill read a paper on ,Anal-Eroticism and Character-Formation*.
He detailed three cases that illustrated in a striking way the reactions to which
Freud has called attention. A long discussion followed on the general significance
of anal-eroticism and the different manifestations it produces.Prof. Ernest Jones read the notes of a Case of Zwangsneurose (to be
published in the forthcoming numer of the Jahrbuch).Dr. G. L. Tanneyhill narrated some interesting instances of dream analyses
and Verschreiben.Dr. R. W. Reed related a very full analysis of a case of hysteria in a young
woman, Amongst other symptoms was a very obstinate nipple-masturbation, which
was shewn to be connected with early fantasies concerning the buttocks, as well
as with a pronounced mouth-eroticism.Prof. Putnam described a Case of Psychic Masturbation in a man of fifty.
He had a remarkable sexual attraction for his daughter, and revelled in various
cruel and sadistic fantasies which constituted the main part of his sexual life.A general discussion, opened by Prof. Putnam, was then held on the sub-
ject of sexual ethics in relation to the advice given to patients. The discussion,
which was chiefly partaken in by Drs Brill and Emerson and Prof. White,
could not be finished on account of the lateness of the hour, the meeting having
already lasted for some ten hours. The next meeting will be held in May 1913.Ernest Jones (Secretary).
Ortsgruppe Zürich.
Sitzung vom 3, Mai.
Dr. C. G. Jung: Die unbewusste Entstehung des Heros (erscheint als Teil
von: Wandlungen und Symbole der Libido im Jahrbuch fiir psychopathologische
und psychoanalytische Forschung).Als neues Mitglied wurde aufgenommen Prof. Dr. 0. Messmer, Rorschach.
Sitzungen vom 17. und 31. Mai und vom 14. Juni.
Diskussion über Psychoanalyse und Pädagogik. Die Diskussion wurde
eingeleitet von den Herren: Dr. A. Maeder, Prof. Osk. Messmer, Pfr. Dr.
0. Pfister, Dir. Dr. E. Schneider. Die Referate der Einleiter werden mit einem
Aufsatz von Dr. C. G. Jung über: Kinderanalyse in einer Nummer der Berner Seminar-
Blätter erscheinen.Sitzung vom 28. Juni.
Dr. F. Riklin: Florentiner Erinnerungen. Es wird der Versuch gemacht,
eine Anzahl Eindrücke und Probleme, welche sich dem Ref. bei einem Ferienaufent-
halte in Florenz aufgedrångt haben, analytisch zu verwerten. Hauptsächlich betreffenS.
104 Korrespondenzblatt.
sie die Religionsgeschichte. Einleitend wird auf die Bedeutung des fruchtbaren
Italiens als Land der Sehnsucht hingewiesen. Nordwärts der Alpen führt diese
Sehnsucht zu Erscheinungen, die oft infantilen Charakter annehmen: Spielerische,
miniaturenhafte Nachahmungen des fruchtbaren und grossziigigen Südens in Archi-
tektur und Gartenbau. Uns nótigt die karge Scholle, unsere Liebe aufs Kleine zu
häufen. Die anfänglich rückwärtsgewendete Sehnsucht nach der Mutter in ihrer
Übertragung. auf Erde, Land und Heimat schafft Bilder von Sehnsuchtsländern von
grosserer Üppigkeit (Vorstellung des Paradieses, z. B. auch durch die Maler der Re-
naissance: Fra Angelico, Gozzoli; Land Kanaan der Israeliten; Fruchtbarkeit
der hellenischen Gefilde der Seligen; Schlaraffenland; alte Schilderungen von Indien
und Amerika). Demgegenüber stehen die Bilder von Orten der Qual und Dürre (vgl.
die matt gehaltene Holle in Fra Angelico’s jüngstem Gericht; die Wüsten und
unfruchtbaren Orte, in der Schweiz z. B. die Torfmoore, als Aufenthalte von Qual
und Unseligkeit, als Hollen oder Hólleneinginge). Die Seligkeitsgebiete tragen auch
Merkmale des Unerreichten, Unerforschten, und führen in vorwärtsgerichteter An-
wendung der Muttersehnsucht zur Migration, Auswanderung, zu Entdeckungen (Geo-
graphie, auch Astronomie), sowohl in der Geschichte der Völker, als beim Einzelnen,
was auch mit Materialien aus der Psychoanalyse zu belegen ist (Beispiel von
Petrarca als Geograph in Burkhardt's „Kultur der Renaissance“). Die Renais-
sance bietet zahlreiche Beispiele, wie bei der Umwandlung der die Mutterimago be-
sitzenden Libido in wissenschaftliche Forschung das libidobesetzte, mythologisch-
religiöse Symbol als Vor- und Durchgangsstufe wichtig ist. Umgekehrt sehen wir
bei einer Regression diese Sehnsucht auf solche Vorstufen der Wissenschaft zuriick-
gehen, in Astrologie, Theosophie u. ähnl.Die imposanten Baudenkmäler von Florenz geben den Anlass, auf einige grosse
psychologische Erscheinungen der Renaissance zurückzugehen: Die Rückwendung
zur Antike, um sie in einer mächtigen Elaboration der Gegenwart dienstbar zu
machen; Hand in Hand damit geht eine analytische Aufschliessung der christlichen
Religion. Solche Wiedergeburtsprozesse mit einer rückwärtsschauenden Konzentration
auf das Alte und einer Elaboration, Regeneration, welche die neubesetzten Werte
erschliesst, ist ein analytischer Prozess der Neuanpassung und lässt sich
nachweisen in der Analyse der Neurosén und Psychosen, in den Heldenmythen an
den Stellen, wo eine grosse Anpassungsleistung zu vollziehen, eine neue grosse Auf-
gabe zu bewältigen ist. Einen solchen Prozess erblickte Dr. Mensendieck in der
Romantik. Die psychoanalytische Therapie folgt nur diesem von der Natur vor-
gezeichneten Umwandlungsprozesse des Untertauchens und Wiederaufstehens. In
der Figur Savonarola’s, mit seinen mystisch-infantilen, andererseits asketischen
und moralischen Idealen im Gegensatz zu der befreienden und explosiven Libido-
evolution der Renaissance, welche die untere und obere Welt zu vereinigen sucht,
verkörpern sich gewaltige Prozesse der Libidogeschichte des Volkerlebens. Diese
Probleme erhalten z. B. einen plastischen Ausdruck in der ,Verbrennung des welt-
lichen Tandes“, wie er bei Burkhardt und in Mereschkowsky's „Leonardo da
Vinci“ geschildert ist. Die Einrichtung der Kinderrequisition führt zu vergleichenden
Betrachtungen über den Infantilismus in der Mystik: Kinderseligkeit in den Be-
richten über Savonarola und Fra Angelico, die mit ihren Novizen und Schülern
spielten; grotesker Infantilismus bei den Wiedertiinfern, welche die biblische Mahnung:
„Wenn Ihr nicht werdet wie die Kinder“ nach dem Buchstaben ausfiihrten (Lutschen,
Herumziehen mit Kinderspielzeug auf der Strasse, ungeniertes Verrichten der Bedürf-
nisse u. dgl.; Beispiel aus St. Gallen). Ref. findet in Italien noch eine Reihe von
Überresten liebenswürdiger franziskanischer Kindheitsmystik und glaubt darin auchS.
Korrespondenzblatt. 105
evolutionistisch wichtige Anhaltspunkte für die Wertschätzung des Kindes, wie sie
in der Kinderinquisition sich merkwürdig manifestiert, zu erblicken.Von Savonarola und der Renaissance zurück führt eine entwicklungs-
geschichtliche Betrachtung der italienischen Mystik zu deren Hauptvertretern im
Mittelalter, vor allem zu Franz von Assisi, Wir verfolgen ihn besonders vom
Punkte seiner Bekehrung an, nach Gebhardt (L'Italie mystique) und vor allem
nach Sabatier, welcher so gut versteht, der umbrischen Landschaft ihren Anteil
bei der Umwandlung des Heiligen zuzusichern, wo er, mit ehrgeizigen und etwas
phantastischen Ansprüchen an das Leben enttäuscht, sich in einem längeren Um-
wandlungsprozesse zur Religion und zur Verherrlichung der Geschöpfe, zur Natur
wendet, dem Vater vor dem Bischof schroff absagt und zur mystischen Vereinigung
und Identifikation mit Christus gefihrt wird. Von grossem analytischem
Interesse ist die Stigmatisation durch den (sich selbst opfernden) Gekreuzigten
der in der Vision mit äusserst interessanten libidosymbolischen Attributen (Flügel etc.)
erscheint. Die Flügel der Christusvision des hl. Franz erwecken den Vergleich
mit der überaus reichen Gestaltung dieses archaischen Libido- und Seelensymbols in
den Bildern von Fra Angelico. Durch den ganzen Franziskanismus geht in der
Folge die Tendenz, die Christusidentifikation des seraphischen Heiligen auszubauen
und ihn zu einem gottgleichen Mittler zwischen Mensch und Gott zu gestalten. Es
wird die religions. und libidogeschichtliche Bedeutung des , Mittlers“ gestreift
(Mithras, Christus),Diese „Mittler“ kommen in der religiösen Libidogeschichte verschiedengestaltig
immer wieder vor. Dieterich (Mithrasliturgie) führt aus, dass die mystische Ver-
einigung mit der Gottheit, fiir die wir mit einigen Einschränkungen unser Unbewusstes
setzen dürfen, zustande komme durch das Symbol des Essens des Gottes-Libido-
symbols oder der Sexualvereinigung, oder durch das Kindschaftsverhåltnis, Der
Myste ist durch eine symbolische Geburt aus der Gottheit unsterblich und göttlich
(mystische Adoptions- und Aufnahmeriten). Die Sohnsgottheit (Mithras, Christus,
Logos) wird wieder zur Hauptgottheit, und durch die mystische Wiedergeburt sind
wir selbst Gottessóhne und gottgleich. Von hier aus gelangen wir zum Begriff der
Bruder- und Schwesternsehaft im Mysterium. Der Mittler ist auch Seelenführer
(Wegzehrung, Kommuniongebete).Nicht in Franziskus selbst, aber in seinen Vorgingern und Nachfolgern
spukt neben der Mystik und Ekstase das Prophetische, eine von den anderen
Manifestationen des Unbewussten untrennbare Funktion, die wir bei Savonarola
wiederfinden, mit Ideen vom Weltuntergang und dem neuen ewigen Evangelium, Im
Gegensatz zur kirchlichen Hierarchie und starren Dogmatik schufen die Bettelorden
ein demokratisches Münchstum. Es wird auf die Bedeutung der Kloster als Zu-
fluchtsorte gegenüber der Rauheit der politischen Kämpfe, die in den merkwürdigen
Festungsbauten (San Gimignano) nachklingt, verwiesen als Rettung vor der Wirklich-
keit. Ein Besuch in der Certosa di Galuzzo (Karthäuserorden, vom hl. Bruno ge-
gründet) gibt einen sehr instruktiven Einblick in diese alten ,Introversionsanstalten”.Mit der Tendenz, das Dogmatische hintanzusetzen, und mit der unmittelbaren
mystischen Gottesgemeinschaft und Übertragung der Liebe auf Natur und Geschöpfe
gebiert die mystische Renaissance auch theatralische Darstellungen, die geist-
lichen Mysterien, die den antiken kultischen Mysterien wieder sehr ähnlich
sind: und neben dem Hauptmysterium der Kirche, Abendmahl und Messe mit ihrer
Symbolkontamination, Aufnahme im Organismus der Kirche gefunden haben. Kult
und Theater gehörten ursprünglich zusammen (Schröder). Ref. verweist auf solche
Überreste geistlicher Mysterien: Krippenspiele, Passionen und andere in ursprüng-Zentralblatt für Psychoanalyse. 1113, 8
S.
106 Korrespondenzblatt.
licherer Form, die den antiken Mysterien gleichen (Analyse des ,Scoppio del Carro“
in Florenz und eines Auferstehungsmysteriums in der Kathedrale von St. Gallen).Unterhaltungen mit einem in Florenz lebenden Schweizer Künstler führten zu
Betrachtungen über die libidinôse Wertung und Entwicklung rhythmischer
Verhältnisse in Form und Farbe, ferner des Materials (Verwendung
kostbarer Materialien: Gold, Kobaltblan, wertvolle Steine, Mosaiken) in den byzan-
tinisch beeinflussten Werken der Florentiner Künstler. Das Schwelgen in Farben ist
ein Luxus, ein Ausleben im Lichte. In der Hölle sind keine Farben bei den Bildern
von Fra Angelco. Im Himmel ist der ewige Glanz "und die ewige Anschauung
Gottes. Die Qual und Strafe fiir das regressive und verbotene Schauen ist die
Blendung (Ödipus).. Luxus ist da, wohin von anderen Stellen, durch Verdrängung
und Regression, Libido hineingelegt wird (Analyse des Traumes einer Dame, die
einen Kult nnd Luxus des Lichtes trieb).Eine Betrachtung der kiinstlerisch dargestellten Motive, wie sie einem beim
Besuch der Kirchen und Galerien auffallen, führt zur Entdeckung, dass vor allem
libidogeschichtlich wichtige Motive in christlichem und heidni-
schem Gewande quantitativ am meisten zur Darstellung gelangen,
z. B. das Motiv der Annunziata in allerhand Variationen (auf einer Vorstellung
in 8, Gimignano wird das Geheimnis belauscht). Dieses Motiv wird in der gleich-
zeitig wundertätigen Annunziatakirche besonders kultisch verehrt; es flossen reiche
Geschenke aus wertvollen Materialien; der Altar ist versilbert; das mystische, kerzen-
beleuchtete Halbdunkel der Kirchen begünstigt die Elaboration des Unbewussten (man
denkt an die lekanomentischen Versuche Silberer’s). Die Renaissance nimmt das
Parallelmotiv der Leda mit dem Schwan wieder auf. Es wird erwähnt, dass dieses
Kultmotiv der wunderbaren Zeugung und Geburt des Helden auch im Gebet eine
hervorragende Stellung einnimmt (Ave Maria und kontaminiert im dreiteiligen und
täglich dreimal gebeteten Angelus). Merkwürdig ist die Verhüllung des wundertätigen
Annunziatabildes in Florenz; es wird erinnert an die Verhüllung des Sanctissimum
in der katholischen Kirche und verglichen mit den mythologischen Motiven, die das
Schauverbot und die Verhüllung zum Gegenstand haben, ferner mit den parallel-
gehenden Berührungsverboten des Tabu. So treffen wir immer wieder Wunder- und
Zauberkraft einerseits und Schranke andererseits beisammen, als Grunderscheinungen
der Libidogeschichte.Die Parallelisierung christlicher und heidniseher ,Libidomotive“ (Annunziata
und Leda) wird von Mereschkowsky (Leonarda da Vinci) reichlich unterstrichen
(Erschrecken Boltraffio's beim Vergleich der Madouna und Venus von Ghirlan-
dajo, von Christus rsp. Johannes und Bacchus Leonardo's).Weitere Motive, die als Zustandsbilder der Libido Verehrung und Kult ge-
niessen, finden wir in der biissenden Magdalena (z. B. die eindrucksvolle Statue im
Baptisterium, von Bonatello), dem hl. Sebastian und dem heidnischen, geschundenen
Marsyas. Nicht die sadistisch-masochistische Komponente ist hier von erster Be-
deutung, sondern das Problem des Verzichtes, des Opfers, der Unerlästheit. Es wird
auf eine Reihe Mitteilungen verwiesen, die uns Dr. C. G. Jung bei verschiedener
Gelegenheit über diese Fragen gemacht hat.Von hier aus werden die vielen Martyriondarstellungen in der christlichen
Kirche, die Passionsbilder, die Anziehungskraft des sog. „schmerzhaften Rosenkranzes“
und der ,Stationsandachten“ verständlich, und die Heiligenlegende wird uns bei dieser
Betrachtungsweise weitere Råtsel låsen.In den Zellen des Klosters von S. Marco überraschen uns die mystisch-
intimsten Fresken von Fra Angelico mit religions- und libidosymbolisch bedeut-
samen Motiven: Zarte Verkündigungen, Geburt Christi (mit dem totemistischen OchsS.
Korrespondenzblatt. 107
und Esel), Grablegung und Beweinung Christi, Transfiguration, Auferstehung, Jesus
erscheint Magdalena, Abendmahl, Einsetzung der Eucharistie, Hollenfahrt Christi,
Jesus und zwei Dominikaner. Die kontemplative Verbindung mit den dargestellten,
teilweise sehr archaisch anmutenden Motiven, mit ihren zahlreichen Parallelen aus
der Individual- und vergleichenden Analyse, ist meist sehr hübsch charakterisiert
durch einen anbetenden Mönch auf dem Bilde.Fiesole, mit seinen etruskischen und römischen Überresten, illustriert u. a.
drei Dinge in eindrücklichster Weise: Erstens die Verkörperung des Franziskanismus
im kleinen Kloster und der Landschaft, zweitens die Kultsukzession auf Grund innerer
Gleichwertigkeit des Motivs, besonders in der aus einem Dionysosheiligtum direkt
hervorgegangenen christlichen Ambrosiuskirche, drittens den Kultkonkretismus des
römischen Altertums. Im kleinen Museum ist eine kultische Skulptur von Isis und
Osiris aufbewahrt, die ein Veteran aus Ägypten in seine Heimat gesandt hat, damit
dort die ägyptische Mysterienreligion mit dem schönen Beweinungs- und Auferstehungs-
motiv ein Denkmal finde; eine Illustration zu F. Cumont’s Buch über die orien-
talischen Religionen im römischen Heidentum,Im Florentiner archäologischen Museum finden wir in konkreter
Darstellung eine Menge archaischer Symbolismen: Phallische Lebens- und Unsterb-
lichkeitsdenkmiler als Grabsteine, antropomorphe Aschenurnen, z. T. angetan mit
palingenetischen Symbolen; die Urnen sind zur Auszeichnung auf irdene und bronzene
Sitze gestellt; in manchen Urnen finden wir irdene Symbole von Gebrauchsgegen-
stinden und Spielgeräte, Dokumente des etruskischen Totenkults, dessen
Analogien mit ägyptischen und mykenischen Anschauungen sofort auffallen. Die
ganze libidogeschichtliche Bedeutung dieser Totenkulte erfährt im Angesichte dieser
Dokumente eine eindrucksvolle Belebung. Nichts ist für die Symbolgeschichte über-
zeugender als diese visuelle, plastische Wirklichkeit der Dokumente. Sehr schön
ist die Urne mit der Darstellung der Todesgöttin Matuta, ein Pietämotiv, von dem
Jung in „Wandlungen und Symbole der Libido“, II. Teil, eine Abbildung und ana-
lytische Aufklärung in einem grösseren Zusammenhange bringt.Von grossem Reichtum an kultischen Dokumenten ist auch die ägyptische
Abteilung des Museums. Als Beitrag zu Rank’s „Mythos von der Geburt des
Helden“ sei eine grosse Plastik erwähnt, Die göttliche Kuh Hathor säugt den
Pharaon Horemheb. Es wird kurz verwiesen auf die Beziehungen dieses Motivs aus
der Heldengeschichte zum Totemismus.Den Schluss der Darstellung machen Abbildungen aus dem Camposanto
in Pisa, besonders des „Inferno“ von Andrea Oscagna, eine Sammlung
libidogeschichtlicher Symbole mit allerlei infantilen und archaischen Darstellungen
der gequälten Libido. In diesen äusserst realistisch dargestellten Szenen, die ihrer-
seits wieder an Dante erinnern, erkennen wir die Unmittelbarkeit und Realität, in
der im religiösen Mittelalter diese Symbolik noch erlebt wurde. Als Qualformen be-
merken wir u. a. die Anal- und Umbilikalgeburt aus dem feurigen Leib des Höllen-
dämons. Man erinnert sich an andere mittelalterliche Höllendarstellungen, welche
als analytische Symbolbelege wertvoll sind, z. В. in Paris und Nürnberg (Strafe der
Geizhälse).Diese kurze Wanderung durch die Florentiner Dokumente lässt uns den un-
goheuren Schatz ahnen, den wir, besonders aus der Religionsgeschichte, für analyti-
schen Gebrauch und Verständnis noch zu heben haben. Jung’s „Wandlungen und
Symbole der Libido“ bilden einen neuen wichtigen Fortschritt in dieser Richtung.(Autoreferat.)
gt
S.
108 Korrespondenzblatt.
Mitglieder-Verzeichnis.
Dr. R. Assagioli, Florenz, Via degli Alfani 46.
Dr. Bertschinger, Schaffhausen, Breitenau.
Dr. L. Binswanger, Kreuzlingen, Bellevue.
Dr. M. Bircher, Zürich V, E 48.
Dr. J. Boéchat, ebenda.
Dr. Buser, Sanatorium Kilchberg bei Ziirich.
Prof. Dr. R. Morichau-Beauchant, Poitiers (Vienne), France, Rue Alsace-
Lorraine 15.
Frau Prof. Erismann, Zúrich V, Plattenstr, 37.
Dr. F. Elmiger, Luzern.
Frl. Dr. E. Fúrst, Zirich, Apollostr. 21.
Dr. К. Gehry, Rheinau.
Frl. Dr. M. Gincburg, Schaffhausen, Breitenau.
Dr. Haslebacher, Ragaz.
Dr. L. Hopf, Aachen, Ass. a. d. Techn. Hochschule,
Dr. W. J. Hickson, Zürich, Plattenstr. 19.
Dr. K. Imboden, St. Gallen, Rosenbergstr. 85.
Dr. Itten, Interlaken, Jungfraustr. 70.
Dr. C. G. Jung, Küsnacht b/Zch., Seestr. 1008.
Dr. E. Jung, Bern, Dihlhčizliweg 16.
Frl. Dr. F. Kaiser, St. Gallen, Notkerstr.
Pfr. Dr. A. Keller, Zürich, Peterhofstatt.
Frl. Dr. Kempner, Sanatorium Kilchberg b/Zch.
Dr. J. Lang, Zürich, Vogelsangstr. 46.
Dr. Loy, Territet.
Dr. A. Maeder, Zürich V, Hofstr. 126.
Dr. 0. Mensendieck, Zürich, Keltensir. 40.
Prof. Dr. 0. Messmer, Rorschach.
Dr. J. Nelken, Paris, Rue de Blainville 9.
Dr. Nunberg, Krakau, Zyblikiewicza 14.
oder Sanatorium Bistrai b/Bielitz, Osterr.-Schlesien.
Dr. J. H. W. van Ophuysen, Zürich, Mittelbergsteig 15.
Dr. Oberholzer, Schaffhausen, Breitenau.
Dr. Pfenninger, Herisau,
Pfr. Dr. O. Pfister, Zürich, Schynhutgasse.
Dr. F. Riklin, Küsnacht b/Zch., Heslibach.
Osk. Rothenhåusler, Zürich, Gloriastr. 70.
Dr. Stockmayer, Kreuzlingen, Bellevue.
Dr. C. Schneiter, Zihlschlacht (Thurgau).
Dir. Dr. E. Schneider, Bern, Kant. Seminar.
Mme. Sokolnicka, Zürich, Susenbergstr. 167.E
Im Anschluss an den Bericht der Ortsgruppe Zürich habe ich noch über fol-
gende Neuigkeiten aus der Schweiz zu referieren.
1. Die Gesellschaft für psychoanalytische Bestrebungen, über
deren Gründung berichtet wurde, zählte am Ende des Sommersemesters 22 Mitglieder.
Vorsitzender ist Dr. Riklin.S.
Korrespondenzblatt. 109
Es wurden folgende Vorträge gehalten :
Dr. Mensendieck: Die Romantiker. (Der Vortrag wurde in der psychoanalyt.
Vereinigung Zürich wiederholt und ist dort referiert.)Dr. van Ophuijsen: L'oiseau bleu von Mæterlink.
H. Oczeret, cand, med:: Freud's Arbeit „Über einen bestimmten Typus der
Objektwahl beim Manne“, an einem Beispiel aus der schönen Litteratur erläutert.
(Analyse des „schlimmheiligen Vitalis“ aus den sieben Legenden von Gottfried Keller.)0. Rothenhäusler, dipl. pharm.: Referat über Jung's ,Wandlungen und
Symbole der Libido“, I. Teil.H. Oczeret, cand. med.: Aus der Mythologie der Indianer Nordamerikas.
(Hiawatha).Dr. Riklin: Florentiner Erinnerungen. Zwei Abende. Wiederholt und referiert
in der Ziiricher psychoanalytischen Vereinigung.O.Rothenhiusler, dip. pharm. : Der Libidobegriffin Nie tsch e's „Ecce Homo“,
Frl. Antonia Wolff: Weibliche Odipusprobleme (Elektra etc.).
Frl. Else Sumpf: Niels Lyhne von P. Jacobsen.
2. In der Arztegesellschaft St. G allen wurden im Laufe des letzten Jahres und
gegenwärtig orientierende Referate über Psychoanalyse gehalten von den dort wohnen-
den Mitgliedern Dr. Imboden, Frl. Dr. Kaiser und Dr. Pfenninger (Herisau).8. Herr Pfarrer'A. Keller in Zürich bearbeitet einen Artikel „Psychoanalyse“
fur „Die Religion in Geschichte und Gegenwart* (Tibingen, Verlag
J. ©. В. Mohr).4. Dr. C. G. Jung hilt im Oktober Vorlesungen über Psychoanalyse an der
Fortham University in Newyork.5.No.27 des ,Korrespondenzblatt für Schweizer Ärzte“ enthält eine
praktische Orientierung, fiir unsere Verhältnisse bestimmt, unter dem Titel: „Über
Psychoanalyse“ von Dr. Riklin.6. In der ,Neuen Züricher Zeitung“ vom 20. Juni brachte. der Züricher Dichter
Konrad Falke eine Kritik der Vorstellung des „König Ödipus“ und „Hamlet“
mit Moissi als Darsteller. Der Kritiker wies darauf hin, wie das Publikum den ana-
lytischen Problemen in der direkten Form künstlerischer Darstellung zugänglicher
sei als auf dem Wege der verstandesmüssigen Diskussion. Einem Angriffe folgte
eine Entgegnung, welche darzulegen versuchte, dass die analytische Beherrschung
des künstlerischen Vorwurfs dem ästhetischen Genuss in keiner Weise nachteilig
werden könne.Die Wiederaufnahme der Diskussion in der Öffentlichkeit wurde von Dr. Riklin
als Anlass benutzt, in der Zeitschrift „Wissen und Leben“ (Heft 20, 15. Juli 1912,
Verlag von Rascher u. Co. Zürich) einen aufklårenden Aufsatz ,Ódipus und
Psychoanalyse“ zu schreiben, allerhand Vorurteilen über die analytische Arbeit
entgegenzutreten und das Ödipus- und Inzestmotiv in seine kulturhistorische Be-
deutung einzusetzen.7. Das Erscheinen der „Imago“, Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse
auf die Geisteswissenschaften, hat in der Bücherbesprechung verschiedener Zeitungen
Beurteilungen der Psychoanalyse ausgelöst, z. B. in der „Züricher Post“ vom 29.
April, wo die erste Nummer ausführlich referiert ist. Es geht daraus zum mindesten
ein sehr lebhaftes Interesse jener Kreise, an die sich die Zeitschrift wendet, an unseren
Forschungen hervor; demgegenüber wollen wir gerne manche, auf ungenügender
Kenntnis, konservativer Ängstlichkeit und teilweise unserer eigenen Unvollkommen-
heit beruhende schiefe Auffassung vorläufig in Kauf nehmen.8. Das ,Korrespondenzblatt für Schweizer Ärzte“ bringt in No. 25,
26 und 27, Sept. 1912, im Bericht über die Versammlung der Schweize-S.
110 Korrespondenzblatt.
rischen Neurologischen Gesellschaft in Lausanne, 4 und 5. Mai,
das Referat über einen Vortrag von de Montet, Vevey: Der gegenwärtige
Stand der Psychoanalyse von Freud!) mit anschliessender Diskussion.No. 28 der gleichen Zeitschrift berichtet tiber einen Vortrag unseres Mitgliedes
Dr Ewald Jung in Bern: ,Über. die psychoanalytische Behandlung nervčser
Leiden“, mit anschliessender Diskussion.Diskussionsredner und Meinungen sind an beiden zitierten Stellen teilweise
die nämlichen, so dass wir sie zusammenfassend betrachten können,Seit Jahren hatten die schweizerischen Psychoanalytiker im „Verein schweiz.
Irrenärzte“ eine Stätte gefunden, an der eine Darstellung ihrer Arbeiten und Mei-
nungen möglich war, ohne von einer unfruchtbaren Obstraktion gelähmt zu werden,
wofür man unter den obwaltenden Umständen dankbar sein musste, Die Zusammen-
setzung und Leitung des vor einigen Jahren gegründeten schweiz. Neurologenvereins
liess kaum ein so grosses Entgegenkommen erwarten, weshalb sich die Psychoana-
lytiker an dieser neuen Organisation weniger beteiligten. Nun scheint die Situation
des Tages auch dort die Diskussion der Psychoanalyse durchzusetzen. Der Vortrag
und die Diskussion in der Berner und anderen Ärztegesellschaften spricht für das
an allen Orten den neuen Problemen dargebrachte Interesse.Der Ertrag der in den Diskussionsberichten dargelegten Kritik ist für uns
Jeider ein geringer, während wir zwischen den Zeilen psychologisch interessante
Neuigkeiten herauslesen.Es fehlt bei den meisten Diskussionsrednern am Verständnis des aus den
psychologischen Manifestationen und ihren genetischen und quantitativen Beziehungen
abstrahierten Libidobegriffs mit den Eigenschaften von Fixirung und Regression.
Darum wird z. B. so häufig der Ausdruck „Ubertreibungen der Fre n d'schen Lehre"
angebracht, wo die Umwandlung der Sexualmanifestation der Libido in eine andere
nicht verstanden wird. Auch die Entfaltung der psychischen Manifestationen auf
der Basis des psychisch wahrnehmbaren Aquivalents des Trieblebens scheint noch
nicht durchzudringen. Den Aussagen iiber den therapeutischen Wert und Unwert
der Psychoanalyse darf man darum sehr wenig Bedeutung beimessen, da aus den
Voten zur Evidenz hervorgeht, dass die wenigsten der Herren Diskussionsredner die
Methode wirklich zu handhaben verstehen und handhaben. Dafür zeugen die fol-
genden merkwürdigen Ausserungen (zitiert nach dem Referat):„Man muss der Psychoanalyse ihren Charakter als Hilfsmittel der Diagnose
bewahren, obwohl sie bei Anwendung echt Freud’scher Methodik nur fragmenta-
rische Resultate liefern kann. Diese Methode stellt einen Sondenwurf in die Tiefen
unseres Gewissens dar; allein wie die Sonde nur eine Stichprobe der Fauna des
tiefen Meeresgrundes heraufbefördern kann, so kann uns die Psychoanalyse nur über
einzelne Episoden des psychischen Lebens eines Individuums aufklären“;Oder: „Die natürliche Konversation, in der Form, wie sie z. B. Dubois an-
wendet, führt diagnostisch und therapeutisch weiter, als die schulmässige Assoziations-
prüfung oder das freie Drauflossprechen und die Psychoanalyse nach Freud (end-
lose Aufzeichnung der Träume etc.)*.Darum ist auch die Behauptung, dass man die meisten Fälle ohne Psycho-
analyse vorteilhaft behandeln könne, sehr skeptisch aufzunehmen; namentlich, wenn
man nachträglich erfährt, dass mancherorts die Rücksicht auf die Sanatoriums-
Klientel die analytische Behandlung verbietet und dazu führt, sie nur geheimer-
weise anzuwenden, ohne dem Kranken gegenüber Farbe zu bekennen. Solche Er-
scheinungen werden allerdings verschwinden, wenn sich die Klienten selbst orientieren
und vom Arzte analytische Kenntnisse verlangen.1) Referiert von Dr. Maeder in der letzten Nr. des Zentralblattes,
S.
Korrespondenzblatt. 111
Recht unangenehm berühren die Zitate von „bedenklichen Misserfolgen* durch
die Psychoanalyse, die gegen dieselbe ausgebeutet werden. Mau wolle uns nicht
reizen, den Stiel umzudrehen und die grosse Satyre zu schreiben.Die „wilde Analyse“, das Kurpfuschertum, ist von den Analytikern stets
desavouiert worden. Aber ebenso unpassend ist die Analyse in der Hand des un-
kundigen und analytisch nicht ausgeglichenen Arztes. Über die analytische Be-
tütigung des psychologisch erfahrenen wohlgeschulten Nichtmediziners unter ürztlicher
Kontrolle mag man diskutieren. Die psychoanalytischen Kenntnisse sind noch
anders zu verwerten, z. B. in der Pädagogik, als in Form der therapeutischen Neurosen-
behandlung.Anderen, der Unkenntnis entspringenden alten Einwünden wollen wir die
Ehre der Erwähnung nicht antun.Die Gefährlichkeit, wie die Vorteile, teilt die Psychoanalyse mit anderer
Therapie. Das Messer der Chirurgen und die Apotheke sind für den Unkundigen
sehr geführlich.Schade, dass solche Kritiken sehr selten jene Stellen treffen, wo wirkliche
Lücken und Unvollkommenheiten sind. Das wire viel weniger monoton und sehr
verdienstlich, würde aber von den Kritikern viel grüssere Vertiefung verlangen, als
sie gerade in dieser Richtung vorhanden zu sein scheint. Doch haben einige der
Diskussionsredner mit viel Sachverstündnis argumentiert, beispielsweise Veraguth
(Zürich) der unter anderem darauf hinweist, dass die theoretische Bewertung der
Freud'schen Lehren als Ganzes philosophische und psychologische Kenntnisse
und Fühigkeiten voraussetze, die uns in der Mehrzahl unsere bisherige allgemeine
und besonders unsere medizinische Bildung wohl nur recht bruchstückweise ver-
liehen habe.Dubois gesteht der Schule Freud's nur zwei Verdienste zu: Die psycho-
logische Betrachtungsweise des Normalen, der Neurosen und Psychosen, die Paranoia
nieht ausgeschlossen; es habe Mut dazu gebraucht, denn die Erfolge der Anatomie
und Hirnphysiologie hatten die Psychologie so ziemlich in Vergessenheit geraten
lassen. Das zweite Verdienst beruhe darauf, die Aufmerksamkeit auf die Wichtig-
keit der sexuellen Emotionen gelenkt zu haben, entgegen einer pharisäischen Prüderie.
Was er weiterhin über Übertreibung und moralische Gefahr usw. spricht, zeugt für
geringen Kontakt mit der Anschauung und Praxis der Analytiker und lohnt keine
weitere Diskussion. Charakteristisch ist sein Schlussvotum: „Ich mag meine Kranken
examinieren so viel ich will, ich entdecke nichts Unbewusstes bei ihnen. Ich stosse
auf Vergessenes, sowie auch auf Dinge, die verheimlicht werden, und zwar aus guten
Gründen. Ich sehe sonderbare Ideenassoziationen, die von fehlerhaften „Wertungen“
Zeugnis ablegen. Und wenn ich die Geistesverfassung meines Kranken genügend
kenne, so habe ich nur noch durch eine sokratische Dialektik dasjenige zu korri-
gieren, was mir schadhaft erscheint. Ich weiss wohl, dass Sokrates heutzutage nichts
mehr gilt. Man steinigt ihn, nachdem man ihm den Schierlingsbecher gereicht.
Und dennoch war er im Recht.“Für uns sind derartige unbewusste „Konfessionen“ unserer Kritiker (ich erinnere
an frühere von Hoche und К. Mendel und einige Schweizer ,Bekenner“) lehr-
reicher und in der Form sympathischer als lange Entgegnungen in wissenschaftlicher
Terminologie. Haben wir übrigens etwas gegen Sokrates? Aber wenn wir es mit
den alten Philosophen halten, so können wir uns eben nicht mit Sokrates begnügen.
Ein anderer Votant, Leclere, weist darauf hin, eine vollständige Geschichte der
Psychoanalyse müsste mit einem Wort über die Lehre des Pythagoras beginnen.
Gewiss, aber ich müchte weder bei Sokrates noch Pythagoras stehen bleiben, sondern
ein umfassenderes Studium antiker Psychotherapie vorschlagen. Vielleicht würdenS.
112 Korrespondenzblatt.
manchem die Augen geöffnet, welche überraschende Dokumente zugunsten unserer
modernen psychoanalytischen Therapie im alten Griechentum, in dessen Religions-
geschichte, Philosophie und Psychotherapie liegen, welche Schönheiten dort zu ent-
decken sind. Aber man müsste sich mit Universalität und Liebe an den Gegenstand
begeben. Die Religions- und Philosophiehistoriker machen uns heutzutage dieses
Studium ja nicht mehr allzaschwer.Das Votum des Herrn Claparéde ist, wie das von Veraguth, von er-
freulichem Verständnis, wenigstens für die prinzipiellen Fortschritte der psychoana-
lytischen Betrachtungsweise. Schade, dass Herrn Claparède die Initiation in die
Handhabung der Materie nach seiner Aussage so schwer füllt. Vielleicht bekäme er
eine befriedigendere Antwort, wenn er seine Träume statt dem Plenum dieser Ver-
sammlung einem Analytiker zur Deutung vorlegte.Dem schon oft wiederholten Bedauern des Herrn Veraguth, dass auch dies-
mal die unentwegten Anhänger der Freud'schen Lehren sich von der Gelegenheit
zu einer sachlichen Diskussion (gemeint ist im schweizerischen Neurologenverein)
fernhalten, und so die Verteidigung der Psychoanalyse den Outsidern überlassen
werden müsse, ist ungefähr folgender, früher auch schon geäusserter Standpunkt
entgegenzuhalten :Wir scheuen nicht Diskussion und Kritik, wohl aber die Unfruchtbarkeit der
Debatten in einer Umgebung, die von vorneherein, aus Griinden, die sich zum voraus
bewerten lassen (Unkenntnis, schlechte affektive Einstellung, Unmöglichkeit wesent-
lichen Neuerwerbs und Verlust der Elastizität des Umdenkenkönnens), ein schlechtes
Augurium für das Diskussionsresultat abgeben. Es führt dann nur zum trostlosen
Vorbeireden, wofür zahlreiche Beispiele schlechter Denkschulung bei Anlass der
grossen Kongresse zur Verfügung stehen würden.Die Psychoanalyse verlangt eine seriöse Durcharbeitung im Detail, die ernste
Diskussion auf Grundlage des Erfahrangsmaterials zu zweit oder in kleineren Kon-
ventikeln, damit man sich auch über den Umfang und die Bedeutung von Begriffen
und Ausdrücken einigen kann. Erst auf dieser Basis wäre die Diskussion auf Kon-
gressen mit Erfolg möglich. Wir haben diese Lehre gezogen und uns entsprechend
organisiert; vorerst war das wohl, wie die Erfahrung zeigt, der einzig gangbare Weg
zu fruchtbarer Fortarbeit.Wo die Bedingungen gegeben sind, treten wir gerne in die Offentlichkeit, und
am weitesten Entgegenkommen jenen gegeniiber, die sich eingehend und bequem in
miindlicher Unterredung orientieren wollen, hat es gewiss nie gefehlt. Die Zeit wird
ergeben, wo es sich lohnt, in die Arena zu treten, Es sind ja viele Anzeichen zu
erfreulicher Wendung der Dinge vorhanden.Die Diskussion des Vortrages von Dr. Ewald Jung im Berner Årzteverein
steht auf einem entschieden niederen Niveau als jene in der schweizerischen Neuro-
logengesellschaft, offenbar dank schlechterer Orientierung der Teilnehmer. Es wird
gar vieles ins Leere hinaus behauptet, was von schlechter Kenntnis der Materie
spricht. Doch ist der Ton ein objektiverer geworden. Amiisant wirkt nur eine Be-
merkung Schnyder's, „dass die Psychoanalyse mit dem germanischen Geiste, mit
seiner tiefgreifenden, oft dunklen und träumerischen Sensibilität, seiner regen lyrischen
und mytbischen Produktivitåt, seiner reichhaltigen, plastischen Sprache, in innigem
Zusammenhang steht. Er glaubt behaupten zu können, dass die Psychoanalyse in
den Låndern lateinischer Kultur nie festen Boden fassen wird, weil sie mit dem
lateinischen Geiste in Widerspruch steht; nicht etwa, wie man ihm oft vorgeworfen
hat, wegen einer vermeintlichen Oberflichlichkeit, sondern wegen einem unverkenn-
baren Triebe nach einfachen und klaren Ausdrucksformen der Ideen und Gefiihle
ohne symbolische Umhiillung“.S.
Korrespondenzblatt. 113
Diese Vermutung, die auf Rassenunterschiede abstellen will, ist wohl zu naiv.
Nach unserer Kenntnis des lateinischen Geistes, der der Psychoanalyse durch die
Hochhaltung psychologischer Traditionen in der Psychopathologie wesentlich Vor-
schub geleistet hat (es sei nur erinnert an Janet, Flournoy und die Erforscher
des Hypnotismus), haben wir von diesem Geiste noch sehr schône Früchte zu er-
warten, sobald einmal die praktischen Grenzen der Sprache und der Gesetze der
Verbreitung der Ideen von entsprechenden Kulturzentren aus, die ihrer Tradition
folgen, überschritten sein werden. Die französische Literatur aus den Gebieten der
Archäologie und Religionsgeschichte lässt darauf schliessen, dass wenigstens in dieser
Schicht von Gelehrten der Boden fiir die Aufnahme psychoanalytischer Betrachtungs-
weise gut vorbereitet ist. Bemühungen, das Terrain zu gewinnen, sind im Gange.
In Italien denken die psychiatrischen Kreise allerdings noch sehr anatomisch. Eine
Unterredung mit Dr. Assagioli in Florenz überzeugte mich von diesem Zustand
der Dinge von nenem.9. Am 7. September hielt der Verein schweizerischer Irrenärzte seine
Herbstversammlung in Zürich ab, vorgängig dem Kongress des Internationalen Vereins
für medizinische Psychologie und Psychotherapie. Mit Rücksicht auf diesen Kongress
beschränkte sich der Verein auf eine Sitzung mit drei Vorträgen; zwei davon betrafen
psychoanalytische Probleme.Dr. Hans Schmid (Cery bei Lausanne) sprach über „Bewusste und
unbewusste Motive der Brandstifter“. Um einwandfrei urteilen zu können,
verarbeitete der Vortragende das grosse Material von 426 alten und neuen psychiatri-
schen Gutachten und Gerichtsakten über Brandstifter. Mit Hilfe dieser gleichsam
statistischen Methode kam er zu dem ihn selbst überraschenden Resultat, dass die
psychoanalytisehe Auffassung der pathologischen Brandstiftung als regressiver Ersatz-
handlung für die Sexualhandlung überall zu bestätigen sei. Es zeigte sich beim
Vergleich der angegebenen Motivierungen der Tat, dass sie durchwegs teilweise oder
totale Rationalisierungen (Jones) des unbewnssten Motives darstellen, ein Ergebnis,
das man in dieser Ausdehnung kaum zu erwarten gehofft hätte,Die Diskussion, an der sich auch Dr. Adler aus Wien beteiligte, machte es
fühlbar, dass der von der Abstraktion aus einer bestimmten, speziellen Betrachtungs-
weise gewonnene Begriff des „männlichen Protestes“ gerade für solche symptomatische
Trsatzhandlungen nicht besonders glücklich ist. Er erfolgt offenbar ursprünglich aus
der Verallgemeinerung des Neurosenbegriffs aus dem Vater-Sohnproblem heraus. Die
Libido als treibendes, schaffendes Prinzip kann als solches natürlich immer als
männlich bezeichnet werden; „Protest“ für die unvollkommenere, regressive Hrsatz-
handlung klingt für diese Fälle entschieden zu tendenziös und teleologisch, und zu
wenig deskriptiv. Wenn man diese speziellen Begriffe in ihrer Verallgemeinerung
anwenden will und sich über ihren Umfang verständigt, kann man natürlich auch so
sagen. Dadurch wird ihnen aber gerade der besondere Charakter genommen, der im
Terminus liegt,Dr. Riklin sprach über Psychoanalyse und Religionsforschung,
Er beginnt mit einer kurzen Übersicht der analytischen Vorarbeiten auf diesem
Gebiet und gedenkt der vielen Anregungen, die er in letzter Zeit besonders
C. G. Jung zu verdanken hatte. Wir bergen unter der Oberfläche ein weniger ent-
wickeltes, symbolisches, archaisches Denken, dessen Analogien mit dem religiösen
und mythologischen Vorstellungsmaterial besonders bei der intensiv regredierenden
Schizophrenie in den Vordergrund treten. Aus den geschichtlich belegbaren Wand-
lungen des Denkens erkennen wir eine Anpassung mythologischer Betrachtungsweise
der Welt an die Wirklichkeit, so dass aus Mythologie Wissenschaft wird. Nachdem
C. G. Jung in früheren Versammlungen des Irrenärztevereins öfters mythologischeS.
114 Korrespondenzblatt.
und religióse Kontexte zu den Traumbildungen (besonders auch der Kinder) aufge-
wiesen hat, liess sich die Traumfunktion nicht nur auffassen als eine mit ülterem
und infantilen Material dargestellte Wunscherfüllung von etwas Unerledigtem, Uner-
reichtem oder Verdriingten, sondern ebenfalls als gleichsam mythologische Vorstufe
zu bewusstem und angepasstem Denken und Handeln, als Programm. Teleologische
Funktionen des Traumes und Unbewussten hat Maeder in einem Vortrag im Schosse
des Vereins vor Jahresfrist erörtert, und in den Arbeiten Silberer's (die funktionale
Kategorie) finden wir analoge Auffassungen, Im Laufe einer analytischen Kur ent-
decken wir die fortwithrenden Umwandlungen der Libidosymbole in den Traumfolgen,
bis eine Gestaltung erreicht ist, welche einen Anpassungsversuch an die Wirklichkeit
gestattet. Es gibt in der Kulturgeschichte Epochen, welche sich in besonderem Masse
durch eine Verlagerung der Libido in dem Sinne auszeichnen, dass aus dem Reservoir
mythologischer und religióser Denkformen Neuanpassungen an die realen Vorgünge
und Aufgaben geschaffen werden. Ein bedeutsames Beispiel ist die Renaissance, was
das Studium der Renaissancoliteratur und ein Besuch der Renaissancestådte, z. B.
Florenz, in überwältigender Form nahelegen. Die Analyse der Romantik und von
P. JakobsensRoman ,Niels Lyhne* (siehe die beiden Vortrige von Mensendiek
und Sumpf in der ,Gesellschaft für analytische Bestrebungen in Zürich*) bestütigen
z. B. diese Entwicklungsvorgánge.Andererseits zeigt uns die Religionsgeschichte, verglichen mit der Entstehnng
einer Neurose, dass eine Regression auf Früheres, Archäisches, Irreales und Mytho-
logisches im Denken und Handeln dort vollzogen wird, wo eine Weiterentfaltung im
Sinne der Anpassung an neue Lebensstufen, neue Aufgaben und Lebensbedingungen
nicht gelingt. Das zu Erreichende stellt sich unter einem gleichen oder regressiv
ühnlichen Bilde oder Symbole dar wie das Frühere, nun zu Verlassende. Oder viel-
mehr, das regressive Ersatzgebilde ist analog, aber mit schon vorhandenem und
früherem Material aufgebaut. Alle Qualitäten des Ersatzgebildes: z. B. Vorstellungs-
symbol und motorische Reaktion, stammen aus früheren, in der Entwicklung schon
erreichten oder überwundenen Stufen. Dabei ist seine Libidobesetzung eine über-
missige (Gedankenallmacht der Zwangsneurose). Solche regressive Ersatzhandlungen
und Vorstufen für neue Anpassungen sind die Zauber. Jede Lebensunsicherheit er-
zeugt die regressiven Erscheinungen von Aberglauben, Zauber, Ahnung, Prophetie,
Mantik und kultiseher Begehung eines libidogeschichtlich älteren Motivs. Dadurch,
dass die verschiedenen Bestandteile und Qualitäten des Ersatzgebildes aus entwick-
lungsgeschichtlich verschiedenen Etappen zusammengesetzt sein können, lässt sich
auch das in Religionsgeschichte und Neurose so stark hervortretende Inzestmotiv-
der Inzestwunsch resp. die Inzestqual, auffassen als Gebilde, das in dieser Form
oft nur regressives Gleichnis ist für das zu Erreichende. Das Inzestinterdikt würde
damit nur Gleichnis, und nicht reale Basis der Neurose.Die Religionsgeschichte lehrt uns verstehen, dass die ältesten Interdikte wohl
nicht &ussere Verbote, sondern innere Anpassungsschwierigkeiten sind. Die meisten
unserer Polizeiverbote wollen ja auch vor Gefahr schützen. Die modernen Moral-
verbote sind nur mehr oder weniger zweckmiissige Endentwicklungen eines Systems,
dessen Anfünge in primitiven Anpassungsschwierigkeiten bestehen. In den Gebilden
der Neurose wird das, was man nicht anzufassen wagt, unter dem Bilde des
moralisch Verbotenen dargestellt, gleichsam um die Furcht vor dem Handeln durch
ein glaubwürdiges Interdikt zu motivieren. Auf diesem Prinzip beruht der Vorwurf
der Inmoralitát gegenüber der Psychoanalyse.Demgemiiss sind Schuldgefühl, Minderwertigkeitsgefühl, Angst, Empfindungs-
und Reaktionsgebilde, die ganz alt sind und mit moderner Moral noch gar nichts zuS.
Korrespondenzblatt. 115
tun haben. In diesem Sinne, als regressive Reaktionen, figurieren sie in der Psychose,
Neurose, Religion.Das äussere Verbot hat als Vorliufer das innere Nichtwagen, Nichtvermägen.
Das moderne ,ich darf nicht“ (= es ist verboten) hat seine Verwandten in ,Y dare
not“ und im schweizerdialektischen und mittelhochdeutschen „I tar nid“, d. h. ich
wago nicht. Die Polizisten der Träume, als Pendant zum Engel mit dem flammen-
den Schwerte, der das Paradies hütet, erweisen sich oft als Personifikationen der Angst,
des Nichtwagens, Innere Entwicklungshemmnisse oder äussere objektive Schwierig-
keiten ergeben die gleichen psychologischen Bilder und primären Reaktionen: Angst,
Schuldgefühl und ähnliches, und die gleichen Kulte und regressiven Gebilde, Sexual-
und Todesangst vereinigen sich an dieser Stelle. 。Dies ist also die regressive Bedingung fir das Zustandekommen religiöser
und mythologischer Bilder, und, soweit die Qualitäten: Realität und motorische
Reaktion in Betracht kommen, der kultischen Begehung derselben.Aus diesen regressiven Gebilden mit intensiver libidinóser Besetzung kann
die Umwandlung zu neuer angepasster Betätigung stattfinden. Diese beiden Funktion-
seiten teilt die Religion mit dem Traume. Nur kommt der kultischen Begehung
Real- und Handlungsqualitát zu, dem Traume nicht. Die neurotischen Ersatzgebilde
sind gewöhnlich der Neuanpassung nicht direkt fähig und bedürfen darum der
weiteren Umwandlung durch die Analyse. Die religiösen Gebilde hingegen können
dieser Umwandlung im Sinne der Anpassung fähig sein. Auch in der Psychose
können wir diese Umwandlungs-, Anpassungs- und Heilungstendenz wahrnehmen.
Man könnte von einem automatisch sich vollziehenden Analysenprozess sprechen,
In weniger ausgesprochener Form sehen wir den Vorgang sich beim Normalen bei
jeder psychischen Umwandlung vollziehen. Diese Umwandlung lässt sich an den
aufgefangenen Träumen sukzessive verfolgen und durch die Traumanalyse klären,
verbessern und wohl auch beschleunigen.(Einen Fall von automatischer Umwandlung und Neuanpassung durch die
Psychose hat Maeder bei Benvenuto Cellini verfolgt (siehe das Referat über
seinen Vortrag im Internationalen Verein für medizinische Psychologie und Psycho-
therapie). Wir wussten nichts voneinander, was beweist, dass diese Dinge nach den
bisherigen Vorarbeiten, besonders von C. G. Jung in der Luft liegen müssen.)Unter den archaischen Symbolen und Bildern des Traumes und der Religionen
interessieren uns vornehmlich jene, welche sich auf den Umwandlungsprozess
angesichts eines Anpassungshindernisses beziehen. Das Freiwerden aktiver Libido
wird gewöhnlich dargestellt durch das Geburtsgleichnis: Ein Libidosymbol mit dem
Merkmale des Lebens der Aktivität kommt aus einem Muttersymbole. Ersteres ist
gewöhnlich entweder Nahrungsmittel, oder phallisch, oder tierisch, oder ein Kind,
Es trägt oft auch noch Abzeichen seiner Abstammung aus einem bestimmten Stadium
der libidinösen Entwicklung. Für das Muttersymbol, das in diesem Gleichnis nötig
ist, geben Religion, Mythos und Märchen eine Menge schöner Beispiele. Wasser,
Krde, Himmel (Luft) und Sonne (Feuer) gehören wohl zu den ältesten und in der
Religion vielverwendeten Mutterschossymbolen.In den rituellen Darstellungen ist die Wiedergeburt aus dem Wasser z. B.
sehr gemein,Die Symbole des Geborenen und des zu Erreichenden besitzen durch lange
Traumserien hindurch stark ambivalenten Charakter, bis ihre Umwandlung soweit
gediehen ist, dass einer Ausgestaltung in der Wirklichkeit kein Hindernis mehr
entgegensteht. Der ambivalente Charakter entsteht, sobald bei einem Gestaltungs-
hemmnis das regressive Bild des zu Erreichenden libidinós überbesetzt wird, und
verliert sich, sobald die Neugestaltung erfolgt ist, die Stauung einen måglichst an-
gepassten Ausweg gefunden hat.S.
116 Korrespondenzblatt.
Die Unlust- und Qualeigenschaft der Libido kann im Traum und im kultischen
Gebilde natürlich auch personifiziert dargestellt sein.Das geborene Libidosymbol macht nun eine Bewegung, einen Zug, eine Fahri,
einen Gang. Diese Bewegungsbilder sind gewöhnlich aus infantilen Etappen ent-
nommen, wo sie die Qualität Lust und Seligkeit in sich bargen, dorther, wo sich
diese motorischen Betatigungen ausbildeten. Ein anderes Gleichnis ist das der Sexual-
betütigung auf irgend einer Stufe direkt entnommene.Auf dieser Fahrt treten dem Libidosymbol die eigenen Widerstandsqualitüten
hindernd oder aufhaltend in den Weg. Die Mürchen und Sagen sind reich an Bei-
spielen, wie der Traum. Der Held muss überall hingehen und eine Aufgabe, ein
Rätsel lösen, die Widerstandsgestalten überwinden.In A. Dieterich's Mithrasliturgie weist der Verfasser nach, dass die modernen
Begriffe von Umwandlung und Entwicklung in der Vergangenheit nur altertümlich
gedacht und dargestellt werden konnten als ein Sterben und Wiedergeborenwerden.
Darum das ewige Wiedergeburtsmotiv in den Religionen.Diese Umwandlung durch Wiedergeburt erfáhrt nun verschieden komplizierte
Darstellungen im Kult und im Analysentraum.Entweder es ist ein Sterben und Wiedergeborenwerden. Oder ein Hiugeben
zu allen Widerstandssymbolen, um sie zu erledigen. Oder ein aktives Hinunter.
steigen, eine Katabasis in ein Muttersymbol: Kultische Höhlen, Tempel, Meer, Unter-
welt, Hüllenfahrt, Schatzhohlen, zu den Müttern im II. Teil des Faust; oder man
muss sich von einem Ungetüm (Fisch des Jonas) verschlingen lassen; selbstverstindlich
ist auch das Inzestgleichnis direkt in diesem Sinne verwertet. Das Muttersymbol hat
häufig Unlust-Widerstandscharakter. Drunten oder drinnen geschieht nun allerhand;
die Vorgänge, .die ich schon erwähnt habe: zu den Widerstandsfiguren hingehen,
allerhand Gestalten überwinden, die Schutzjungfrau dreimal umarmen und so fort,
finden hier statt. Es ist etwas Gebanntes zu erlósen. Wenn dies geschehen, die
„Versuchung“ überwunden ist, was nicht allen gelingt, kommt der Held wieder-
geboren, gekrüftigt wieder heraus, oder bringt das Symbol der neugewonnenen Libido,
den Schatz, die erlóste Seele, herauf.Gerade solche Bilder macht auch die Psychose durch, und wir sehen, dass
alle Helden ein wenig psychotisch werden und der ,Versuchung® anheimfallen, bevor
sie eine grosse Aufgabe erfüllen konnen. Jonas kann erst, nachdem er ausgespien ist,
seine prophetische Mission erfüllen. Ähnliche Bilder sehen wir im Mythos von Hia-
watha, im Motiv von Christus in der Wüste, in noch erhaltenen Volksbrüuchen (Fahrt
der ledigen Mädchen ins Giritzenmoos in verschiedenen Gegenden der Schweiz usf.).So enthalten die religiósen Bilder und Kulte eine Unmenge Darstellungen,
Gleichnisse, Vorbilder der Umwandlung der Libido vor Erfüllung neuer Taten.Andere Gleichnisse enthalten, im Bilde des Sterbens und Auferstehens, das
aktive Sterben, Opfern, Verzichten. Beim Tod geht man in das Muttersymbol
ein, um daraus wiederzuerstehen. Im Kult verzichtet man auf die Opfergabe. Im
Totenkult ist der Tod und der Tote das Geführliche, dem geopfert wird. Man
opfert ein Libidosymbol, Tier, Mensch, symbolisch oder regressiv statt sich selbst.
Oder das Symbol unserer Libido wird als tierische, göttliche, phallische Gestalt ge-
opfert. In den entwickelteren Kulten ist deutlich das Selbstopfer dargestellt.
Das wichtige heilige Kultbild der mitträischen Höhlen ist die Darstellung des seinen
Stier tótenden Mithras, im Christentum ist es das Motiv des sich am Kreuze selbst
opfernden Gottes.Die Kulte enthalten somit die für die Neuanpassung allerwichtigsten Motive,
die ganze Vólker auf sich vereinigen. Bekanntlich verliert die Christusdarstellung
und das christliche Mysterium auf Grund der Forschung immer mehr das realhisto-S.
Korrespondenzblatt. 117
rische Gewand, zugunsten eines religiösen Zustandsbildes, des mythischen Ent-
wicklungszustandes der Zeit, unter Überwindung von allerhand Archaismen anderer
Kulte und deren Ersatz durch symbolische Bedeutungskontamination im neuen Kult.In den Martyrien des Christentums und der griechischen Sage werden Dar-
stellungen für Qual- und Opfermotive gewonnen. Das Qualmotiv unerlöster, nicht
angepasster Libido finden wir wieder in den mythologischen Höllenqualen und Strafen:
Der ewig begehrende Tantalus, die ewig tanzenden oder an einem uringetränkten
männlichen Kleidungsstück kauenden Mädchen, die nicht heiraten wollen usf. (Irr-
liehter). Die Qual ist in einer Form dargestellt, die auch ihre Lustform hatte. 7, В.
das Tanzen (viele Reaktionen sind der Lust und Angst gemeinsam), das Schweben
(= Hängen in der Qualform).Das Nichterreichte kann sich in zwei Prinzipien und Bilder teilen: In eine
(regressive) Wunscherfüllung und eine Qual.Im Tanzlegendchen Gottfried Kellers tanzt die Heldin für den irdischen
Tanzverzicht im Himmel, in den Giritzenmoossagen die nicht rechtzeitig verheirateten
Mädchen qualvoll am Unterweltsorte. Tm Himmel ist der Glanz des ewigen Lichtes,
in der Holle brennt das ewige Feuer.Die Traumfunktion, der Ablauf gewisser Psychosen, die kultische Begehung von
Mysterien und die Funktion der Religion treffen sich also im Regenerationsprinzip
auf Grundlage archaischer Bilderserien. Nach der gleichen natürlichen Vorlage findet
die Umwandlung der Libido im technischen, therapeutischen Prozess der Psychoanalyse
statt. Wir operieren demnach auf psychologisch zweckmässiger Grundlage.Eine Religion vereinigt eine grosse Gemeinschaft auf ein grosses Motiv, aus
dem heraus auch grosse Taten entspringen können, S, Reinach scheint die kanali-
sierende, von vieler Einzelangst befreiende, regenerative Funktion des Priestertums
richtig gewürdigt zu haben.Statt regenerativ zu wirken, kann die Religion natürlich auch rein rückbildend
sein, vergleichbar der Neurose. Rhode weist auf solche Prozesse, mit Angstver-
mehrung, im alten Griechentum hin. Der Katholizismus zeigt deutlich solche
Schwankungen (Beispiele), und eine Vertiefung in die Religionsgeschichte zeigt uns
den Wechsel und das Durcheinandergreifen der regressiven und regenerativen Ten-
denzen, sogar über den gleichen Kultmotiven.Religion und Kult stehen in Wechselbeziehung zum Kulturzustand. Die Reli-
gion absorbiert nicht nur die Lebensangst durch regressiv-regenerative Ersatzbildung,
sondern kanalisiert auch die durch kulturelle Einschränkung gestaute Libido. Es
wird auf das Beispiel des für grosse Frömmigkeit und kulturelle Einschränkung
zeugenden Dionysosmysteriums verwiesen und auf die darauf fussenden Kathartiker,
die therapeutischen, ärztlich-priesterlichen Vorläufer der modernen Psychoanalyse
(man vgl. Rhode). Im Anschluss daran wird die Beichte in ihrer historischen
Entwicklung erwähnt, die zwar zum Vergleich mit der Analyse berechtigt, aber in
vieler Beziehung auf viel unvollkommenerer und zauberhafterer Stufe steht. Der
moderne Protestantismus sehnt sich immer noch nach einem zweckmässigen, höher-
stehenden Ersatze.
Für die therapeutische Psychoanalyse bietet die Religionsgeschichte ungemeinen
Vorteil. Ein ausgebreitetes Vergleichsmaterial archaischer Denkmonumente, deren
Sinn dem Analysanten das Verständnis für die aus eigenem Material erbauten
Motive erleichtert, die er wegen ihrer persönlichen Färbung und Relation zur Aussen-
welt nicht so leicht als sein Libidoproblem herausschilen kann (Unterscheidung von
Objekt und Imago).Statt der geschilderten Katabasis stellen manche religiöse Mysterien eine Himmel-
fahrt und Vereinigung mit der Gottheit dar, mit allerhand Hindernissen und Wider-S.
118 Korrespondenzblatt.
ständen. Man sehe die wundervolle Analyse der Mithrasliturgie von A. Dieterich,
Der Parallelismus zu den anderen Motiven (z. B. Schatzmotiv) ist ersichtlich.Ein analoges Prinzip liegt im Gebet. Die kultische Begehung wird durch
das motorische Äquivalent des Sprechens ersetzt; die Libidobesetzung erhält die
Bezeichnungen von Inbrunst und Andacht. Auch hier ist eine Tendenz zur Kumu-
lation und Verdichtung vorhanden auf der Basis der mythologischen Mysterien.
(Analyse des „Ave Maria*, des potenzierteren „Englischen Grusses*, wo das in Ave
Maria enthaltene Mysterium nochmals zwischen drei Ave Maria eingeschoben wird.
Eine ähnliche Mysterienkumulation ergibt die Analyse des Rosenkranzes.) In den
Litaneien findet sich eine Kumulation ,libidobesetzter“ Ausdrücke. Mit dem Beten
wird also wieder die Vereinigung mit dem Güttlichen, eine Elaboration aus dem
Mysterienmotiv heraus, gesucht. Andererseits enthält das Gebet ebenfalls in erster
Linie die regressive (Zauber-) Qualität eines Ersatzgebildes angesichts einer Schwierig-
keit (man vgl. in Dieterich, Mithrasliturgie, wie diese sich durch die Anwendung
für Zauberzwecke erhalten hat).Die Vereinigung mit der Gottheit, d. h. das Sichinbesitzsetzen seiner in früheren
Formen gebundenen Libido hat noch ein sehr archaisches Bild: Das Essen des
Gottes, kultisch im Tiersymbol oder im Fruchtsymbol. Im Totemismus enthält das
Totemtier (oder Pflanze) alle jene Eigenschaften der Libidoumwandlung (Gefährlich-
keit, Tabuqualität, kultisches Opfer und Geniessen des Symboltieres).Hier sind die Phänomen vereinigt, welche dem Kult nicht bloss die stellver-
tretende, sondern auch aktive, regenerative Bedeutung auf dem Wege der Kulthandlung
geben, angesichts einer Schwierigkeit: Gefahr oder kulturell notwendiger Verzicht.Diese älteste Symbolik, aus der Nährfunktion entnommen, finden wir wieder
in höchster Kontamination an Inhalt und Bedeutung im grossen christlichen Abend-
mahlmysterium, dem höchstentwickelten, inhaltsreichsten und universellsten (Feier
der hl. Messe).Diese Motive enthalten auch die gewonnenen Schätze zur Anwendung der
Psychoanalyse in Pädagogik und Seelsorge, als ewig gültige Gleichnisse, denen nur
grosses Verständnis gewünscht werden kann. Teilweise kann der Schatz nur durch
analytisches Verstehen gehoben werden, wie ich es in einem Aufsatz in „Wissen
und Leben“ (Juli 1912) mit dem Ödipusmotiv versucht habe.Zum Schlusse versucht der Vortrag eine analytische Exegese des Tabu auf
der gewonnenen Grundlage, wo sich die dargestellten Prinzipien besonders schön
verfolgen lassen. (Der Vortrag wurde vor dem Erscheinen von Freud’s Arbeit
über das Tabu ausgearbeitet.) Sowohl die apotropäischen (z. B. Lustrationen) als
Busshandlungen verhalten sich wie regressive, aber analoge Ersatzhandlungen zu
der nicht gewagten oder im psychischen Zwiespalt, also mit noch bestehendem Wider-
stand vorgenommenen, (Der Wolf, der die sieben Geisslein gefressen hat, legt sich,
„nachdem er die Lust gebüsst hat“, befriedigt ins Gras.)Bei diesem Anlass wird noch der Inzestschranke gedacht, die offenbar
nur den speziellen Fall des „Tabu“ darstellt für den im Zwiespalt mit sich selbst
gequälten, mit Anpassungsschwierigkeiten kämpfenden Kulturmenschen und Neurotiker
unserer Zeit.Die Gleichartigkeit des Motivs fiir das Wagen und Nichtwagen, die Zeitlosig-
keit des riickblickenden und vorwårtsgerichteten Symbols wird schliesslich an der
Paradiesgeschichte illustriert: Wer die Schranken im Paradies übertritt, wird gestraft,
muss sterben. Aber Gott hiitet den Lebensbaum, weil der Mensch sonst durch den
Raub der Früchte ewiges Leben erhalten könnte, also ein Held, gottgleich wire.
Dazu muss man aber das Opfer seiner selbst bringen = sterben. Die Kultur er-
fordert das Verbot des Rückschauens. Der Held überwindet das durch das Inzest-S.
Korrespondenzblatt. 19
motiv dargestellte Problem durch die Uberwindung der Schwierigkeit (in Form des
Interdikts). Dann ist er qualfrei. Der Neurotiker tendiert auf Grund der gleichen
Bilder rückwärts und wird schuldig wie Odipus. Die Kultur erfordert, wenn nicht
das reale Inzestverbot, får das wohl spezielle Motive entscheidend werden, so auf
alle Fille das Verlassen des Alten und die Vorwärtsentwicklung.(Autoreferat.)
10. Am 8. und 9. September 1912 tagte in Zürich der Internat. Verein
für medizinische Psychologie und Psychotherapie.Psychologische Themata enthielten die Vorträge von:
Prof. Bleuler, Zürich: Das Unbewusste.
Dr. Hans Maier, Zürich: Der Mechanismus der Wahnideen.
Dr. A. Maeder, Zürich: Über die teleologischen Funktionen des Unbewussten.
Dr, von Stauffenberg, München : Die Psychotherapie auf der inneren Klinik.
Dr. Philipp Stoin, Budapest: Über das Verhalten des psychogalvanischen,
Reflexphänomens.
Dr. E. Trómner, Hamburg: Leistungssteigerungen im hypnotischen Zustand.
Dr. L. Seif, München: Zur Psychopathologie der Angst.
Prof. Jones, Toronto: The relation of auxiety neurosis to auxiety-hysteria.
Dr. Adler, Wien: Uber das organische Substrat der Psychoneurosen.
Dr. L. Klages, München: Das Ausdrucksgesetz und seine psychodiagnostische
Verwertung.
Dr. L. Margulies, Sayn: Über psychische Ursachen geistiger Störungen
und über den Begriff des Psychogenen.
Leider war es dem Ref. unmöglich, allen Vorträgen und Diskussionen persönlich
beizuwohnen. Er beschränkt sich, da noch offizielle Berichterstattungen folgen
werden, auf persönliche, impressionistische Bemerkungen, die, dem Charakter des
„Korrespondenzblatt“ entsprechend, hier gestattet sein mögen,Das Programm hat eine bedeutende Belastung mit psychoanalytischen Gegen-
ständen erfahren und gesteht ihr so offiziell den Charakter grosser Aktualität zu.
Dies äusserte sich auch in Erscheinungen, sowohl interessanten als unangenehmen,
die nicht auf dem Programm standen. Forel hatte in der Züricher Zeitungsdebatte
im Frühjahr, in die er temperamentvoll und nicht gerade objektiv eingriff, auf diesen
Kongress hingewiesen, der die schwebenden Fragen lösen werde, Ich sah viele
Teilnehmer, die mit dem Problem der Psychoanalyse schon lange zweifelnd und un-
sicher schwanger gehen und sich zu ihr in allerhand besonderen Einstellungen be-
finden. Als symptomatisch möchte ich auch die ungeteilte Aufmerksamkeit erwähnen,
welche den Diskussionsvoten Dr. Adler’s jeweilen zuteil wurde, in Anbetracht seiner
Stellung zu den Problemen und Persönlichkeiten.Die Vorträge von Prof. Jones und Dr. Seif über Angstneurosen und Angst
resümierten in klarer und knapper Art die bisherigen analytischen Ergebnisse über
das Angstproblem, soweit es das Neurosengebiet betrifft. In der Diskussion berührte
ein Redner einen Punkt, der nicht aus dem Auge verloren werden darf, das Verhältnis
zwischen Angst und realer äusserer Gefahr, z. B. Todesgefahr, das auch in der Tier-
psychologie von Bedeutung ist. Für den Eingeweihten wird dieser Punkt wohl bald
eine Lösung erfahren, der den Verhältnissen gerecht wird und mit der Libidotheorie
in Einklang zu bringen ist. Das Studium des Tabu und der teleologischen Funktionen
des Unbewussten wird voraussichtlich zur Lösung führen.Maeder fügte seinen in unseren Kreisen schon bekannten Ausführungen über
die teleologischen, vorbereitenden Funktionen des Unbewussten eine Analyse der
Psychose Benvenuto Cellini’s bei und kommt an Hand der äusserst interessantenS.
120 Korrespondenzblatt.
Symbolwandlungen in dieser Psychose zu analogen Schlüssen, wie Riklin in seinem
vortägigen Vortrag: „Psychoanalyse und Religionsforschung“ im Schweizer Irren-
ürzteverein, dass die Psychose hier ühnlich der Analyse, angesichts von Schwierig-
keiten, regressiv oder regenerativ über den Weg von libidosymbolischen Wandlungen
automatisch zu neuer, hier besserer, Anpassung geführt hat, also einen teleologischen
Umwandlungs- und Anpassungsversuch darstellt.Leider scheint nur ein sehr kleiner Teil des Publikums genügend vorbereitet
gewesen zu sein, um diese Ausführungen würdigen zu kónnen.Maier's Ausführungen über den „Mechanismus der Wahnideen“
fügten den bisherigen analytischen Daten über diesen Gegenstand, soweit ich als
Zuhörer beurteilen konnte, wenig Neues bei, brachten sie auch nicht eigentlich zur
Diskussion. Er prägt einen adjektiv brauchbaren Ausdruck ,katathym* für die
Wirkung des ,gefühlsbetonten Komplexes“, der, gemäss der Verwendung in seinem
Vortrag, den dynamischen, triebhaften und quantitativ abstufbaren Eigenschaften
der Libido, auch der Verschiebung und Regression, gerecht werden könnte. Es ist
die Frage, ob diese Neuschopfung im Angesicht des gegenwärtigen Standes der
Libidotheorie noch zweckmüssig ist. kProf. Bleuler resūmiert in seinem Vortrag über „Das Unbewusste“ eine
grosse Zahl von Beobachtungen, welche den Begriff des Unbewussten rechtfertigen.
Dabei geht er auch auf Freud's Theorie des Unbewussten ein, erwähnt die Un-
bewusstmachung durch Verdrängung und bezeichnet als in unserer Kultur mit Vor-
liebe verdrångte Komplexe die sexuellen. Auf die libidogeschichtlichen genetischen
Zusammenhänge dieser Erscheinungen und ihre Wirkungen geht das Referat nicht ein.Die an die Vorträge von Bleuler und Maier anschliessende Diskussion
über das Unbewusste bot ein ziemlich bemühendes Bild. Eine Verständigung
wäre erst möglich auf der Basis einer einheitlichen Benennung der Phänomene. Man
müsste sich über Begriffe einigen, die jetzt den verschiedensten Abstraktionsgesichts-
punkten entnommen sind und an denen die verschiedenartigsten Theorien Spuren zurück-
gelassen haben. Solange 2. B. noch für blosse psychische Intensitätsunterschiede
die Bezeichnungen „organisch“ und „psychisch“ mit den dahinter liegenden An-
schauungen gebraucht werden, ist es schwer, eine gemeinschaftliche Sprache zu
reden und sich zu einigen. Gewiss kann der Eingeweihte auch die Sprache der
jenigen verstehen, der das Unbewusste leugnet und einfach die bei unserem ,Un-
bewussten“ beschriebenen quantitativen und qualitativen Wandlungen des Bewussten
beschreibt. Die Abstraktion ,das Unbewusste* beruht aber auf der Verwertung und
Zusammenfassung so vieler Erscheinungen, dass dessen Ausmerzung uns einfach
nötigen würde, die darin subsumierten Daten zu ignorieren, was ein Riickschritt wäre,
oder sie sofort in einer anderen Terminologie wieder auferstehen zu lassen.In seinem Vortrag „Das organische Substrat der Psychoneurosen*
unterstreicht Adler eine Betrachtungsweise der Neurosen, die uns in der Hauptsache
bekannt ist und einer Menge wichtiger Erscheinungen gerecht wird, die sich vom
Gesichtspunkte der Anpassungsschwierigkeit des minderwertigen Neurotikers aus
betrachten lassen.Das übrige muss ich der offiziellen Berichterstattung der Vereinsorgane über-
lessen, Riklin.
zb319122
101
–120