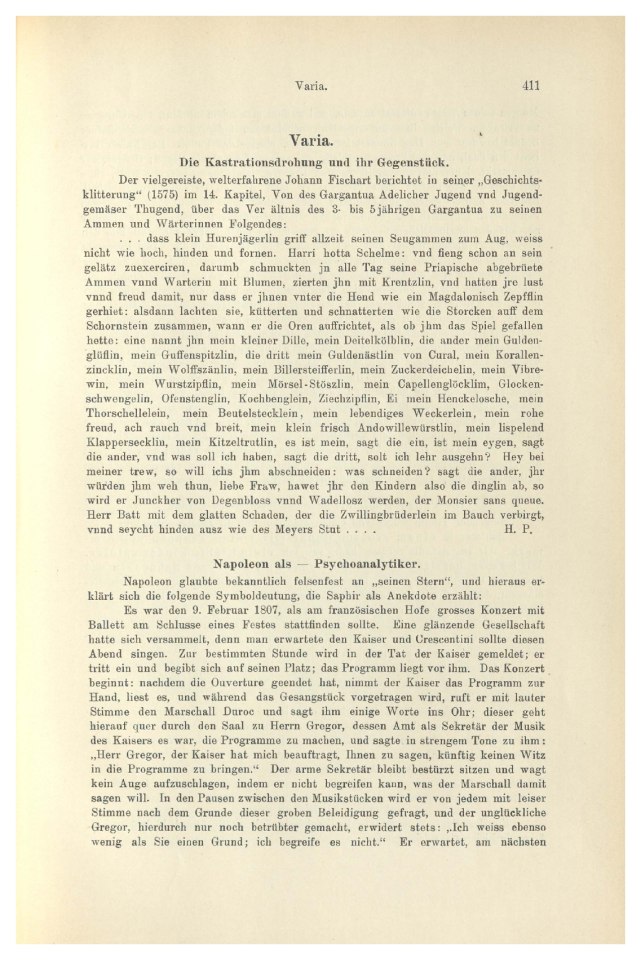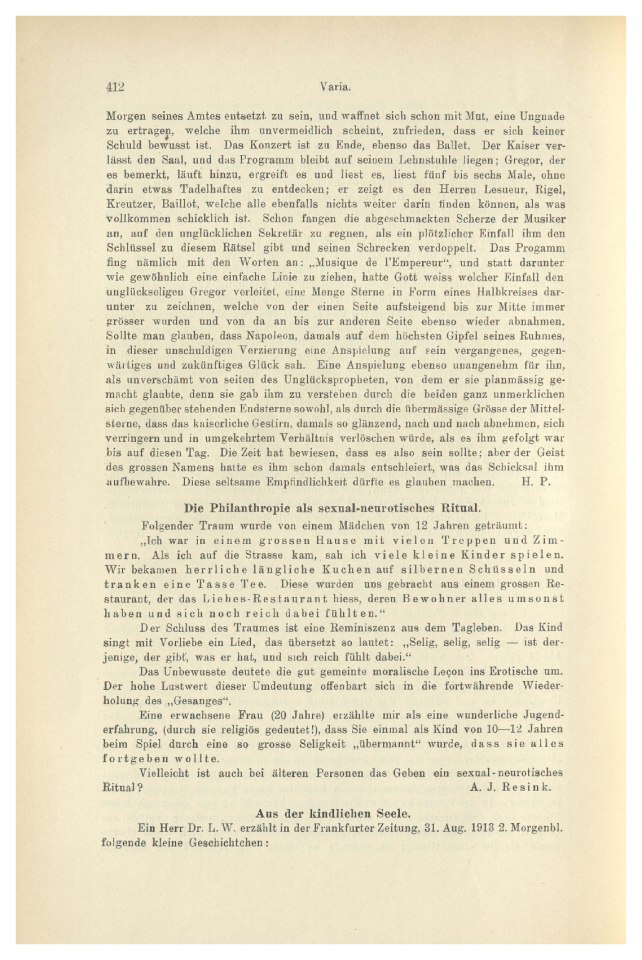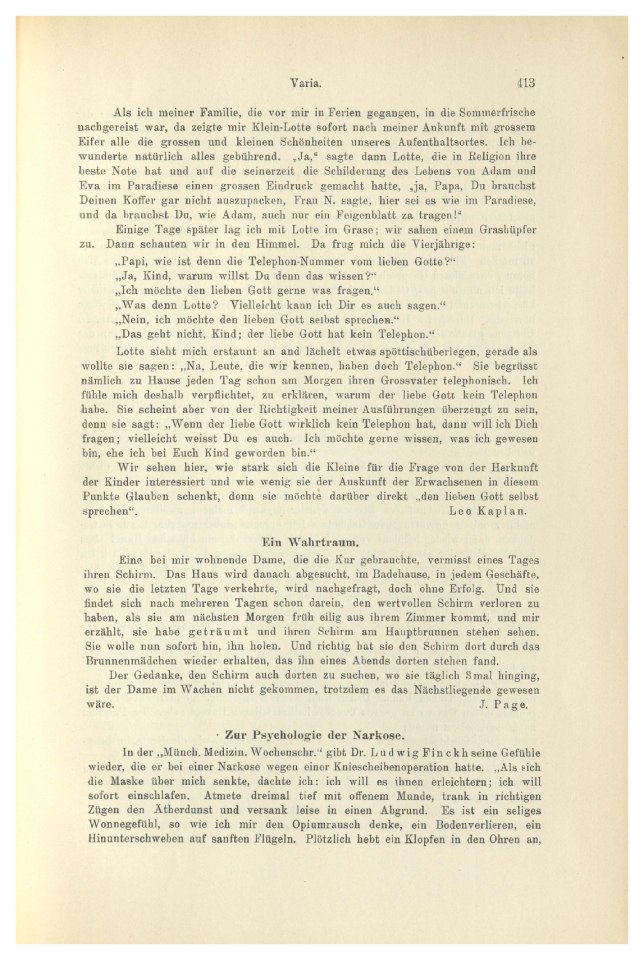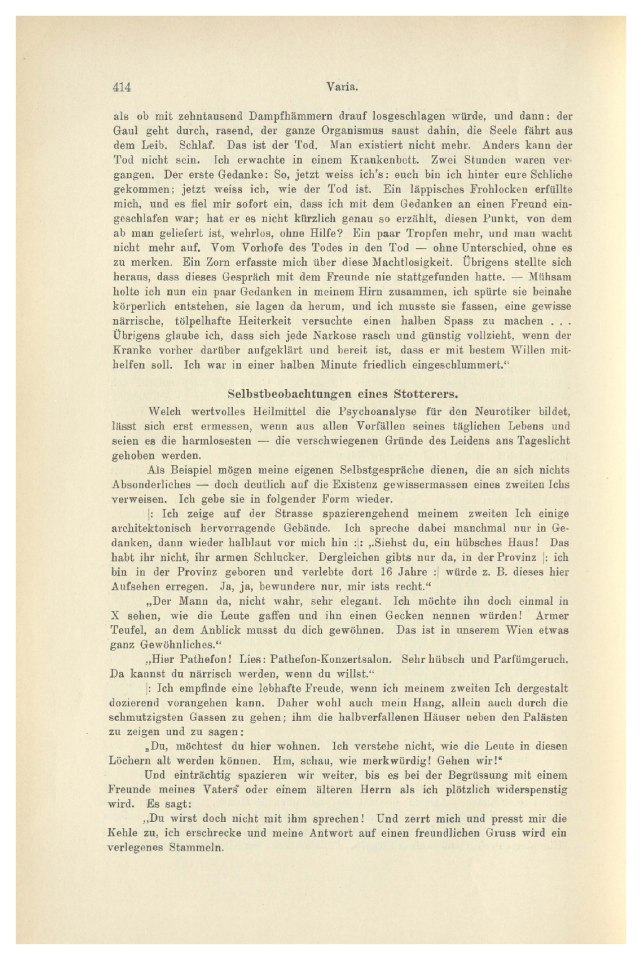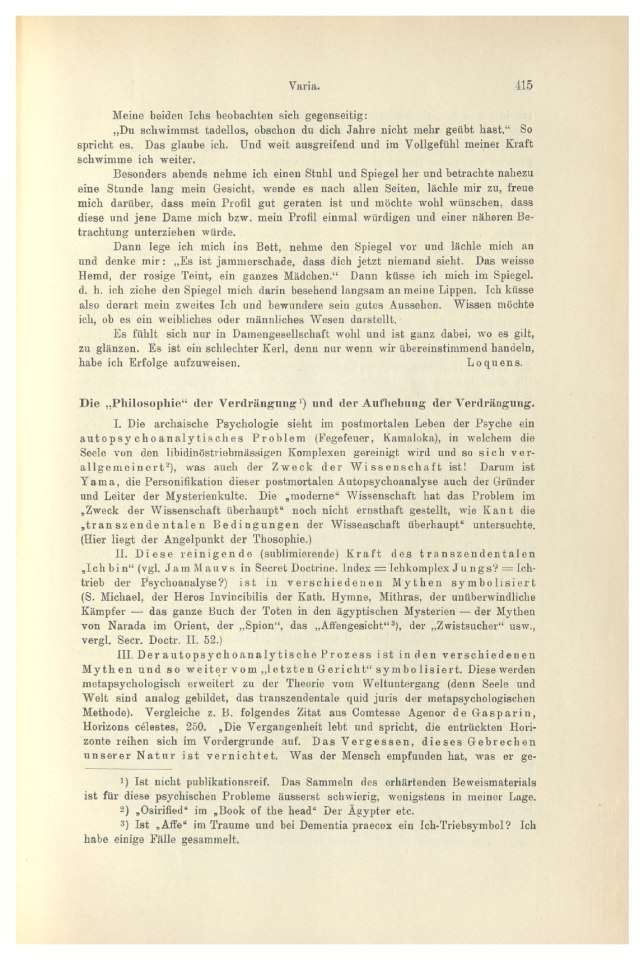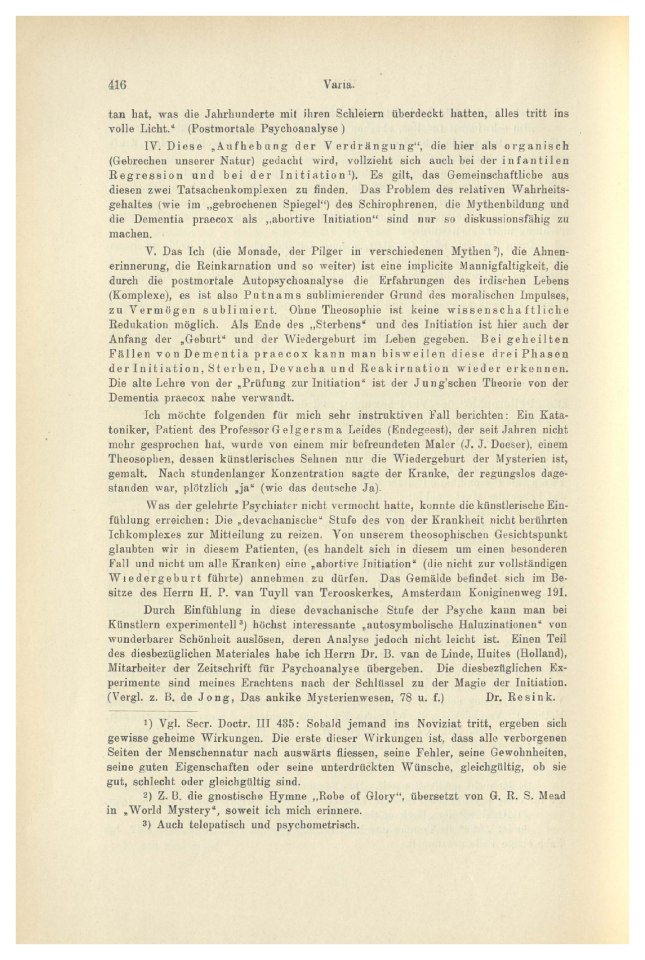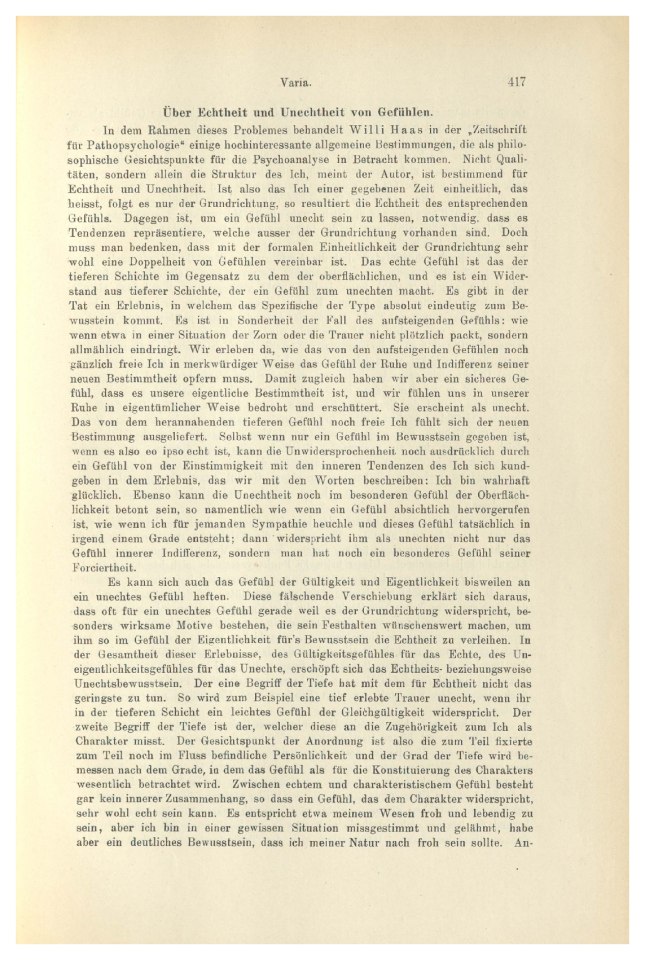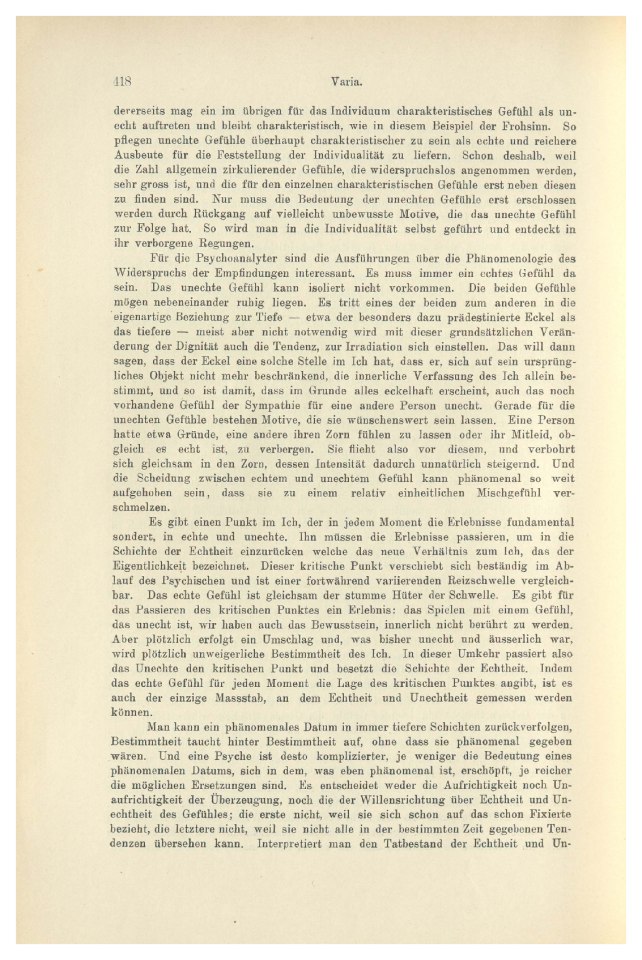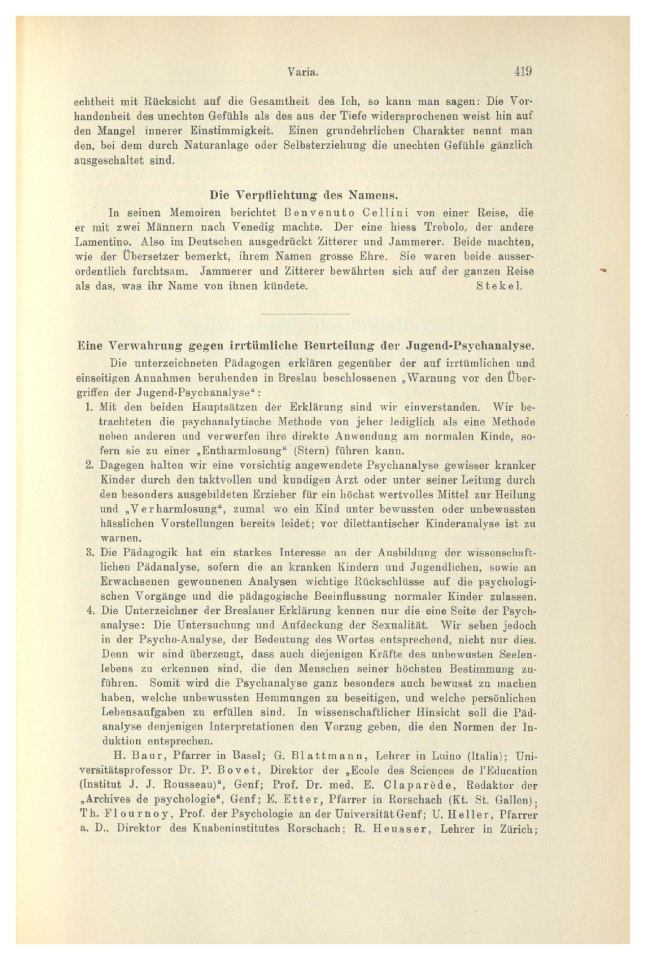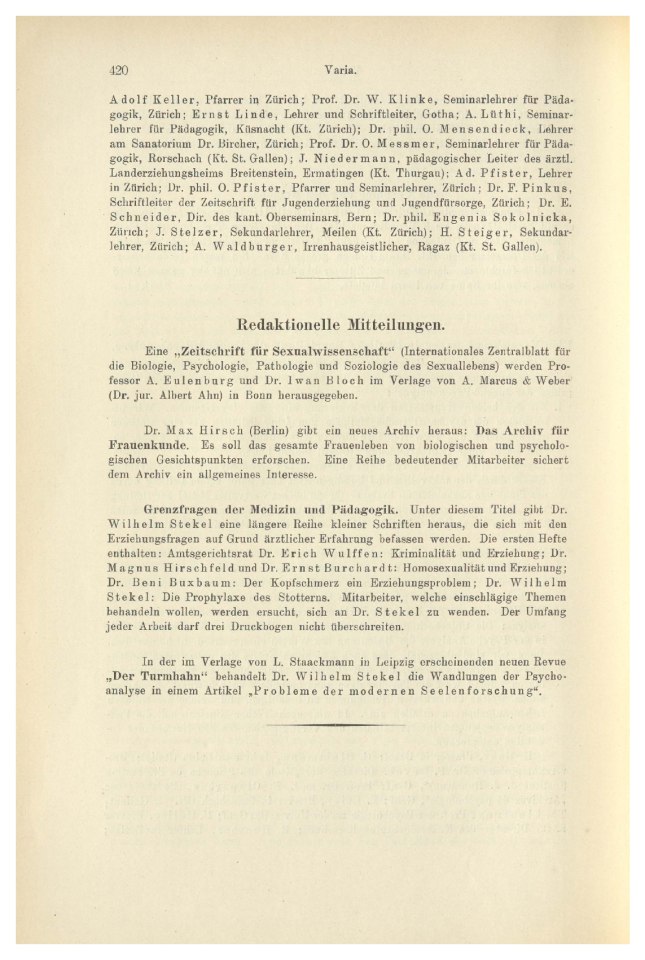S.
Varia. 411
Varia.
Die Kastrationsdrohung und ihr Gegenstiick.Der vielgereiste, welterfahrene Johann Fischart berichtet in seiner „Geschichts-
klitterung“ (1575) im 14. Kapitel, Von des Gargantua Adelicher Jugend vnd Jugend-
gemüser Thugend, über das Ver ältnis des 3- bis 5jährigen Gargantua zu seinen
Ammen und Wirterinnen Folgendes:dass klein Hurenjägerlin griff allzeit seinen Seugammen zum Aug, weiss
nicht wie hoch, hinden und fornen. Harri hotta Schelme: vnd fieng schon an sein |
gelätz zuexerciren, darumb schmuckten jn alle Tag seine Priapische abgebrüete
Ammen vnnd Warterin mit Blumen, zierten jhn mit Krentzlin, vnd hatten jre lust
vnnd frend damit, nur dass er jhnen vnter die Hend wie ein Magdalonisch Zepfflin
gerhiet: alsdann lachten sie, kütterten und schnatterten wie die Storcken auff dem
Schornstein zusammen, wann er die Oren auffrichtet, als ob jhm das Spiel gefallen
hette: eine nannt jhn mein kleiner Dille, mein Deitelklblin, die ander mein Gulden-
glüflin, mein Guffenspitzlin, die dritt mein Guldenästlin von Cural, mein Korallen-
zincklin, mein Wolffszånlin, mein Billersteifferlin, mein Zuckerdeichelin, mein Vibre-
win, mein Wurstzipflin, mein Mórsel-Stószlin, mein Capellenglócklim, Glocken-
schwengelin, Ofenstenglin, Kochbenglein, Ziechzipflin, Ei mein Henckelosche, mein
Thorschellelein, mein Beutelstecklein, mein lebendiges Weckerlein, mein rohe
freud, ach rauch vnd breit, mein klein frisch Andowillewiirstlin, mein lispelend
Klappersecklin, mein Kitzeltrutlin, es ist mein, sagt die ein, ist mein eygen, sagt
die ander, vnd was soll ich haben, sagt die dritt, solt ich lehr ausgehn? Hey bei
meiner trew, so will ichs jhm abschneiden: was schneiden? sagt die ander, jhr
würden jhm weh thun, liebe Fraw, hawet jhr den Kindern also die dinglin ab, so
wird er Junckher von Degenbloss vnnd Wadellosz werden, der Monsier sans queue.
Herr Batt mit dem glatten Schaden, der die Zwillingbriiderlein im Bauch verbirgt,
vnnd seycht hinden ausz wie des Meyers Stut . . . ・ HESNapoleon als — Psychoanalytiker.
Napoleon glaubte bekanntlich felsenfest an „seinen Stern“, und hieraus er-
klärt sich die folgende Symboldeutung, die Saphir als Anekdote erzählt:Es war den 9. Februar 1807, als am französischen Hofe grosses Konzert mit
Ballett am Schlusse eines Festes stattfinden sollte. Kine glänzende Gesellschaft
hatte sich versammelt, denn man erwartete den Kaiser und Crescentini sollte diesen
Abend singen. Zur bestimmten Stunde wird in der Tat der Kaiser gemeldet; er
tritt ein und begibt sich auf seinen Platz; das Programm liegt vor ihm. Das Konzert
beginnt: nachdem die Ouverture geendet hat, nimmt der Kaiser das Programm zur
Hand, liest es, und während das Gesangstiick vorgetragen wird, ruft er mit lauter
Stimme den Marschall Duroc und sagt ihm einige Worte ins Ohr; dieser geht
hierauf quer durch den Saal zu Herrn Gregor, dessen Amt als Sekretär der Musik
des Kaisers es war, die Programme zu machen, und sagte in strengem Tone zu ihm:
„Herr Gregor, der Kaiser hat mich beauftragt, Ihnen zu sagen, künftig keinen Witz
in die Programme zu bringen.“ Der arme Sekretär bleibt bestiirzt sitzen und wagt
kein Auge aufzuschlagen, indem er nicht begreifen kann, was der Marschall damit
sagen will. In den Pausen zwischen den Musikstücken wird er von jedem mit leiser
Stimme nach dem Grunde dieser groben Beleidigung gefragt, und der ungliickliche
Gregor, hierdurch nur noch betriibter gemacht, erwidert stets: „Ich weiss ebenso
wenig als Sie einen Grund; ich begreife es nicht.“ Er erwartet, am nächstenS.
412 Varia.
Morgen seines Amtes entsetzt zu sein, und waffnet sich schon mit Mut, eine Ungnade
zu ertragen, welche ihm ‚unvermeidlich scheint, zufrieden, dass er sich keiner
Schuld bewusst ist. Das Konzert ist zu Ende, ebenso das Ballet. Der Kaiser ver-
lässt den Saal, und das Programm bleibt auf seinem Lehnstuhle liegen; Gregor, der
es bemerkt, läuft hinzu, ergreift es und liest es, liest fünf bis sechs Male, ohne
darin etwas Tadelhaftes zu entdecken; er zeigt es den Herren Lesueur, Rigel,
Kreutzer, Baillot, welche alle ebenfalls nichts weiter darin finden können, als was
vollkommen schicklich ist. Schon fangen die abgeschmackten Scherze der Musiker
an, auf den unglücklichen Sekretär zu regnen, als ein plôtzlicher Einfall ihm den
Schliissel zu diesem Råtsel gibt und seinen Schrecken verdoppelt. Das Progamm
fing nämlich mit den Worten an: „Musique de I'Empereur", und statt darunter
wie gewöhnlich eine einfache Linie zu ziehen, hatte Gott weiss welcher Einfall den
unglückseligen Gregor verleitet, eine Menge Sterne in Form eines Halbkreises dar-
unter zu zeichnen, welche von der einen Seite aufsteigend bis zur Mitte immer
grösser wurden und von da an bis zur anderen Seite ebenso wieder abnahmen.
Sollte man glauben, dass Napoleon, damals auf dem höchsten Gipfel seines Ruhmes,
in dieser unschuldigen Verzierung eine Anspielung auf sein vergangenes, gegen-
würliges und zukünftiges Glück sah. Eine Anspielung ebenso unangenehm für ihn,
als unverschämt von seiten des Unglückspropheten, von dem er sie planmüssig ge-
macht glaubte, denn sie gab ihm zu verstehen durch die beiden ganz unmerklichen
sich gegenüber stehenden Endsterne sowohl, als durch die tbermissige Grösse der Mittel-
sterne, dass das kaiserliche Gestirn, damals so glänzend, nach und nach abnehmen, sich
verringern und in umgekehrtem Verhültnis verlóschen würde, als es ihm gefolgt war
bis auf diesen Tag. Die Zeit hat bewiesen, dass es also sein sollte; aber der Geist
des grossen Namens hatte es ihm schon damals entschleiert, was das Schicksal ihm
aufbewahre. Diese seltsame Empfindlichkeit dürfte es glauben machen. HiP.Die Philanthropie als sexual-neurotisches Ritual.
Folgender Traum wurde von einem Miidchen von 12 Jahren getriiumt:
„Ich war in einem grossen Hause mit vielen Treppen und Zim-
mern. Als ich auf die Strasse kam, sah ich viele kleine Kinder spielen.
Wir bekamen herrliche långliche Kuchen auf silbernen Schüsseln und
tranken eine Tasse Tee. Diese wurden uns gebracht aus einem grossen Re-
staurant, der das Liebes-Restaurant hiess, deren Bewohner alles umsonst
haben und sich noch reich dabei fühlten.“Der Schluss des Traumes ist eine Reminiszenz aus dem Tagleben. Das Kind
singt mit Vorliebe ein Lied, das übersetzt so lautet: „Selig, selig, selig — ist der-
jenige, der gibt, was er hat, und sich reich fühlt dabei,“Das Unbewusste deutete die gut gemeinte moralische Lecon ins Erotische um.
Der hohe Lustwert dieser Umdeutung offenbart sich in die fortwährende Wieder-
holung des „Gesanges“,Eine erwachsene Frau (20 Jahre) erzählte mir als eine wunderliche Jugend-
erfahrung, (durch sie religiös gedeutet!), dass Sie einmal als Kind von 10—12 Jahren
beim Spiel durch eine so grosse Seligkeit „übermannt‘“ wurde, dass sie alles
fortgeben wollte.Vielleicht ist auch bei älteren Personen das Geben ein sexual-neurotisches
Ritual? A. J. Resink.Aus der kindlichen Seele,
Ein Herr Dr. L. W. erzählt in der Frankfurter Zeitung, 31. Aug. 1913 2. Morgenbl.
folgende kleine Geschichtchen :S.
Varia, 413
Als ich meiner Familie, die vor mir in Ferien gegangen, in die Sommerfrische
nachgereist war, da zeigte mir Klein-Lotte sofort nach meiner Ankunft mit grossem
Eifer alle die grossen und kleinen Schönheiten unseres Aufenthaltsortes. Ich be-
wunderte natürlich alles gebührend. „Ja,“ sagte dann Lotte, die in Religion ihre
beste Note hat und auf die seinerzeit die Schilderung des Lebens von Adam und
Eva im Paradiese einen grossen Eindruck gemacht hatte, „ja, Papa, Du brauchst
Deinen Koffer gar nicht auszupacken, Frau N. sagte, hier sei es wie im Paradiese,
und da brauchst Du, wie Adam, auch nur ein Feigenblatt za tragen!“Einige Tage später lag ich mit Lotte im Grase; wir sahen einem Grashiipfer
zu. Dann schauten wir in den Himmel. Da frug mich die Vierjührige:„Papi, wie ist denn die Telephon-Nummer vom lieben Gotte?*
„Ja, Kind, warum willst Du denn das wissen?“
„Ich möchte den lieben Gott gerne was fragen,“
„Was denn Lotte? Vielleicht kann ich Dir es auch sagen.“
„Nein, ich möchte den lieben Gott selbst sprechen.“
»Das geht nicht, Kind; der liebe Gott hat kein Telephon.'*
Lotte sieht mich erstaunt an and lächelt etwas spóttischüberlegen, gerade als
wollte sie sagen: , Na, Leute, die wir kennen, haben doch Telephon.“ Sie begrüsst
nümlich zu Hause jeden Tag schon am Morgen ihren Grossvater telephonisch. Ich
fühle mich deshalb verpflichtet, zu erkliren, warum der liebe Gott kein Telephon
habe. Sie scheint aber von der Richtigkeit meiner Ausführungen überzeugt zu sein,
denn sie sagt: „Wenn der liebe Gott wirklich kein Telephon hat, dann will ich Dich
fragen; vielleicht weisst Du es auch. Ich möchte gerne wissen, was ich gewesen
bin, ehe ich bei Euch Kind geworden bin.“Wir sehen hier, wie stark sich die Kleine für die Frage von der Herkunft
der Kinder interessiert und wie wenig sie der Auskunft der Erwachsenen in diesem
Punkte Glauben schenkt, denn sie möchte darüber direkt „den lieben Gott selbst
sprechen“, Leo Kaplan.Ein Wahrtraum,
Eine bei mir wohnende Dame, die die Kur gebrauchte, vermisst eines Tages
ihren Schirm. Das Haus wird danach abgesucht, im Badehause, in jedem Geschäfte,
wo sie die letzten Tage verkehrte, wird nachgefragt, doch ohne Erfolg. Und sie
findet sich nach mehreren Tagen schon darein, den wertvollen Schirm verloren zu
haben, als sie am nächsten Morgen früh eilig aus ihrem Zimmer kommt, und mir
erzählt, sie habe geträumt und ihren Schirm am Hauptbrunnen stehen sehen.
Sie wolle nun sofort hin, ihn holen. Und richtig hat sie den Schirm dort durch das
Brunnenmädchen wieder erhalten, das ihn eines Abends dorten stehen fand.Der Gedanke, den Schirm auch dorten zu suchen, wo sie täglich mal hinging,
ist der Dame im Wachen nicht gekommen, trotzdem es das Nüchstliegende gewesenwüre. J. Page.
: Zur Psychologie der Narkose.
In der „Münch, Medizin. Wochenschr. gibt Dr. Lud wig Finckh seine Gefühle
wieder, die er bei einer Narkose wegen einer Kniescheibenoperation hatte. „Als sich
die Maske über mich senkte, dachte ich: ich will es ihnen erleichtern; ich will
sofort einschlafen, Atmete dreimal tief mit offenem Munde, trank in richtigen
Zügen den Atherdunst und versank leise in einen Abgrund. Es ist ein seliges
Wonnegefiihl, so wie ich mir den Opiumrausch denke, ein Bodenverlieren, ein
Hinunterschweben auf sanften Flügeln. Plötzlich hebt ein Klopfen in den Ohren an,S.
414 Varia.
als ob mit zehntausend Dampfhämmern drauf losgeschlagen würde, und dann: der
Gaul geht durch, rasend, der ganze Organismus saust dahin, die Seele fihrt aus
dem Leib. Schlaf. Das ist der Tod. Man existiert nicht mehr. Anders kann der
Tod nicht sein. Ich erwachte in einem Krankenbott. Zwei Stunden waren ver-
gangen. Der erste Gedanke: So, jetzt weiss ich's: euch bin ich hinter eure Schliche
gekommen; jetzt weiss ich, wie der Tod ist. Ein läppisches Frohlocken erfüllte
mich, und es fiel mir sofort ein, dass ich mit dem Gedanken an einen Freund ein-
geschlafen war; hat er es nicht kürzlich genau so erzählt, diesen Punkt, ven dem
ab man geliefert ist, wehrlos, ohne Hilfe? Ein paar Tropfen mehr, und man wacht
nicht mehr auf. Vom Vorhofe des Todes in den Tod — ohne Unterschied, ohne es
zu merken. Ein Zorn erfasste mich über diese Machtlosigkeit. Übrigens stellte sich
heraus, dass dieses Gespräch mit dem Freunde nie stattgefunden hatte. — Miihsam
holte ich nun ein paar Gedanken in meinem Hirn zusammen, ich spiirte sie beinahe
körperlich entstehen, sie lagen da herum, und ich musste sie fassen, eine gewisse
nårrische, tolpelhafte Heiterkeit versuchte einen halben Spass zu machen . .
Übrigens glaube ich, dass sich jede Narkose rasch und günstig vollzieht, wenn der
Kranke vorher darüber aufgeklärt und bereit ist, dass er mit bestem Willen mit-
helfen soll. Ich war in einer halben Minute friedlich eingeschlummert.“Selbstbeobachtungen eines Stotterers.
Welch wertvolles Heilmittel die Psychoanalyse für den Neurotiker bildet,
lässt sich erst ermessen, wenn aus allen Vorfülen seines täglichen Lebens und
seien es die harmlosesten — die verschwiegenen Gründe des Leidens ans Tageslicht
gehoben werden.Als Beispiel mögen meine eigenen Selbstgespräche dienen, die an sich nichts
Absonderliches — doch deutlich auf die Existenz gewissermassen eines zweiten Ichs
verweisen. Ich gebe sie in folgender Form wieder.|: Ich zeige auf der Strasse spazierengehend meinem zweiten Ich einige
architektonisch hervorragende Gebäude. Ich spreche dabei manchmal nur in Ge-
danken, dann wieder halblaut vor mich hin :: „Siehst du, ein hübsches Haus! Das
habt ihr nicht, ihr armen Schlucker. Dergleichen gibts nur da, in der Provinz |: ich
bin in der Provinz geboren und verlebte dort ⑯ Jahre :| würde 2. B. dieses hier
Aufsehen erregen. Ja, ja, bewundere nur, mir ists recht.“„Der Mann da, nicht wahr, sehr elegant. Ich möchte ihn doch einmal in
X sehen, wie die Leute gaffen und ihn einen Gecken nennen würden! Armer
Teufel, an dem Anblick musst du dich gewöhnen. Das ist in unserem Wien etwas
ganz Gewôhnliches.“„Hier Pathefon! Lies: Pathefon-Konzertsalon. Sehr hübsch und Parfümgeruch,
Da kannst du närrisch werden, wenn du willst.“: Ich empfinde eine lebhafte Freude, wenn ich meinem zweiten Ich dergestalt
dozierend vorangehen kann. Daher wohl auch mein Hang, allein auch durch die
schmutzigsten Gassen zu gehen; ihm die halbverfallenen Häuser neben den Palästen
zu zeigen und zu sagen:„Du, möchtest du hier wohnen. Ich verstehe nicht, wie die Leute in diesen
Löchern alt werden können, Hm, schau, wie merkwürdig! Gehen wir!“Und einträchtig spazieren wir weiter, bis es bei der Begrüssung mit einem
Freunde meines Vaters oder einem älteren Herrn als ich plötzlich widerspenstig
wird. Es sagt:„Du wirst doch nicht mit ihm sprechen! Und zerrt mich und presst mir die
Kehle zu, ich erschrecke und meine Antwort auf einen freundlichen Gruss wird ein
verlegenes Stammeln.S.
Varia. 415
Meine beiden Ichs beobachten sich gegenseitig:
„Du schwimmst tadellos, obschon du dich Jahre nicht mehr geübt hast.“ So
spricht es. Das glaube ich. Und weit ausgreifend und im Vollgefühl meiner Kraft
schwimme ich weiter.Besonders abends nehme ich einen Stuhl und Spiegel her und betrachte nahezu
eine Stunde lang mein Gesicht, wende es nach allen Seiten, lächle mir zu, freue
mich darüber, dass mein Profil gut geraten ist und möchte wohl wünschen, dass
diese und jene Dame mich bzw. mein Profil einmal würdigen und einer näheren Be-
trachtung unterziehen würde,Dann lege ich mich ins Bett, nehme den Spiegel vor und lächle mich an
und denke mir: „Es ist jammerschade, dass dich jetzt niemand sieht. Das weisse
Hemd, der rosige Teint, ein ganzes Mädchen.“ Dann küsse ich mich im Spiegel.
d. h. ich ziehe den Spiegel mich darin besehend langsam an meine Lippen. Ich kiisse
also derart mein zweites Ich und bewundere sein gutes Aussehen. Wissen möchte
ich, ob es ein weibliches oder miinnliches Wesen darstellt.Es fühlt sich nur in Damengesellschaft wohl und ist ganz dabei, wo es gilt,
zu glänzen. Es ist ein schlechter Kerl, denn nur wenn wir übereinstimmend handeln,
habe ich Erfolge aufzuweisen. Loquens.Die „Philosophie“ der Verdrängung‘) und der Aufhebung der Verdrängung.
I. Die archaische Psychologie sieht im postmortalen Leben der Psyche ein
autopsychoanalytisches Problem (Fegefener, Kamaloka), in welchem die
Seele von den libidinästriebmässigen Komplexen gereinigt wird und so sich ver-
allgemeinert?), was auch der Zweck der Wissenschaft ist! Darum ist
Yama, die Personifikation dieser postmortalen Autopsychoanalyse auch der Gründer
und Leiter der Mysterienkulte. Die „moderne“ Wissenschaft hat das Problem im
„Zweck der Wissenschaft überhaupt“ noch nicht ernsthaft gestellt, wie Kant die
»transzendentalen Bedingungen der Wissenschaft überhaupt“ untersuchte,
(Hier liegt der Angelpunkt der Thosophie.)11. Diese reinigende (sublimierende) Kraft des transzendentalen
„Ich bin“ (vgl. Jam Mauvs in Secret Doctrine. Index = Tehkomplex Jungs? = Ich-
trieb der Psychoanalyse?) ist in verschiedenen Mythen symbolisiert
(S. Michael, der Heros Invincibilis der Kath. Hymne, Mithras, der untiberwindliche
Kämpfer — das ganze Buch der Toten in den ägyptischen Mysterien — der Mythen
von Narada im Orient, der , Spion", das ,Affengesicht*?), der ,Zwistsucher" usw.,
vergl. Secr. Doctr. II. 52.)III. Derautopsychoanalytische Prozess ist in den verschiedenen
Mythen und so weiter vom „letzten Gericht“ symbolisiert. Diese werden
metapsychologisch erweitert zu der Theorie vom Weltuntergang (denn Seele und
Welt sind analog gebildet, das transzendentale quid juris der metapsychologischen
Methode). Vergleiche z. B. folgendes Zitat aus Comtesse Agenor de Gasparin,
Horizons célestes, 250. ,Die Vergangenheit lebt und spricht, die entriickten Hori-
zonte reihen sich im Vordergrunde auf. Das Vergessen, dieses Gebrechen
unserer Natur jst vernichtet. Was der Mensch empfunden hat, was er ge-1) Ist nicht publikationsreif. Das Sammeln des erhiirtenden Beweismaterials
ist für diese psychischen Probleme äusserst schwierig, wenigstens in meiner Lage.2) ,Osirified“ im „Book of the head“ Der Ägypter etc.
3) Ist „Affe“ im Traume und bei Dementia praecox ein Ich-Triebsymbol? Ich
habe einige Fiille gesammelt.S.
416 Varia.
tan hat, was die Jahrhunderte mit ihren Schleiern überdeckt hatten, alles tritt ins
volle Licht.“ (Bostmortale Psychoanalyse )IV. Diese „Aufhebung der Verdrängung“, die hier als organisch
(Gebrechen unserer Natur) gedacht wird, vollzieht sich auch bei der infantilen
Regression und bei der Initiation!) Es gilt, das Gemeinschaftliche aus
diesen zwei Tatsachenkomplexen zu finden. Das Problem des relativen Wahrheits-
gehaltes (wie im „gebrochenen Spiegel) des Schirophrenen, die Mythenbildung und
die Dementia praecox als „abortive Initiation“ sind nur so diskussionsfühig zu
machen.V. Das Ich (die Monade, der Pilger in verschiedenen Mythen”), die Ahnen-
erinnerung, die Reinkarnation und so weiter) ist eine implicite Mannigfaltigkeit, die
durch die postmortale Autopsychoanalyse die Erfahrungen des irdischen Lebens
(Komplexe), es ist also Putnams sublimicrender Grund des moralischen Impulses,
zu Vermögen sublimiert. Ohne Theosophie ist keine wissenschaftliche
Redukation möglich. Als Ende des „Sterbens“ und des Initiation ist hier auch der
Anfang der „Geburt“ und der Wiedergeburt im Leben gegeben. Bei geheilten
Fällen von Dementia praecox kann man bisweilen diese drei Phasen
der Initiation, Sterben, Devacha und Reakirnation wieder erkennen.
Die alte Lehre von der „Prüfung zur Initiation“ ist der Jung'schen Theorie von der
Dementia praecox nahe verwandt.Ich möchte folgenden für mich sehr instruktiven Fall berichten: Ein Kata-
toniker, Patient des Professor Gelgersma Leides (Endegeest), der seit Jahren nicht
mehr gesprochen hat, wurde von einem mir befreundeten Maler (J. J. Doeser), einem
Theosophen, dessen künstlerisches Sehnen nur die Wiedergeburt der Mysterien ist,
gemalt. Nach stundenlanger Konzentration sagte der Kranke, der regungslos dage-
standen war, plötzlich „ja“ (wie das deutsche Ja).Was der gelehrte Psychiater nicht vermocht hatte, konnte die kiinstlerische Ein-
fühlung erreichen: Die ,devachanische" Stufe des von der Krankheit nicht berührten
Ichkomplexes zur Mitteilung zu reizen. Von unserem theosophischen Gesichtspunkt
glaubten wir in diesem Patienten, (es handelt sich in diesem um einen hesonderen
Fall und nicht um alle Kranken) eine ,abortive Initiation“ (die nicht zur vollständigen
Wiedergeburt führte) annehmen. zu dürfen. Das Gemälde befindet sich im Be-
sitze des Herrn H. P. van Tuyll van Terooskerkes, Amsterdam Koniginenweg 191.Durch Einfühlung in diese devachanische Stufe der Psyche kann man bei
Künstlern experimentell*) höchst interessante ,autosymbolische Haluzinationen“ von
wunderbarer Schönheit auslösen, deren Analyse jedoch nicht leicht ist. Einen Teil
des diesbezüglichen Materiales habe ich Herrn Dr. B. van de Linde, Huites (Holland),
Mitarbeiter der Zeitschrift für Psychoanalyse übergeben. Die diesbezüglichen Ex-
perimente sind meines Erachtens nach der Schlüssel zu der Magie der Initiation.
(Vergl. z. B. de Jong, Das ankike Mysterienwesen, 78 u. f.) Dr. Resink.1) Vgl. Secr. Doctr. IIT 435: Sobald jemand ins Noviziat tritt, ergeben sich
gewisse geheime Wirkungen. Die erste dieser Wirkungen ist, dass alle verborgenen
Seiten der Menschennatur nach auswärts fliessen, seine Fehler, seine Gewohnheiten,
seine guten Eigenschaften oder seine unterdriickten Wünsche, gleichgültig, ob sie
gut, schlecht oder gleichgültig sind.2) Z. В. die gnostische Hymne „Robe of Glory“, übersetzt von G. В. S. Mead
in „World Mystery“, soweit ich mich erinnere.3) Auch telepatisch und psychometrisch.
S.
Varia. 417
Uber Echtheit und Unechtheit von Gefühlen.
In dem Rahmen dieses Problemes behandelt Willi Haas in der „Zeitschrift
für Pathopsychologie* einige hochinteressante allgemeine Bestimmungen, die als philo-
sophische Gesichtspunkte fiir die Psychoanalyse in Betracht kommen. Nicht Quali-
täten, sondern allein die Struktur des Ich, meint der Autor, ist bestimmend fiir
Echtheit und Unechtheit. Ist also das Ich einer gegebenen Zeit einheitlich, 8
heisst, folgt es nur der Grundrichtung, so resultiert die Echtheit des entsprechenden
Gefiihls. Dagegen ist, um ein Gefühl unecht sein zu lassen, notwendig, dass es
Tendenzen repräsentiere, welche ausser der Grundrichtung vorhanden sind. Doch
muss man bedenken, dass mit der formalen Einheitlichkeit der Grundrichtung sehr
wohl eine Doppelheit von Gefühlen vereinbar ist. Das echte Gefühl ist das der
tieferen Schichte im Gegensatz zu dem der oberflåchlichen, und es ist ein Wider-
stand aus tieferer Schichte, der ein Gefühl zum unechten macht. Es gibt in der
Tat ein Erlebnis, in welchem dus Spezifische der Type absolut eindeutig zum Be-
wusstein kommt. Es ist in Sonderheit der Fall des aufsteigenden Geftihls: wie
wenn etwa in einer Situation der Zorn oder die Trauer nicht plötzlich packt, sondern
allmählich eindringt. Wir erleben da, wie das von den aufsteigenden Gefühlen noch
gänzlich freie Ich in merkwiirdiger Weise das Gefühl der Ruhe und Indifferenz seiner
neuen Bestimmtheit opfern muss. Damit zugleich haben wir aber ein sicheres Ge-
fühl, dass es unsere eigentliche Bestimmtheit ist, und wir fühlen uns in unserer
Ruhe in eigentiimlicher Weise bedroht und erschüttert. Sie erscheint als unecht.
Das von dem herannahenden tieferen Gefühl noch freie Ich fühlt sich der neuen
Bestimmung ausgeliefert. Selbst wenn nur ein Gefühl im Bewusstsein gegeben ist,
wenn es also eo ipso echt ist, kann die Unwidersprochenheit noch ausdrücklich durch
ein Gefühl von der Einstimmigkeit mit den inneren Tendenzen des Ich sich kund-
geben in dem Erlebnis, das wir mit den Worten beschreiben: Ich bin wahrhaft
glücklich. Ebenso kann die Unechtheit noch im besonderen Gefühl der Oberflåch-
lichkeit betont sein, so namentlich wie wenn ein Gefühl absichtlich hervorgerufen
ist, wie wenn ich für jemanden Sympathie heuchle und dieses Gefühl tatsächlich in
irgend einem Grade entsteht; dann widerspricht ihm als unechten nicht nur das
Gefühl innerer Indifferenz, sondern man hat noch ein besonderes Gefühl seiner
Forciertheit.Es kann sich auch das Gefühl der Gültigkeit und Eigentlichkeit bisweilen an
ein unechtes Gefühl heften. Diese fålschende Verschiebung erklärt sich daraus,
dass oft fiir ein unechtes Gefühl gerade weil es der Grundrichtung widerspricht, be-
sonders wirksame Motive bestehen, die sein Festhalten wünschenswert machen, um
ihm so im Gefühl der Eigentlichkeit für's Bewusstsein die Echtheit zu verleihen. In
der Gesamtheit dieser Erlebnisse, des Giiltigkeitsgefiihles fiir das Echte, des Un-
eigentlichkeitsgefühles für das Unechte, erschöpft sich das Echtheits- beziehungsweise
Unechtsbewusstsein. Der eine Begriff der Tiefe hat mit dem für Echtheit nicht das
geringste zu tun. So wird zum Beispiel eine tief erlebte Trauer unecht, wenn ihr
in der tieferen Schicht ein leichtes Gefühl der Gleičhgiiltigkeit widerspricht. Der
zweite Begriff der Tiefe ist der, welcher diese an die Zugehörigkeit zum Ich als
Charakter misst. Der Gesichtspunkt der Anordnung ist also die zum Teil fixierte
zum Teil noch im Fluss befindliche Persönlichkeit und der Grad der Tiefe wird be-
messen nach dem Grade, in dem das Gefühl als für die Konstituierung des Charakters
wesentlich betrachtet wird. Zwischen echtem und charakteristischem Gefühl besteht
gar kein innerer Zusammenhang, so dass ein Gefühl, das dem Charakter widerspricht,
sehr wohl echt sein kann. Es entspricht etwa meinem Wesen froh und lebendig zu
sein, aber ich bin in einer gewissen Situation missgestimmt und gelähmt, habe
aber ein deutliches Bewusstsein, dass ich meiner Natur nach froh sein sollte. An-S.
418 Varia.
dererseits mag ein im übrigen fir das Individuum charakteristisches Gefühl als un-
echt auftreten und bleibt charakteristisch, wie in diesem Beispiel der Frohsinn. So
pflegen unechte Gefühle überhaupt charakteristischer zu sein als echte und reichere
Ausbeute fiir die Feststellung der Individualität zu liefern. Schon deshalb, weil
die Zahl allgemein zirkulierender Gefühle, die widerspruchslos angenommen werden,
sehr gross ist, und die fiir den einzelnen charakteristischen Gefühle erst neben diesen
zu finden sind. Nur muss die Bedeutung der unechten Gefühle erst erschlossen
werden durch Rückgang auf vielleicht unbewusste Motive, die das unechte Gefühl
zur Folge hat. So wird man in die Individualität selbst geführt und entdeckt in
ihr verborgene Regungen.Für die Psychoanalyter sind die Ausführungen über die Phänomenologie des
Widerspruchs der Empfindungen interessant. Es muss immer ein echtes Gefühl da
sein. Das unechte Gefühl kann isoliert nicht vorkommen. Die beiden Gefühle
mögen nebeneinander ruhig liegen. Es tritt eines der beiden zum anderen in die
eigenartige Beziehung zur Tiefe — etwa der besonders dazu prüdestinierte Eckel als
das tiefere — meist aber nicht notwendig wird mit dieser grundsätzlichen Verän-
derung der Dignität auch die Tendenz, zur Irradiation sich einstellen. Das will dann
sagen, dass der Eckel eine solche Stelle im Ich hat, dass er, sich auf sein ursprüng-
liches Objekt nicht mehr beschrünkend, die innerliche Verfassung des Ich allein be-
stimmt, und so ist damit, dass im Grunde alles eckelhaft erscheint, auch das noch
vorhandene Gefühl der Sympathie für eine andere Person unecht. Gerade für die
unechten Gefühle bestehen Motive, die sie wünschenswert sein lassen. Eine Person
hatte etwa Gründe, eine andere ihren Zorn fühlen zu lassen oder ihr Mitleid, ob-
gleich es echt ist, zu verbergen. Sie flieht also vor diesem, und verbohrt
sich gleichsam in den Zorn, dessen Intensität dadurch unnatiirlich steigernd. Und
die Scheidung zwischen echtem und unechtem Gefühl kann phünomenal so weit
aufgehoben sein, dass sie zu einem relativ einheitlichen Mischgefühl ver-
schmelzen.Es gibt einen Punkt im Ich, der in jedem Moment die Erlebnisse fundamental
sondert, in echte und unechte. Ihn müssen die Erlebnisse passieren, um in die
Schichte der Echtheit einzurücken welche das neue Verhültnis zum leh, das der
Eigentlichkeit bezeichnet. Dieser kritische Punkt verschiebt sich bestündig im Ab-
lauf des Psychischen und ist einer fortwährend variierenden Reizschwelle vergleich-
bar. Das echte Gefühl ist gleichsam der stumme Hüter der Schwelle. Es gibt für
das Passieren des kritischen Punktes ein Erlebnis: das Spielen mit einem Gefühl,
das unecht ist, wir haben auch das Bewusstsein, innerlich nicht berührt zu werden.
Aber plötzlich erfolgt ein Umschlag und, was bisher unecht und äusserlich war,
wird plótzlich unweigerliche Bestimmtheit des Ich. In dieser Umkehr passiert also
das Unechte den kritischen Punkt und besetzt dio Schichte der Echtheit. Indem
das echte Gefühl für jeden Moment die Lage des kritischen Punktes angibt, ist es
auch der einzige Massstab, an dem Echtheit und Unechtheit gemessen werden
kónnen.Man kann ein phünomenales Datum in immer tiefere Schichten zurückverfolgen,
Bestimmtheit taucht hinter Bestimmtheit auf, ohne dass sie phánomenal gegeben
würen. Und eine Psyche ist desto komplizierter, je weniger die Bedeutung eines
phünomenalen Datums, sich in dem, was eben phiinomenal ist, erschöpft, je reicher
die müglichen Ersetzungen sind. Es entscheidet weder die Aufrichtigkeit noch Un-
aufrichtigkeit der Überzeugung, noch die der Willensrichtung über Echtheit und Un-
echtheit des Gefühles; die erste nicht, weil sie sich schon auf das schon Fixierte
bezieht, die letztere nicht, weil sie nicht alle in der bestimmten Zeit gegebenen Ten-
denzen übersehen kann. Interpretiert man den Tatbestand der Echtheit und Un-S.
Varia. 419
echtheit mit Riicksicht auf die Gesamtheit des Ich, so kann man sagen: Die Vor-
handenbeit des unechten Gefühls als des aus der Tiefe widersprochenen weist hin auf
den Mangel innerer Einstimmigkeit. Einen grundehrlichen Charakter nennt man
den, bei dem durch Naturanlage oder Selbsterziehung die unechten Gefühle gänzlich
ausgeschaltet sind.Die Verpflichtung des Namens.
In seinen Memoiren berichtet Benvenuto Cellini von einer Reise, die
er mit zwei Männern nach Venedig machte. Der eine hiess Trebolo, der andere
Lamentino. Also im Deutschen ausgedrückt Zitterer und Jammerer. Beide machten,
wie der Übersetzer bemerkt, ihrem Namen grosse Ehre. Sie waren beide ausser-
ordentlich furchtsam. Jammerer und Zitterer bewährten sich auf der ganzen Reise
als das, was ihr Name von ihnen kündete. Stekel.Eine Verwahrung gegen irrtiimliche Beurteilung der Jugend-Psychanalyse.
Die unterzeichneten Pädagogen erklären gegenüber der auf irrttimlichen und
einseitigen Annahmen beruhenden in Breslau beschlossenen „Warnung vor den Uber-
griffen der Jugend-Psychanalyse*:1. Mit den beiden Hauptsätzen der Erklärung sind wir einverstanden. Wir be-
trachteten die psychanalytische Methode von jeher lediglich als eine Methode
neben anderen und verwerfen ihre direkte Anwendung am normalen Kinde, so-
fern sie zu einer ,Entharmlosung“ (Stern) führen kann.2. Dagegen halten wir eine vorsichtig angewendete Psychanalyse gewisser kranker
Kinder durch den taktvollen und kundigen Arzt oder unter seiner Leitung durch
den besonders ausgebildeten Erzieher für ein höchst wertvolles Mittel zur Heilung
und ,Verharmlosung“, zumal wo ein Kind unter bewussten oder unbewussten
hässlichen Vorstellungen bereits leidet; vor dilettantischer Kinderanalyse ist zu
warnen.3. Die Pädagogik hat ein starkes Interesse an der Ausbildung der wissenschaft-
lichen Pädanalyse, sofern die an kranken Kindern und Jugendlichen, sowie an
Erwachsenen gewonnenen Analysen wichtige Rückschlüsse auf die psychologi-
schen Vorgänge und die pädagogische Beeinflussung normaler Kinder zulassen.4. Die Unterzeichner der Breslauer Erklärung kennen nur die eine Seite der Psych-
analyse: Die Untersuchung und Aufdeckung der Sexualität. Wir sehen jedoch
in der Psycho-Analyse, der Bedeutung des Wortes entsprechend, nicht nur dies.
Denn wir sind überzeugt, dass auch diejenigen Kräfte des unbewusten Seelen-
lebens zu erkennen sind, die den Menschen seiner hóchsten Bestimmung zu-
führen. Somit wird die Psychanalyse ganz besonders auch bewusst zu machen
haben, welche unbewussten Hemmungen zu beseitigen, und welche persónlichen
Lebensaufgaben zu erfüllen sind. In wissenschaftlicher Hinsicht soll die Pád-
analyse denjenigen Interpretationen den Vorzug geben, die den Normen der In-
duktion entsprechen.H. Baur, Pfarrer in Basel; G. Blattmann, Lehrer in Luino (Italia); Uni-
versitütsprofessor Dr. P. Bo vet, Direktor der „Ecole des Sciences de l'Education
(Institut J. J. Rousseau)“, Genf; Prof. Dr. med. E. Claparède, Redaktor der
„Archives de psychologie“, Genf; E. Etter, Pfarrer in Rorschach (Kt. St. Gallen);
Th. Flournoy, Prof. der Psychologie an der Universität Genf; U. Heller, Pfarrer
a. D. Direktor des Knabeninstitutes Rorschach; R. Heusser, Lehrer in Zürich;S.
420 Varia.
Adolf Keller, Pfarrer in Zürich; Prof. Dr. W. Klinke, Seminarlehrer für Påda-
gogik, Zürich; Ernst Linde, Lehrer und Schriftleiter, Gotha; A. Lüthi, Seminar-
lehrer für Pädagogik, Küsnacht (Kt. Zürich); Dr. phil. O. Mensendieck, Lehrer
am Sanatorium Dr. Bireher, Zürich; Prof. Dr. О. Messmer, Seminarlehrer für Püda-
gogik, Rorschach (Kt. St. Gallen); J. Niedermann, pädagogischer Leiter des årztl.
Landerziekungsheims Breitenstein, Ermatingen (Kt. Thurgau); Ad. Pfister, Lehrer
in Zürich; Dr. phil. O. Pfister, Pfarrer und Seminarlehrer, Zürich; Dr. F. Pinkus,
Schriftleiter der Zeitschrift für Jugenderziehung und Jugendfiirsorge, Zürich; Dr. E.
Schneider, Dir. des kant. Oberseminars, Bern; Dr. phil. Eugenia Sokolnicka,
Zürich; J. Stelzer, Sekundarlehrer, Meilen (Kt. Zürich); H. Steiger, Sekundar-
Jehrer, Zürich; A. Waldburger, Irrenhausgeistlicher, Ragaz (Kt. St. Gallen).Redaktionelle Mitteilungen.
Eine „Zeitschrift für Sexualwissenschaft" (Internationales Zentralblatt für
die Biologie, Psychologie, Pathologie und Soziologie des Sexuallebens) werden Pro-
fessor A. Eulenburg und Dr. Iwan Bloch im Verlage von A. Marcus & Weber
(Dr. jur. Albert Ahn) in Bonn herausgegeben.Dr. Max Hirsch (Berlin) gibt ein neues Archiv heraus: Das Archiv fiir
Frauenkunde. Es soll das gesamte Frauenleben von biologischen und psycholo-
gischen Gesichtspunkten erforschen. Eine Reihe bedeutender Mitarbeiter sichert
dem Archiv ein allgemeines Interesse.Grenzfragen der Medizin und Pädagogik. Unter diesem Titel gibt Dr.
Wilhelm Stekel eine längere Reihe kleiner Schriften heraus, die sich mit den
Erziehungsfragen auf Grund ärztlicher Erfahrung befassen werden. Die ersten Hefte
enthalten: Amtsgerichtsrat Dr. Erich Wulffen: Kriminalität und Erziehung; Dr.
Magnus Hirschfeld und Dr. Ernst Burchardt: Homosexualität und Erziehung;
Dr. Beni Buxbaum: Der Kopfschmerz ein Erziehungsproblem; Dr. Wilhelm
Stekel: Die Prophylaxe des Stotterns. Mitarbeiter, welche einschligige Themen
behandeln wollen, werden ersucht, sich an Dr. Stekel zu wenden. Der Umfang
jeder Arbeit darf drei Druckbogen nicht überschreiten.In der im Verlage von L. Staackmann in Leipzig erscheinenden neuen Revue
„Der Turmhahn' behandelt Dr. Wilhelm Stekel die Wandlungen der Psycho-
analyse in einem Artikel „Probleme der modernen Seelenforschung*,
zb4191478