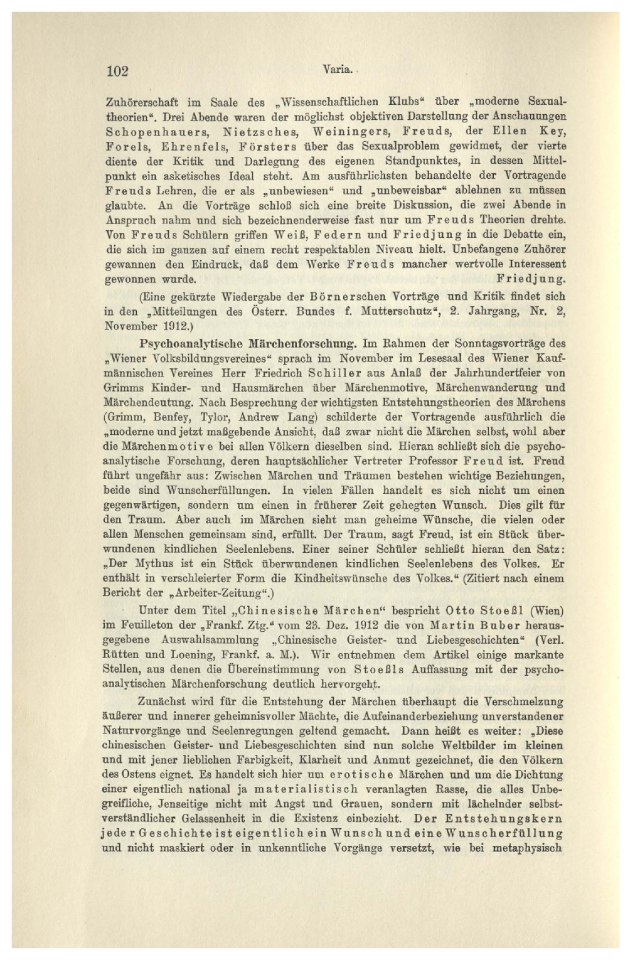S.
Varia.
1Zur psychoanalytischen Bewegung.
Der Präsident der „Internat. Psychoanalyt, Vereinigung“ Dr, С. G. Jung (Zürich)
hat im Herbst dieses Jahres eine Reihe von Vorträgen in New-York gehalten, die in
der ,New-York Times“ vom 29. September 1912 zum Teil wiedergegeben und
sympathisch besprochen sind. Die Veröffentlichung dieser Vorträge in englischer und
deutscher Sprache steht bevor.Prof. Dr. Oskar Messmer in Rorschach (Schweiz) gibt in den ,Berner
Seminarblättern“ (VI. Jahrgang, Heft 12 bis inkl. 17, Sept./Dez. 1912) an Hand einer
ausführlichen Darstellung der psychoanalytischen Lehre und Literatur eine sehr ver-
ståndnisvolle und in warmem Ton gehaltene Wiirdigung der Psychoanalyse und ihrer
allgemeinen Bedeutung, deren Lektiire aufs beste empfohlen werden kann.Dr. Viktor Tausk (Wien) hålt gegenwiirtig eine Serie von 20 Vortrågen unter
dem Titel „Theoretische und praktische Einführung in die Psychoanalyse“. Die Vor-
träge werden jeden Dienstag abends von 8—10 Uhr im „Institut für Therapie nervôser
Gehstórungen* des Herrn Dr. Karl Weiß, Wien, IV. Schwindgasse 14, abgehalten.
Die Zahl der Zuhörer, die sich aus Ärzten und Studenten zusammensetzt, beträgt 40.
Zum SchluB eines jeden Vortrages findet eine Diskussion statt.Uber ,Sexualpidagogik und sexuelle Abstinenz“ sprach vergangenen
Sommer Dr. Heinr. Körber (Berlin) im Rahmen der Vortragsabende des „Bundes
für Mutterschutz“ (Ortsgruppe Berlin) mit eingehender Würdigung der psychoanalyt.
Lehren, Dieser sowie der daran schließende Vortrag (Dr. Marcuses) und die Dis-
kussion sind gekürzt wiedergegeben in „Die neue Generation“, hg. v. Dr. Helene
Stocker, 8. Jahrgang, Juliheft 1912.Prof, Albert Eulenburg gibt im Morgenblatt der Vossischen Zeitung vom
31. Oktober 1912 in einem „Zur Theorie nervôs-seelischer Störungen“ überschriebenen
Artikel auch eine kurze Darstellung der Freudschen Neurosenlehre, die er mit
folgenden Worten schließt: „Es drängt mich daher, auszusprechen, daß, wie immer
auch das Urteil im einzelnen sich gestalten möge, die Wissenschaft unter allen
Umständen dem Schöpfer und Gestalter dieser Lehre für viele geistvolle und frucht-
bare Anregungen und vor allem für die stärkere Betonung des mit Unrecht zu lange
ausgeschlossenen oder geringschätzig behandelten seelischen Moments in der
Entstehung und Entwicklung der Neurosen zu lebhaftem Danke verpflichtet sein wird.“Prof. Freuds Studie „Der Wahn und die Träume in W. Jensens
Gradiva“ (1. Heft der Schriften 2. angew. Seelenkunde, 2. Aufl. 1912, F. Deuticke)
ist kürzlich in russischer Übersetzung in der von Dr. M. Wulff (Odessa) redigierten
Sammlung „Leben und Seele“ erschienen. Im selben Band ist auch die Novelle
Jensens übersetzt.Eine öffentliche Diskussion über Freuds Sexualtheorie. Im Rahmen eines
vom „Österreichischen Bunde für Mutterschutz“ und der ,Ethischen Gesellschaft“
in Wien veranstalteten Vortragszyklus sprach der Wiener Schriftsteller Wilh.
Börner an vier Abenden des Oktobers und Novembers 1912 vor einer zahlreichenS.
102 Varia.
Zuhórerschaft im Saale des „Wissenschaftlichen Klubs“ über „moderne Sexual
theorien“, Drei Abende waren der möglichst objektiven Darstellung der Anschauungen
Schopenhauers, Nietzsches, Weiningers, Freuds, der Ellen Key,
Forels, Ehrenfels, Førsters über das Sexualproblem gewidmet, der vierte
diente der Kritik und Darlegung des eigenen Standpunktes, in dessen Mittel-
punkt ein asketisches Ideal steht. Am ausführlichsten behandelte der Vortragende
Freuds Lehren, die er als ,unbewiesen“ und „unbeweisbar* ablehnen zu müssen
glaubte. An die Vorträge schloß sich eine breite Diskussion, die zwei Abende in
Anspruch nahm und sich bezeichnenderweise fast nur um Freuds Theorien drehte.
Von Freuds Schülern griffen Weiß, Federn und Friedjung in die Debatte ein,
die sich im ganzen auf einem recht respektablen Niveau hielt. Unbefangene Zuhörer
gewannen den Eindruck, daß dem Werke Freuds mancher wertvolle Interessent
gewonnen wurde, Friedjung.(Eine gekürzte Wiedergabe der Börnerschen Vorträge und Kritik findet sich
in den „Mitteilungen des Österr. Bundes f. Mutterschutz“, 2. Jahrgang, Nr, 2,
November 1912.)Psychoanalytische Märchenforschung. Im Rahmen der Sonntagsvortråge des
„Wiener Volksbildungsvereines“ sprach im November im Lesesaal des Wiener Kauf-
männischen Vereines Herr Friedrich Schiller aus Anlaß der Jahrhundertfeier von
Grimms Kinder- und Hausmärchen über Märchenmotive, Märchenwanderung und
Märchendeutung. Nach Besprechung der wichtigsten Entstehungstheorien des Märchens
(Grimm, Benfey, Tylor, Andrew Lang) schilderte der Vortragende ausführlich die
„moderne und jetzt mafigebende Ansicht, daß zwar nicht die Märchen selbst, wohl aber
die Märchenmotive bei allen Völkern dieselben sind. Hieran schließt sich die psycho-
analytische Forschung, deren hauptsichlicher Vertreter Professor Freud ist. Freud
führt ungefähr aus: Zwischen Märchen und Träumen bestehen wichtige Beziehungen,
beide sind Wunscherfüllungen. In vielen Fällen handelt es sich nicht um einen
gegenwärtigen, sondern um einen in früherer Zeit gehegten Wunsch. Dies gilt für
den Traum. Aber auch im Märchen sieht man geheime Wünsche, die vielen oder
allen Menschen gemeinsam sind, erfüllt. Der Traum, sagt Freud, ist ein Stück über-
wundenen kindlichen Seelenlebens. Einer seiner Schüler schließt hieran den Satz:
„Der Mythus ist ein Stück überwundenen kindlichen Seelenlebens des Volkes, Er
enthält in verschleierter Form die Kindheitswünsche des Volkes.“ (Zitiert nach einem
Bericht der „Arbeiter-Zeitung“.)Unter dem Titel „Chinesische Märchen“ bespricht Otto 810681 (Wien)
im Feuilleton der „Frankf. Ztg. vom 28. Dez. 1912 die von Martin Buber heraus-
gegebene Auswahlsammlung „Chinesische Geister- und Liebesgeschichten“ (Verl.
Rütten und Loening, Frankf. a. M.). Wir entnehmen dem Artikel einige markante
Stellen, aus denen die Ubereinstimmung von StoeBls Auffassung mit der psycho-
analytischen Märchenforschung deutlich hervorgeht.Zunächst wird für die Entstehung der Märchen überhaupt die Verschmelzung
äußerer und innerer geheimnisvoller Mächte, die Aufeinanderbeziehung unverstandener
Naturvorgänge und Seelenregungen geltend gemacht. Dann heißt es weiter: „Diese
chinesischen Geister- und Liebesgeschichten sind nun solche Weltbilder im kleinen
und mit jener lieblichen Farbigkeit, Klarheit und Anmut gezeichnet, die den Völkern
des Ostens eignet. Es handelt sich hier um erotische Märchen und um die Dichtung
einer eigentlich national ja materialistisch veranlagten Rasse, die alles Unbe-
greifliche, Jenseitige nicht mit Angst und Grauen, sondern mit lächelnder selbst-
verständlicher Gelassenheit in die Existenz einbezieht. Der Entstehungskern
jeder Geschichte ist eigentlich ein Wunsch und eine Wunscherfüllung
und nicht maskiert oder in unkenntliche Vorgänge versetzt, wie bei metaphysischS.
Varia. 103
gerichteten oder religiös und sittlich durch eiserne Vorurteile bezwungenen Völkern,
sondern direkt und unverhüllt in der Erfindung ausgedrückt.“„Die höchste Einheit von Wunsch und Wirklichkeit, Natur und Dasein der
Menschen symbolisiert sich im nåchstgegebenen Bild der Gesellung von Mann
und Weib und alle diese Geschichten machen diesen Traum wahr, gelten diesem
zugleich physischen und metaphysischen Begehren.“„Eigentlich ist jedes Kunstwerk ein Wunschgebilde und die Sehnsucht
alles Irdischen hat von je Gott und Teufel an die Wand gemalt, um den Überschuß
an Sinnen- und Gefühlkraft, der über die Sicherung der eigenen Existenz hinaus
deren Verewigung begehrte, zugleich zu erlösen und zu beschwören. Was das Leben
nicht gewährt, die volle Einheit von Mensch und Natur, die Befreiung und höchste
Steigerung des Ichs zum All, das Kunstwerk drückt sie, freilich in einer frag-
würdigsten Unwirklichkeit und in einer anderen Sphäre als der Realität machtvoll aus.
Es gibt, wie die Religion, dieaus dem gleichen Wunsche geboren wird,
eine Erfüllung, die nicht von dieser Welt ist, es tröstet durch Täu-
schung und erhebt durch Träume, es erfüllt mit Schein statt mit
Sein, aber diese unwirkliche Quelle ist dennoch kühl und stillt den
Durst, diese Dunstnahrung sättigt, dieses Traumgebilde befriedigt,
mehr als alles Wirkliche, Mögliche und Erreichbare, ja es schafft eine
höhere, tröstlichere Welt der Gedanken und Gefühle, kurz es leistet alles, was kein
Mensch durch sein Tun erreichen kann, in seinem Spiel und gibt, was kein Tag
erzeugen kann, in der Dämmerung des Traumes. Das Bewußtsein der Unmöglichkeit
und Unwirklichkeit gerade erhöht den Zauber aller künstlerischen Hervorbringung.“på
Aus Dichtern.J. Barbey d'Aureville hat in der Novelle „Don Juans schónstes Liebesaben-
teuer“ (aus „Die Touflischen“) eine infantile Sexualtheorie zum Gegenstand
genommen. Graf Ravila von Ravilés (vergl. ravilir, schånden) erzählt von dem dreizehn-
jährigen Tóchterchen einer Geliebten, das auf die Mutter eifersüchtig ihre Liebe für
denselben Mann hinter Scheu und Trotz verbarg, eines Tages aber sich von demselben
für geschwängert hält und zu verzweifeln droht, Der entsetzten Mutter erzählt nun
das Kind den Hergang: „Mutter, es war an einem Abend. Er saß auf dem großen
Fauteuil am Kamin, der Causeuse gegeniiber. Er blieb lange dort sitzen, dann stand
er auf und ich, ich war so ungliicklich, mich nach ihm auf den Fauteuil zu setzen,
den er verlassen hatte. O! Mama!...... es war, als wåre ich ins Feuer gefallen.
Ich wollte aufstehen, ich konnte nicht . . mir wurde ganz schwach ums Herz!.. und ‥
siehst du, Mama! , , . Da . . da fühlte ich .. was mir fehlte , und daß ich da drinnen
ein Kind habe!“ Dr. E. H.К. Р. Moritz macht in dem zur Goethezeit erschienenen, autobiographischen
Roman „Anton Reiser" folgende, viel Verständnis fir den Harnreiztraum und die
Psychogenese der Phobie verratende Bemerkung: „Es fällt daher auch wirklich in
der Kindheit oft schwer, das Wachen vom Traume zu unterscheiden und ich erinnere
mich, daß einer unserer größten, jetzt lebenden Philosophen, mir in dieser Rücksicht
eine sehr merkwiirdige Beobachtung aus den Jahren seiner Kindheit erzåhlt hat. Er
war wegen einer gewissen bösen Angewohnheit, die bei Kindern sehr gewöhnlich ist,
mit der Rute geziichtigt worden, Es hatte ihm aber, wie es auch gewöhnlich ist,
immer sehr lebhaft getråumt, er habe sich an die Wand gestellt und .... Wenn er
sich nun manchmal bei Tage zu dem Ende wirklich an die Wand gestellt hatte, so
fiel ihm die harte Züchtigung ein, die er so oft erlitten hatte — und er stand oftS.
104 Varia.
lange an, ehe er es wagte, einem dringenden Bedürfnis der Natur genüge zu tun,
weil er befürchtete, es möchte wieder ein Traum sein. fiir den er wieder eine scharfe
Zichtigung erwarten müßte 一 bis er sich erst allenthalben umgesehen und dann
auch in Ansehung der Zeit zurückgerechnet hatte, ehe er sich völlig überzeugen
konnte, daß er nicht träume, Dr. E. H.
In Karl Inmermanns (1796—1840) Roman „Die Epigonen“, dessen Held, Her-
mann, an einer Inzestphantasie psychisch leidet, wird das Wesen der Gemiitsstórung
in merkwürdiger Vorahnung der psychoanalytischen Auffassung von einem Arzte er-
faBt: „Hier wurde mir die seltenste und bedauernswerteste Geisteskrankheit sichtbar,
die ich je wahrgenommen habe. Hermann war körperlich gesund. Die Blässe seines
Antlitzes, die Mattigkeit seiner Augen hinderte nicht, daß alle Lebensfunktionen bei
ihm den natürlichen, regelrechten Gang nahmen.... Auch war עס keineswegs wahn-
oder blódsinnig . . . Dennoch war er im Kern des Seins gestört, ja getötet. Das Leben,
welches in Freude und Leid, in Begehren und Verabscheuen, in Liebe und Haß, in
den Wechselbeziehungen zu unseren Nebenmenschen besteht, war in ihm durch eine
schreckliche Erinnerung ausgelóscht. Er weinte und lachte über nichts, ein stehendes
gleichgültiges Lächeln machte seine Züge zur Maske. Er wollte nichts und wendete
sich von nichts hinweg, er hatte keinen Freund und keinen Feind, die besonderen
Verhältnisse anderer waren für ihn so wenig vorhanden, als seine eigenen, mit einem
Worte: Das Individuum schien in ihm völlig untergegangen zu sein. Nur allgemeine
Vorstellungen nahm diese Seele, wie ein leeres Gefäß noch auf, ohne die Federkraft
zu besitzen, sie in ihr Eigentum zu verarbeiten und daraus die Nahrung zu Ent-
schliissen zu saugen. So lebte er, scheinbar ein Mensch, aber ohne Anteil, und in der
Tat den Kreisen, welche unser Dasein umschliefen, entrückt, seine Tage hin. Die
Zeit war fiir ihn keine Zeit, denn er empfand den Wechsel der Begebenheiten nicht,
der Ort kein Ort, denn keine Sympathie fesselte ihn mehr an eine Stitte. Es war
der Zustand der Pflanze, er vegetierte. Daß in einer so vernichteten Seele dennoch
richtige Anschauungen, ja Ideen einkehren konnten, bestätigte meine alte Überzeugung
von der Natur der menschlichen Seele iiberhaupt...... i
Der Arzt hat eine große Aufgabe in der Gegenwart zu låsen. Krank-
heiten, besonders die Nerventibel, wozu seit einer Reihe von Jahren das Menschen-
geschlecht vorzugsweise disponiert ist, sind das moderne Fatum. Was in frischeren,
kürzer angebundenen Zeiten sich mit einem DolchstoBe, mit anderen raschen Taten
der Leidenschaft Luft machte, oder hinter die Mauern des Klosters flüchtete, das nagt
jetzt inmitten scheinbar erträglicher Zustände langsam an sich, untergråbt sich von
innen aus, zehrt unbemerkt an seinen edelsten Lebenskriften, bis dann jene Leiden
fertig und ausgebildet dastehen. Zwischen diese verlarvten Schicksale ist nun der
Arzt gestellt. Er muß, will er seinen Beruf mit Weisheit erfüllen, ein Eingeweihter sein,
Gott und die Welt im Busen tragen, er muß gewissermaßen das Amt eines Priesters
und Hierophanten üben. Mittel und Wege hat er aufzufinden, wozu ihm die materiamedica keine Anleitung gibt.“ R.
g gi
z119131
101
–104