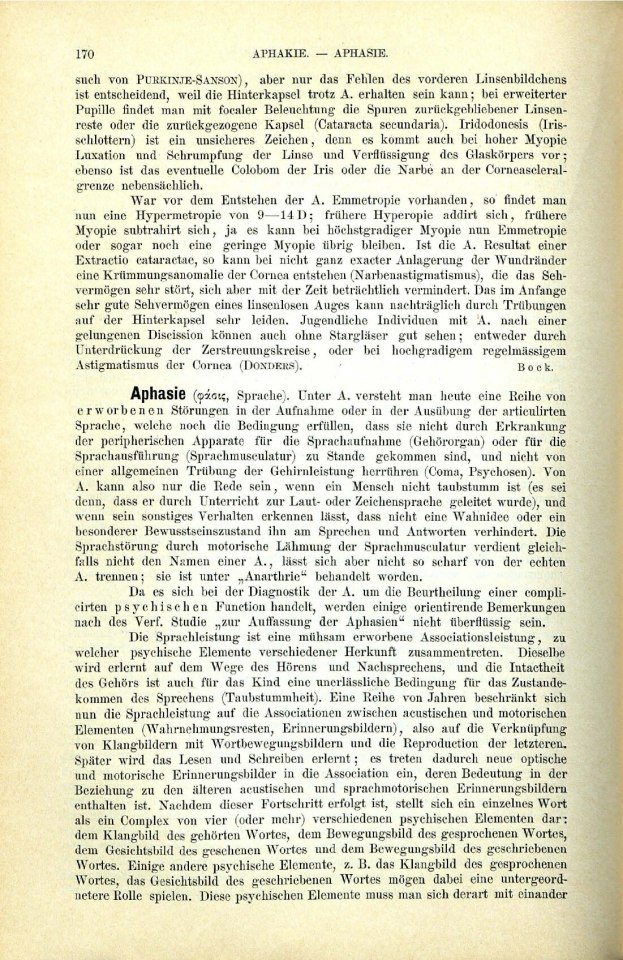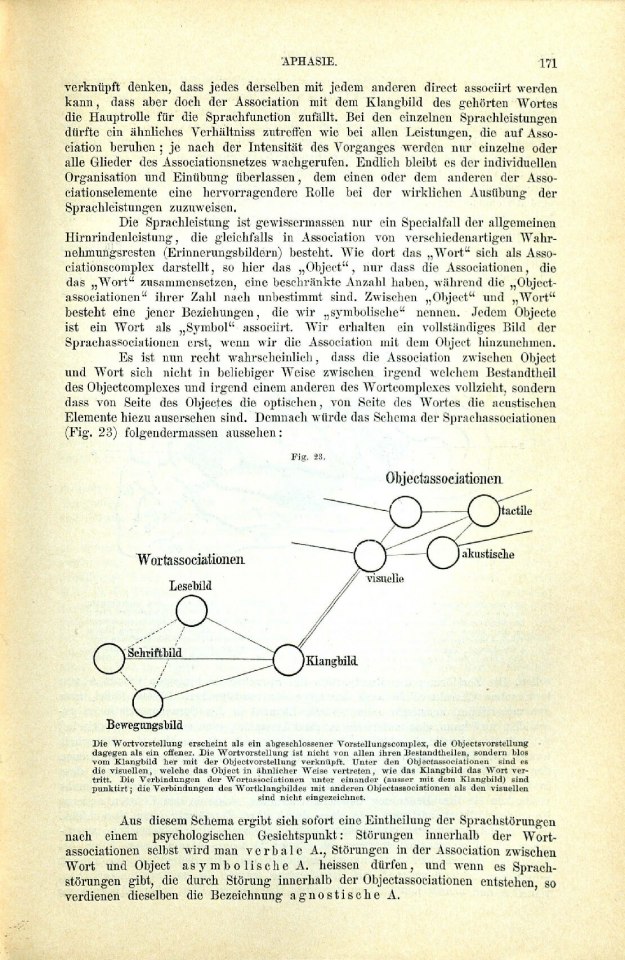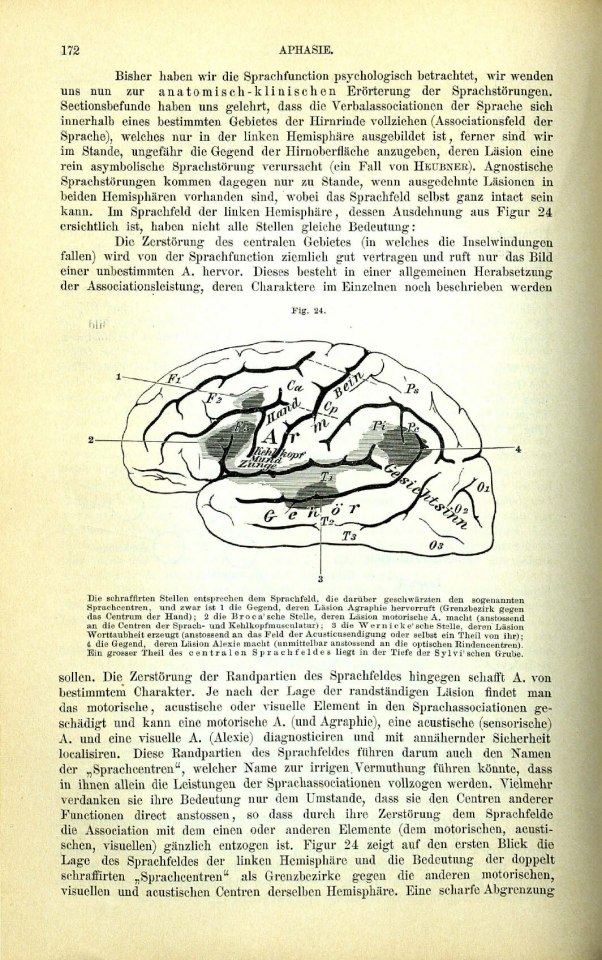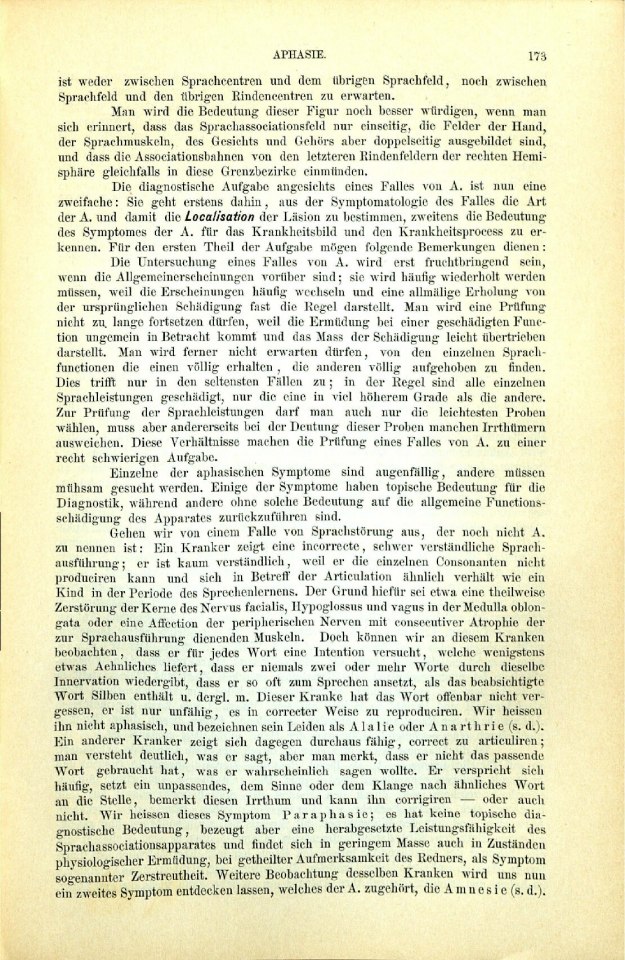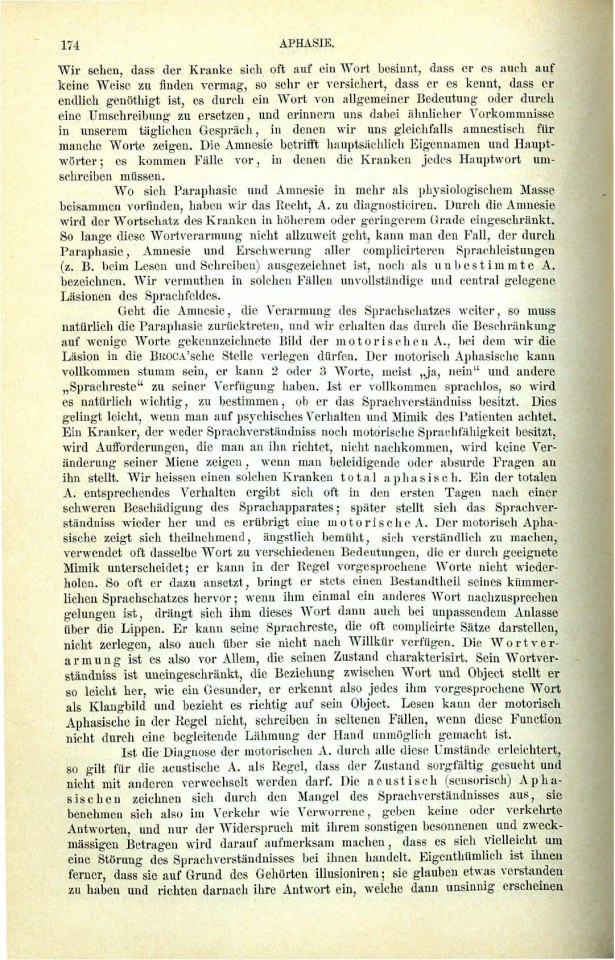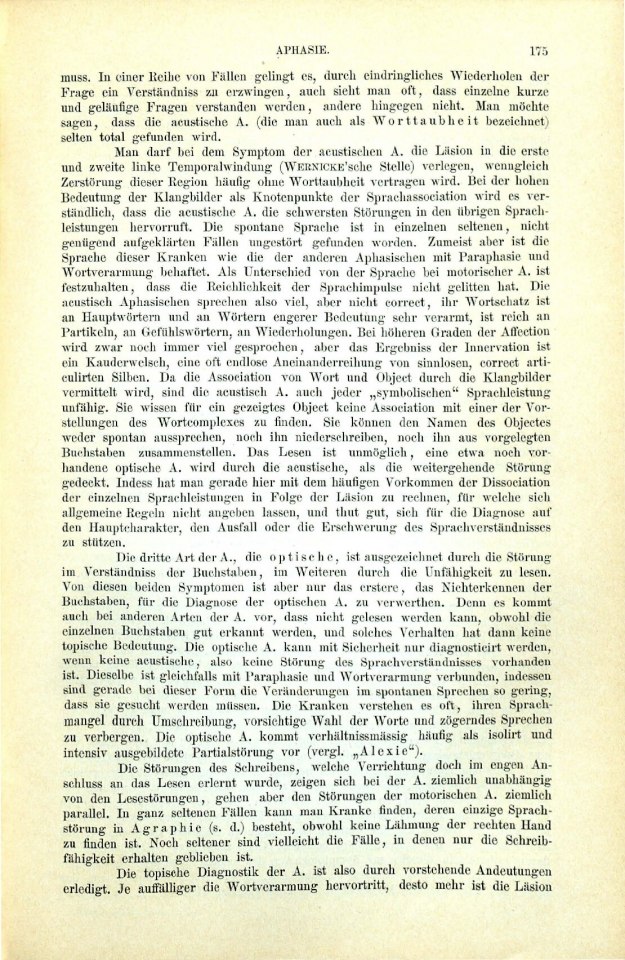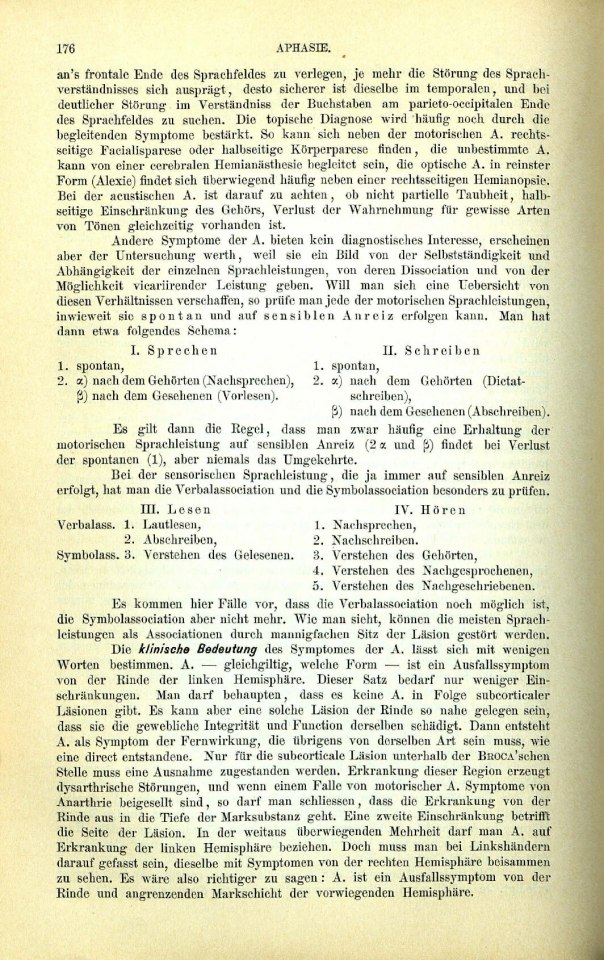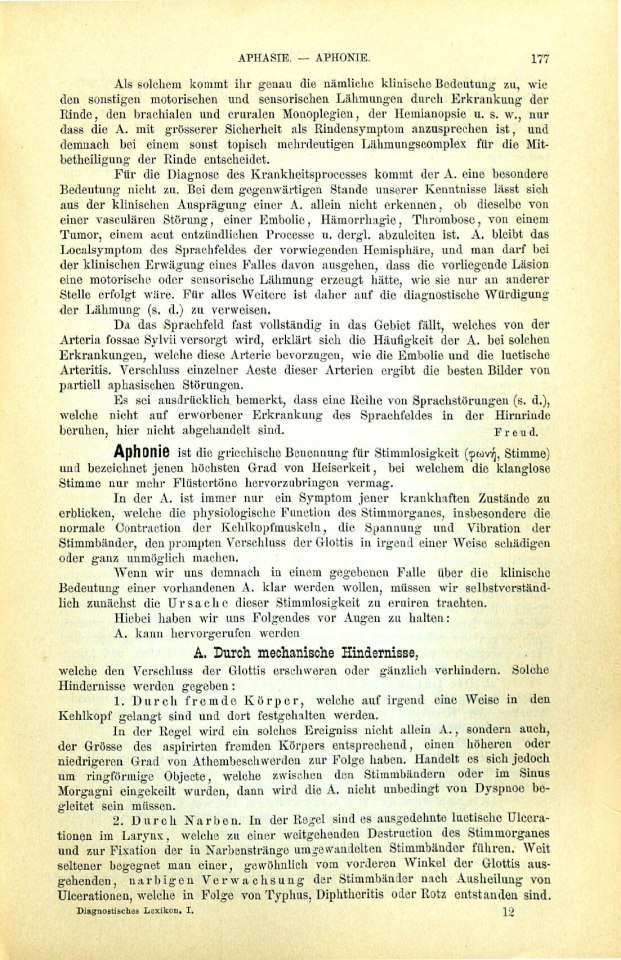S.
Aphasie (φάσις, Sprache). Unter A. versteht man heute eine Reihe von
erworbenen Störungen in der Aufnahme oder in der Ausübung der articulirten
Sprache, welche noch die Bedingung erfüllen, dass sie nicht durch Erkrankung
der peripherischen Apparate für die Sprachaufnahme (Gehörorgan) oder für die
Sprachausübung (Sprachmusculatur) zu Stande gekommen sind, und nicht von
einer allgemeinen Trübung der Gehirnleistung herrühren (Coma, Psychosen). Von
A. kann also nur die Rede sein, wenn ein Mensch nicht taubstumm ist (es sei
denn, dass er durch Unterricht zur Laut- oder Zeichensprache geleitet wurde) und
wenn sein sonstiges Verhalten erkennen lässt, dass nicht ein Wahnideé oder ein
besonderer Bewusstseinszustand ihn am Sprechen und Antworten verhindert. Die
Sprachstörung durch motorische Lähmung der Sprachmusculatur verdient gleich-
falls nicht den Namen einer A.; sie bildet nicht so scharf von der echten
A. trennen; sie ist unter Aponeurotik behandelt worden.Da es sich bei der Diagnostik der A. um die Beurtheilung einer compli-
cirten psychischen Function handelt, werden einige orientirende Bemerkungen
nach der Verf. Studio der Auffassung der „Aphasia“ nicht überflüssig sein.Die Sprachleistung ist eine mühsam erworbene Gewohnheitsleistung; zu
welcher psychische Elemente verschiedener Herkunft zusammentreten. Dieselbe
wird erlernt auf dem Wege des Hörens und Nachsprechens, und die Intactheit
des Gehörs ist auch für das Kind eine unerlässliche Bedingung für das Zustande-
kommen des Sprechens (Taubstummheit). Eine Reihe von Jahren beschränkt sich
nun die Sprachleistung auf die Association zwischen acoustischen und motorischen
Elementen (Wahrnehmungsresten, Erinnerungsbildern), also auf die Verknüpfung
von Klangbildern mit Wortbewegungsbildern und die Reproduction der letzteren.
Später wird das Lesen und Schreiben erlernt; es treten dadurch neue optische
und motorische Erinnerungsbilder in die Association ein, deren Bedeutung in der
Beziehung zu den älteren acoustischen und sprachmotorischen Erinnerungsbildern
enthalten ist. Nachdem dieser Fortschritt erfolgt ist, steht sich ein einzelnes Wort
als ein Complex von vier (oder mehr) verschiedenen psychischen Elementen dar:
dem Klangbild des gehörten Wortes, dem Bewegungsbild des gesprochenen Wortes,
dem Gesichtsbild des gesehenen Wortes und dem Bewegungsbild des geschriebenen
Wortes. Einige andere psychische Elemente, z. B. das Klangbild des gesprochenen
Wortes, das Gesichtsbild des geschriebenen Wortes mögen dabei eine untergeord-
netere Rolle spielen. Diese psychischen Elemente muss man sich derart mit einanderS.
171
APHASIE.
verknüpft denken, dass jedes derselben mit jedem anderen direct associirt werden
kann, dass aber doch der Association mit dem Klangbild des gehörten Wortes
die Hauptrolle für die Sprachfunction zufällt. Bei den einzelnen Sprachleistungen
dürfte ein ähnliches Verhältniss zutreffen wie bei allen Leistungen, die auf Asso=
ciationen beruhen: je nach der Intensität des Vorganges werden nur einzelne oder alle
Glieder des Associationsnetzes wachgerufen. Endlich bleibt es den individuellen
Organisation und Einübung überlassen, dem einen oder dem anderen der Asso=
ciationselemente eine hervorragendere Rolle bei der wirklichen Ausübung der
Sprachleistungen zuzuweisen.
Die Sprachleistung ist gewissermassen nur ein Specialfall der allgemeinen
Hirnrindenleistung, die gleichfalls in Association von verschiedenartigen Wahr=
nehmungsresten (Erinnerungsbildern) beruht. Wie dort das „Wort“ sich als Asso=
ciationscomplex darstellt, so hier das „Object“; nur dass die Associationen, die
das „Wort“ zusammenfassen, eine beschränkte Anzahl haben, während die „Object=
Associationen“ ihrer Zahl nach unbestimmt sind. Zwischen „Object“ und „Wort“
besteht eine jener Beziehungen, die wir „symbolische“ nennen. Jedem Objecte
ist ein Wort als „Symbol“ associirt. Wir erhalten ein vollständigeres Bild der
Sprachassociationen erst, wenn wir die Association mit dem Object hinzunehmen.
Es ist nun recht wahrscheinlich, dass die Association zwischen Object
und Wort sich nicht in beliebiger Weise zwischen irgend welchem Bestandtheil
des Objectcomplexes und irgend einem anderen des Wortcomplexes vollzieht, sondern
muss von stets des Objects die optischen, von Seite des Wortes die acoustischen
Elemente hiezu am nächsten sind. Demnach würde das Schema der Sprachassociationen
(Fig. 23) folgendermassen aussehen:
Fig. 23.
[Diagram of Objectassociations and Wortassociation is omitted here for pure textual transcription.]
Die Wortvorstellung entsteht als ein abgeschlossener Vorstellungscomplex, die Objectvorstellung
dagegen als ein offener. Die Wortvorstellung ist nicht selbst nur durch ihre Bestandtheile, sondern bloss
durch Klangbild und Wortbewegungsbild, mit den übrigen Elementen direct associirt, während nur
die Elemente des Objectcomplexes durch ihre Association mit den Wortelementen wieder associirt wer=
den. Wir studieren, welche das Object in ähnlicher Weise vertreten, wie das Klangbild das Wort ver=
tritt. Die Association zwischen Wort und Object erfolgt direct zwischen dem Klangbild (oder Sprech=
punkt ?) , die Verbindungen des Wortklangbildes mit anderen Objectassociationen als den visuellen
Elementen sind als secundär zu betrachten.Aus diesem Schema ergiebt sich sofort eine Eintheilung der Sprachstörungen
nach einem psychologischen Gesichtspunkte:
Störungen innerhalb der Wort=
associationen selbst wird man verbale A., Störungen in der Association zwischen
Wort und Object asymbolische A. heissen dürfen; und wenn es Sprach=
störungen giebt, die durch Störung innerhalb der Objectassociationen entstehen, so
werden diese dieselben die Bezeichnung agnostische A.
S.
172 APHASIE.
Bisher haben wir die Sprachfunction psychologisch betrachtet, wir wenden
uns nun zur anatomisch-klinischen Erörterung der Sprachstörungen.
Sectionsbefunde haben uns gelehrt, dass die Verbalassociationen der Sprache sich
innerhalb eines bestimmten Gebietes der Hirnrinde vollziehen (Associationsfeld der
Sprache), welches nur in der linken Hemisphäre ausgebildet ist, ferner und wir
im Stande, ungefähr die Gegend der Hirnoberfläche anzugeben, deren Läsion eine
rein asymbolische Sprachstörung verursacht (ein Fall von H E U B N E R). Agnostische
Sprachstörungen kommen dagegen nur zu Stande, wenn ausgedehnte Läsionen in
beiden Hemisphären vorhanden sind, wobei das Sprachfeld selbst ganz intact sein
kann. Im Sprachfeld der linken Hemisphäre, dessen Ausdehnung aus Figur 24
ersichtlich ist, ist haben nicht alle Stellen gleiche Bedeutung:
Die Zerstörung des centralen Gebietes (in welches die Inselwindungen
fallen) wird von der Sprachfunction ziemlich gut vertragen und ruft nur das Bild
einer unbestimmten A. hervor. Dieses besteht in einer allgemeinen Herabsetzung
der Associationsleistung, deren Charaktere im Einzelnen noch beschrieben werden.<br>Fig. 24.
[Diagram of the brain hemisphere is omitted here for pure textual transcription.]Die schraffirten Stellen entsprechen dem Sprachfeld, die darüber geschwärzten den sogenannten
Sprachcentren, und zwar ist 1 die Gegend, deren Läsion Agraphie hervorruft (Grenzbezirk gegen
den vorderen der Hand); 2 die Gegend deren Läsion nur Agraphie hervorruft (Grenzbezirk gegen
die Centrale der Sprach- und Kehlkopfmusculatur); 3 die Wernicke’sche Stelle, deren Läsion
Worttaubheit mit Aphasie verursacht; 4 die Stelle der optischen Aphasie, welche sie in ihrer reinen
Form erzeugt; 5 die Gegend, deren Läsion Alexie macht (Grenzbezirk am optischen Rindencentrum).
Ein weiterer Theil der Centralwindung liegt tiefer als die Tiefe der hier gezeichneten Linie.sollen. Die Zerstörung der Randpartien des Sprachfeldes hingegen ruft A. von
bestimmtem Charakter. Je nach der Lage der randständigen Läsion findet man
das motorische, acoustische oder visuelle Element in den Sprachassociationen ge=
schädigt und kann eine motorische A. (und Agraphie), eine acoustische (sensorische)
A. und eine visuelle A. (Alexie) diagnosticiren und mit annähernder Sicherheit
localliseren. Diese Randpartien des Sprachfeldes führen dann auch den Namen
der „Sprachcentren“, welcher Name zur irrigen Vermuthung führen können,
dass in ihnen allein die Leistungen der Sprachassociationen vollzogen werden. Vielmehr
verdanken sie ihre Bedeutung nur dem Umstande, dass sie den Centren anderer
Functionen direct anstossen, so dass durch ihre Zerstörung dem Sprachfelde
die Association mit dem einen oder anderen Elemente (dem motorischen, acousti=
schen, visuellen) gänzlich entzogen ist. Figur 24 zeigt auf den ersten Blick die
Lage des Sprachfeldes der linken Hemisphäre und die Bedeutung der doppelt
schraffirten „Sprachcentren“ als Grenzbezirke gegen die anderen motorischen,
visuellen und acoustischen Centren derselben Hemisphäre. Eine scharfe Abgrenzung
S.
APHASIE. 173
ist weder zwischen Sprachcentrum und dem übrigen Sprachfeld, noch zwischen
Sprachfeld und den übrigen Rindencentren zu erwarten.Man wird die Bedeutung dieser Figur noch besser würdigen, wenn man
sich erinnert, dass das Sprachassociationsfeld nur einseitig, die Felder der Hand,
der Sprachmuskuln, des Gesichts und Gehörs aber doppelseitig ausgebildet sind,
und dass die Associationsfasern von den letzteren Rindenfeldern der rechten Hemi-
sphäre gleichfalls in diese Grenzbezirke einmünden.Die diagnostische Aufgabe angesichts eines Falles von A. ist nun eine
zweifache. Sie geht erstens dahin, aus der Symptomatologie des Falles die Art
der A. und damit die L o c a l i s a t i o n der Läsion zu bestimmen, zweitens die Bedeutung
des Symptomes der A. für das Krankheitsbild und den Krankheitsprocess zu er-
kennen. Für den ersten Theil der Aufgabe mögen folgende Bemerkungen dienen:Die Untersuchung eines Falles von A. wird erst fruchtbringend sein,
wenn die Allgemeinerscheinungen verholten sind; sie wird häufig wiederholt werden
müssen, weil die Erscheinungen häufig wechseln und eine allmälige Erholung von
der ursprünglichen Schädigung fast die Regel darstellt. Man wird eine Prüfung
nicht zu lange fortsetzen dürfen, weil die Ermüdung bei einer geschädigten Func-
tion ungemein in Betracht kommt und das Maass der Schädigung leicht übertrieben
darstellt. Man wird ferner nicht erwarten dürfen, von den einzelnen Sprach-
functionen die einen völlig erhalten – die anderen völlig aufgehoben zu finden.
Dies trifft nur in den seltensten Fällen zu; in der Regel sind alle einzelnen
Sprachleistungen geschädigt, nur die eine in viel höherem Grade, als die andere.
Zur Prüfung der Sprachleistungen darf man nur die l e i c h t e s t e n Proben
wählen, muss aber andererseits bei der Deutung dieser Proben manchen Irrthümern
ausweichen. Diese Verhältnisse machen die Prüfung eines Falles von A. zu einer
recht schwierigen Aufgabe.Einzelne der aphasischen Symptome sind augenfällig, andere müssen
mühsam gesucht werden. Einige der Symptome haben topische Bedeutung für die
Diagnostik, während andere ohne solche Bedeutung auf die allgemeine Functions-
schädigung des Apparates zurückzuführen sind.Gehen wir von einem Falle von Sprachstörung aus, der noch nicht A.
zu nennen ist: Ein Kranker zeigt eine incorrecte, schwer verständliche Sprach-
ausführung; er ist kaum verständlich, weil er die einzelnen Consonanten nicht
produciren kann und sich in Betreff der Articulation ähnlich verhält wie ein
Kind in der Periode des Sprechenlernens. Der Grund hiefür sei etwa eine theilweise
Zerstörung der Kerne des Nervus facialis, hypoglossus und vagus in der Medulla oblon-
gata oder eine Affection der peripherischen Nerven mit consecutives Atrophie der
zur Sprachausführung dienenden Muskeln. Doch können wir an diesen Kranken
b e o b a c h t e n , dass er für jedes Wort eine Intention versucht, welche wenigstens
etwas Aehnliches liefert, dass er niemals zwei oder mehr Worte durch dieselbe
Innervation wiedergiebt, dass er so oft zum Sprechen ansetzt, als die beabsichtigte
Wort Silben enthält u. dergl. m. Dieser Kranke hat das Wort offenbar nicht ver-
gessen, er ist nur u n f ä h i g , es in correcter Weise zu reproduciren. Wir heissen
ihn nicht aphasisch, und bezeichnen sein Leiden als A l a l i e oder A n a r t h r i e (s. d.).
Ein anderer Kranker zeigt sich dagegen durchaus fähig, correct zu articuliren;
man versteht deutlich, was er sagt, aber man merkt, dass er nicht das passende
Wort gebraucht hat, was er wahrscheinlich sagen wollte. Er verspricht sich
häufig, setzt ein unpassendes, dem Sinne oder dem Klange nach ähnliches Wort
an die Stelle, bemerkt diesen Irrthum und kann ihn corrigiren – oder auch
nicht. Wir heissen dieses Symptom P a r a p h a s i e ; es hat keine topische dia-
gnostische Bedeutung, bezeugt aber eine herabgesetzte Leistungsfähigkeit des
Sprachassociationsapparates und findet sich in geringem Maass auch in Zuständen
physiologischer Ermüdung, bei getheilter Aufmerksamkeit des Redners, als Symptom
sogenannter Zerstreutheit. Weitere Beobachtung desselben Kranken wird sein, nun
ein zweites Symptom entdecken lassen, welches der Zugehört, die A m n e s i e (s. d.),S.
174 APHASIE.
Wir sehen, dass der Kranke sich oft ein Wort besinnt, dass er es auch auf
keine Weise zu finden vermag, so sehr er verharrend, dass er es kennt, dass er
endlich genehmigt ist, es durch ein Wort von allgemeiner Bedeutung oder durch
eine Umschreibung zu ersetzen, und erinnern uns allert ähnlichster Vorkommnisse
in unserem täglichen Gespräch, in denen wir uns gleichfalls amnestisch für
manche Worte zeigen. Die Amnesie betrügt hauptsächlich Eigennamen und Haupt-
wörter; es kommen Fälle vor, in denen die Kranken jedes Hauptwort um-
schreiben müssen.Wo sich Paraphasie und Amnesie in mehr als physiologischem Masse
beisammen vorfinden, haben wir das Recht, A. zu diagnosticiren. Durch die Amnesie
wird das Wortschatz der Kranken in höherem oder geringerem Grade eingeschränkt.
So lange diese Wortverarmung nicht allzuweit geht, kann man den Fall, der durch
Paraphasie, Amnesie und Erschwerung aller complicierteren Sprachleistungen
(z. B. beim Lesen und Schreiben) ausgezeichnet ist, noch als u n b e s t i m m t e A.
bezeichnen. Wir vermissen in solchen Fällen unvollständige und central gelegene
Läsionen des Sprachfeldes.Geht die Amnesie, die Verarmung des Sprachschatzes weiter, so muss
natürlich die Paraphasie zurücktreten, und wir erhalten das durch die Beschränkung
auf wenige Worte gekennzeichncte Bild der motorischen A. bei der wir die
Läsion in die Broca'sche Stelle verlegen dürfen. Der motorischen Aphasie-Kranke
vollkommen stumm sein, er kann 2 oder 3 Worte, meist „ja, nein" und andere
„Sprachreste" zu seiner Verfügung haben. Ist er vollkommen sprachlos, so wird
es natürlich w i c h t i g , zu bestimmen, ob er das Sprachverständnis besitzt. Dies
gelingt leicht, wenn man auf psychisches Verhalten und Mimik des Patienten achtet.
Ein Kranker, der weder Sprachverständnis noch motorische Sprachfähigkeit besitzt,
wird Aufforderungen, die man an ihn richtet, nicht nachkommen, wird keine Ver-
änderung seiner Mine zeigen, wenn man beleidigende oder absurde Fragen an
ihn stellt. Wir heissen einen solchen Kranken T o t a l a p h a s i s c h. Ein der Totalen
A. entsprechendes Verhalten ergibt sich oft in den ersten Tagen nach einer
schweren Beschädigung des Sprachapparates; später stellt sich das Sprachver-
ständniss wieder her und es erübrigt eine m o t o r i s c h e A. Der motorisch Apha-
sische zeigt sich heilsuchend. Er spricht bemüht, sich verständlich zu machen,
verwendet oft dasselbe Wort zu verschiedenen Bedeutungen, die er durch geeignete
Mimik unterscheidet; er kann in der Regel vorgesprochene Worte nicht wieder-
holen. So oft er dazu ansetzt, bringt er stets einen bestandtheil seines kleinen
lichen Sprachschatzes hervor; wenn ihm einmal ein anderes Wort nachzusprechen
gelungen ist, drängt sich ihm dieses Wort dann auch bei unpassendem Anlasse
über die Lippen. Er kann seine Sprachreste, die oft complicierte Sätze darstellen,
nicht zerlegen, also auch über sie nicht nach Willen verfügen. Sein Wortver-
mögen ist also vor allem, die neuere Zunft charakterisirt. Sein Wortver-
ständniss ist uneingeschränkt, die Beziehung zwischen Wort und Object stellt er
so l e i c h t her, wie ein Gesunder, er erkennt also jedes ihm vorgesprochene Wort
als Klangbild und bezieht es richtig auf sein Object. Legen kann der motorisch
Aphasische in der Regel nicht schreiben in seinen Fällen, wenn diese Function
nicht durch eine begleitende Lähmung der Hand unmöglich gemacht ist.Ist die Diagnose der motorischen A. durch alle diese Umstände erleichtert,
so gilt für die acustische A. als Regel, dass der Zustand sorgfältig, gesucht und
nicht mit andern verwechselt werden darf. Die a c u s t i s c h ( s e n s o r i s c h ) A p h a s i e
zeichnet sich durch den Mangel des Sprachverständnisses aus, sie
beschränken sich also im Verkehre wie Verworrene, geben keine oder verkehrte
Antworten, und nur der Widerspruch mit ihrem sonstigen besonnenen und zweck-
mässigen Betragen wird darauf aufmerksam machen, dass es sich vielleicht um
eine Störung des Sprachverständnisses bei ihnen handelt. Eigenthümlich ist ihnen
ferner, dass sie auf Grund des gehörten Illusionen; sie glauben etwas verstanden
zu haben und richten darnach ihre Antwort ein, welche dann unsinnig erscheinenS.
APHASIE. 175
muss. In einer Reihe von Fällen gelingt es, durch eindringliches Wiederholen der
Frage ein Verständniss zu erzwingen, auch sieht man oft, dass einzelne kurze
und geläufige Fragen verstanden werden, andere hingegen nicht. Man möchte
sagen, dass die acustische A. (die man auch als Worttaubheit bezeichnet)
selten total gefunden wird.Man darf bei dem Symptom der acustischen A. die Läsion in die erste
und zweite linke Temporalwindung (WERNICKE'sche Stelle) verlegen, wenngleich
Zerstörung dieser Region häufig ohne Worttaubheit ertragen wird. Bei der hohen
Bedeutung der Klangbilder als Knotenpunkte der Sprachassociation wird es ver-
ständlich, dass die acustische A. die schwersten Störungen in den übrigen Sprach-
leistungen hervorruft. Die spontane Sprache ist in einzelnen seltenen, nicht
genügend aufgeklärten Fällen ungestört gefunden worden. Zumeist aber ist die
Sprache diesen Kranken wie bei den anderen Aphasischen mit Paraphasie und
Wortverarmung behaftet. Als Unterschied von der Sprache bei motorischer A. ist
festzuhalten, dass die Reichlichkeit der Sprachimpulse nicht gelitten hat. Die
acustisch Aphasischen sprechen also viel, aber nicht correct, ihr Wortschatz ist
an Hauptwörtern und an Wörtern engerer Bedeutung sehr verarmt, ist reich an
Partikeln, an Gefühlswörtern, an Wiederholungen. Bei höheren Graden der Affection
wird zwar noch immer viel gesprochen, aber das Ergebniss der Innovation ist
ein Kauderwelsch, eine oft endlose Aneinanderreihung von sinnlosen, correct arti-
culirten Silben. Da die Association von Wort und Object durch die Klangbilder
vermittelt wird, sind die acustisch A. auch jeder „symbolischen“ Sprachleistung
unfähig. Sie wissen für ein gezeigtes Object keine Association mit einer der Vor-
stellungen des „Wortcomplexes" zu finden. Sie kennen den Namen des Objectes
weder spontan auszusprechen noch ihn niederzuschreiben, noch ihn aus vorgelegten
Buchstaben zusammenstellen. Das Lesen ist unmöglich, eine etwa noch vor-
handene optische A. wird durch die acustische, auf die weitergehende Störung
gedeckt. Indes hat man gerade hier mit den häufigen Vorkommnissen der Dissoziation
der einzelnen Sprachleistungen in Folge der Läsion zu rechnen, welche sich
allgemeine Regeln nicht aufgeben lassen, und thut gut, sich für die Diagnose auf
den Hauptcharacter, den Ausfall oder die Erschwerung des Sprachverständnisses zu
stützen.Die dritte Art der A., die o p t i s c h e , ist ausgezeichnet durch die Störung
im Verständniss der Buchstaben, im Weiteren durch die Unfähigkeit zu lesen.
Von diesen beiden Symptomen ist aber nur das erstere, das Nichterkennen der
Buchstaben, für die Diagnose der optischen A. zu verwerthen. Denn es kommt
auch bei anderen Arten der A. vor, dass nicht gelesen werden kann, obwohl die
einzelnen Buchstaben gut erkannt werden, und solches Verhalten hat dann keine
typische Bedeutung. Die optische A. kann mit Sicherheit nur diagnosticirt werden,
wenn keine acustische, also keine Störung des Sprachverständnisses vorhanden
ist. Dieselbe ist gleichfalls mit Paraphasie und Wortverarmung verbunden, indessen
sind gerade bei dieser Form die Veränderungen im spontanen Sprechen so gering,
dass sie gesucht werden müssen. Die Kranken verstehen es oft, ihren Sprach-
mangel durch Umschreibung, vorsichtige Wahl der Worte und zögerndes Sprechen
zu verbergen. Die optische A. kommt verhältnissmässig häufig als isolirte und
intensiv ausgebildete Partialstörung vor (vergl. „Alexie“).Die Störungen des Schreibens, welche Verrichtung doch im engern An-
schluss an das Lesen erlernt wurde, zeigen sich bei der A. ziemlich unabhängig
von den Lesestörungen, gehen aber den Störungen der motorischen A. ziemlich
parallel. In ganz seltenen Fällen kann man Kranke finden, deren einzige Sprach-
störung in A g r a p h i e (s. d.) besteht, obwohl keine Lähmung der rechten Hand
zu finden ist. Noch seltener und vielleicht die Fälle, in denen nur die Schreib-
fähigkeit erhalten geblieben ist.Die topische Diagnostik der A. ist also durch vorstehende Andeutungen
erledigt. Je auffälliger die Wortverarmung hervortritt, desto mehr ist die LäsionS.
176 APHASIE.
an's frontale Ende des Sprachfeldes zu verlegen, je mehr die Störung des Sprach-
verständnisses sich ausprägt, desto sicherer ist dieselbe im temporalen und bei
deutlicher Störung im Verständnisse der Buchstaben am parietooccipitalen Ende
des Sprachfeldes zu suchen. Die topische Diagnose wird häufig noch durch die
begleitenden Symptome bestärkt. So kann sich neben der motorischen A. rechts-
seitige Facialsparese oder halbseitige Körperparese finden, die unbestimmte A.
kann von einer cerebralen Hemianästhesie begleitet sein, die optische A. in reinster
Form (Alexie) findet sich überwiegend häufig neben einer rechtsseitigen Hemianopsie.
Bei der acustischen A. ist darauf zu achten, ob nicht partielle Taubheit, halb-
seitige Einschränkung des Gehörs, Verlust der Wahrnehmung für gewisse Arten
von Tönen gleichzeitig vorhanden ist.Andere Symptome der A. bieten kein diagnostisches Interesse, erscheinen
aber der Untersuchung werth, weil sie ein Bild von der Selbstständigkeit und
Abhängigkeit der einzelnen Sprachleistungen, von deren Dissoication und von der
Möglichkeit vicarirender Leistung geben. Will man sich eine Uebersicht von
diesen Verhältnissen verschaffen, so prüfe man jede der motorischen Sprachleistungen,
inwiefern sie spontan und auf sensiblen Anreiz erfolgen kann. Man hat
dann etwa folgendes Schema:I. Sprechen II. Schreiben
1. spontan, 1. spontan,
2. a) nach dem Gehörten (Nachsprechen), 2. a) nach dem Gehörten (Dictat-
b) nach dem Gesehenen (Vorlesen). schreiben),
b) nach dem Gesehenen (Abschreiben).
Es gilt dann die Regel, dass man zwar häufig eine Erhaltung der
motorischen Sprachleistung auf sensiblen Anreiz (2 a und 2 b) findet bei Verlust
der spontanen (1), aber niemals das Umgekehrte.Bei den sensorischen Sprachleistungen, die ja immer auf sensiblen Anreiz
erfolgt, hat man die Verbalassociation und die Symbolassociation besonders zu prüfen.III. Lesen IV. Hören
Verbalass. 1. Lautlesen. 1. Nachsprechen,
2. Abschreiben. 2. Nachschreiben,
Symbolass. 3. Verstehen des Gelesenen. 3. Verstehen des Gehörten,
4. Verstehen des Nachgesprochenen,
5. Verstehen des Nachgeschriebenen.Es kommen hier Fälle vor, dass die Verbalassociation noch möglich ist,
die Symbolassociation aber nicht mehr. Wie man sieht, können die meisten Sprach-
leistungen als Associationen durch mannigfachen Sitz der Läsion gestört werden.Die k l i n i s c h e B e d e u t u n g des Symptomes der A. lässt sich mit wenigen
Worten bestimmen. A. ist, gleichgültig, welche Form – ist ein Ausfallssymptom
von der Rinde der linken Hemisphäre. Dieser Satz bedarf nur weniger Ein-
schränkungen. Man darf behaupten, dass es keine A. in Folge subcorticaler
Läsionen gibt. Es kann aber eine solche Läsion der Rinde so nahe gelegen sein,
dass sie die gewebliche Integrität und Function derselben schädigt. Dann entsteht
A. als Symptom der Verwirkung, die übrigens von derselben Art sein muss, wie
eine direct entstandene. Nur für die subcorticale Läsion unterhalb der Broca’schen
stelle muss eine Ausnahme zugestanden werden. Erkrankung dieser Region erzeugt
dysarthrische Störungen, und wenn einem Falle von motorischer A. Symptome von
Dysarthrie beigefügt sind, so darf man schliessen, dass die Erkrankung von der
Rinde aus in die Tiefe der Marksubstanz geht. Eine zweite Einschränkung betrifft
die Seite der Läsion, in der weitaus überwiegenden Mehrheit darf man A. auf
Erkrankung der linken Hemisphäre beziehen. Doch muss man bei Linkshändern
daran gefasst sein, dieselbe mit Symptomen von der rechten Hemisphäre beisammen
zu sehen. Es wäre also richtiger zu sagen: A. ist ein Ausfallssymptom von der
Rinde und angrenzenden Markschicht der vorwiegenden Hemisphäre.S.
APHASIE. APHONIE. 177
Als solchem kommt ihr genau die nämliche klinische Bedeutung zu, wie
den sonstigen motorischen und sensorischen Lähmungen durch Erkrankung der
Rinde, den brachialen und cruralen Monoplegien, der Hemianopsie u. s. w., nur
dass die A. mit grösserer Sicherheit als Rindensymptom anzusprechen ist, und
demnach bei einem sonst topisch mehrdeutigen Lähmungscomplex für die Mit-
betheiligung der Rinde entscheidet.Für die Diagnose des Krankheitsprocesses kommt der A. eine besondere
Bedeutung nicht zu. Bei dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse lässt sich
aus der klinischen Ausprägung einer A. allein nicht erkennen, ob dieselbe von
einer vasculösen Störung, einer Embolie, Hämorrhagie, Thrombose, von einem
Tumor, einem scit entzündlichen Processe u. dergl. abzuleiten ist. A. bleibt das
Localsymptom des Sprachfeldes der vorwiegenden Hemisphäre, und man darf bei
der klinischen Erzeugung eines Falles davon ausgehen, dass die vorliegende Läsion
eine motorische oder sensorische Lähmung erzeugt hätte, wie sie nur an anderer
Stelle erfolgt wäre. Für alles Weitere ist daher auf die diagnostische Würdigung
der Lähmung (s. d.) zu verweisen.Da das Sprachfeld fast vollständig in das Gebiet fällt, welches von der
Arteria fossae Sylvii versorgt wird, erklärt sich die Häufigkeit der A. bei solchen
Erkrankungen, welche diese Arterie bevorzugen, wie die Embolie und die luetische
Arteritis. Verschluss einzelner Aeste dieser Arterien ergibt die besten Bilder von
partiell aphasischen Störungen.Es sei ausdrücklich bemerkt, dass eine Reihe von Sprachstörungen (s. d.),
welche nicht auf erworbener Erkrankung des Sprachfeldes in der Hirnrinde
beruhen, hier nicht abgehandelt sind. Freud.
Diagnostisches1v4K
170
–177