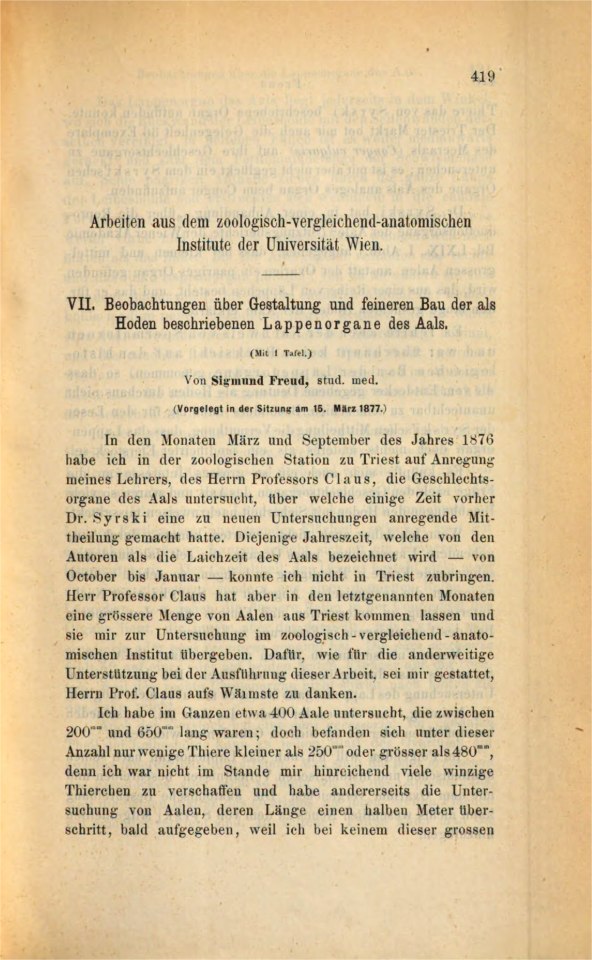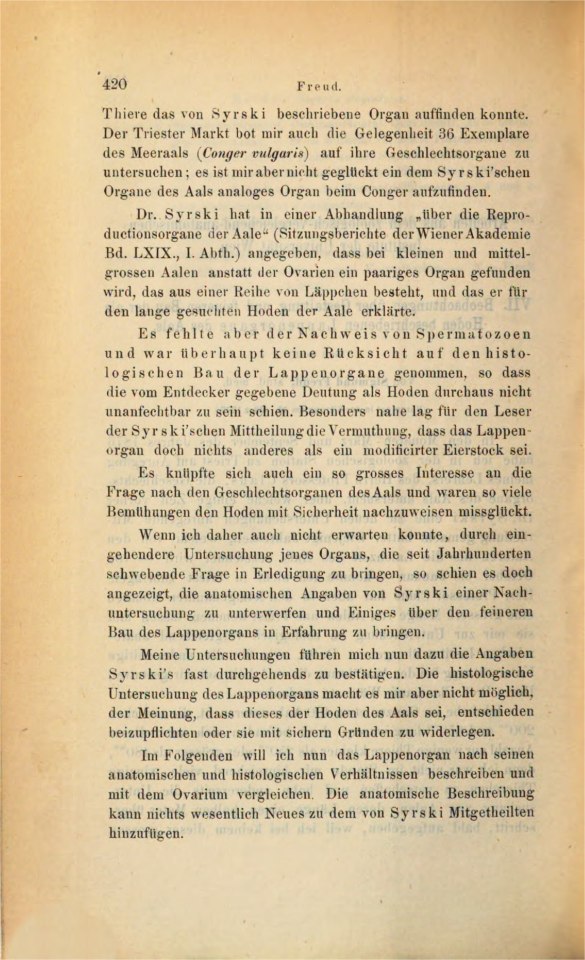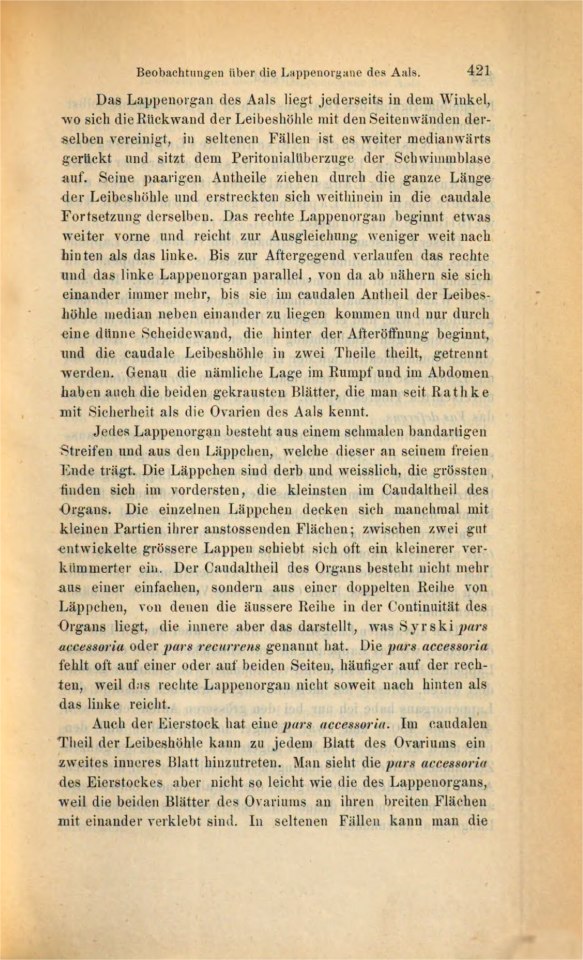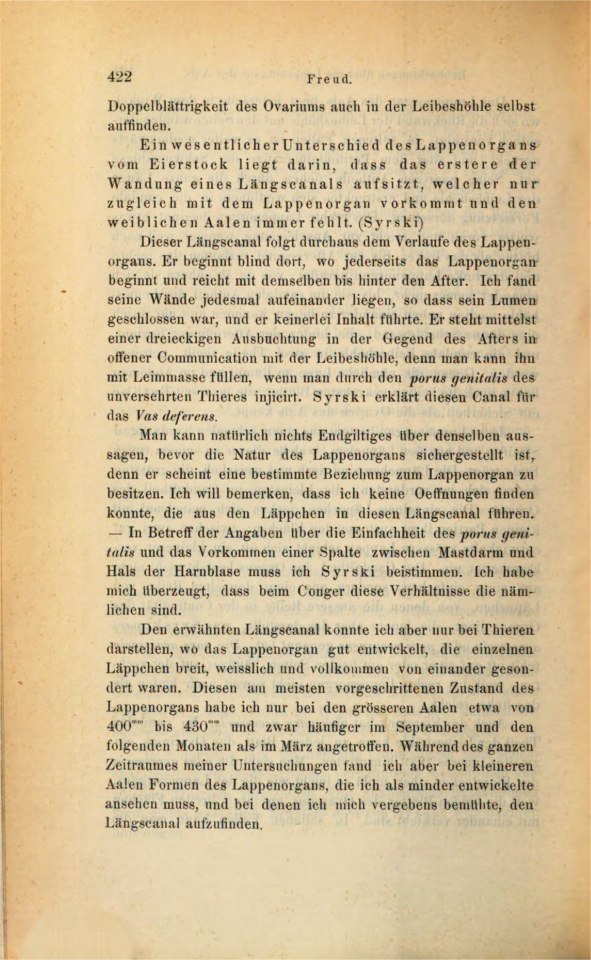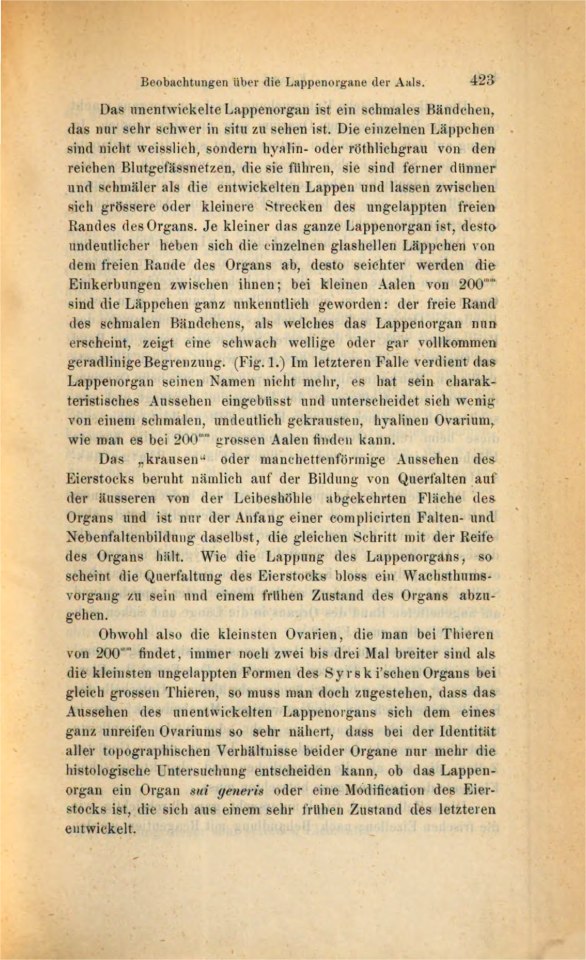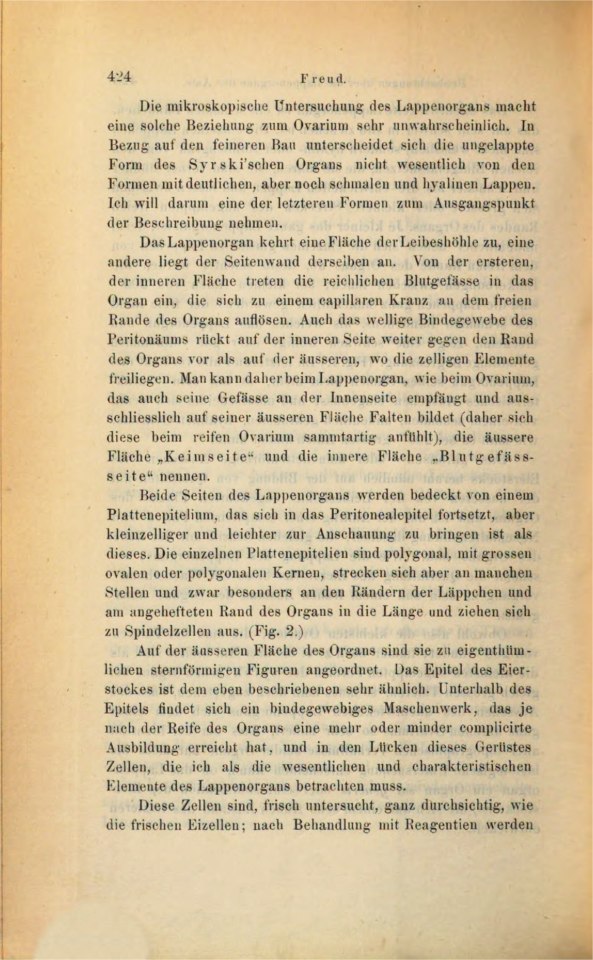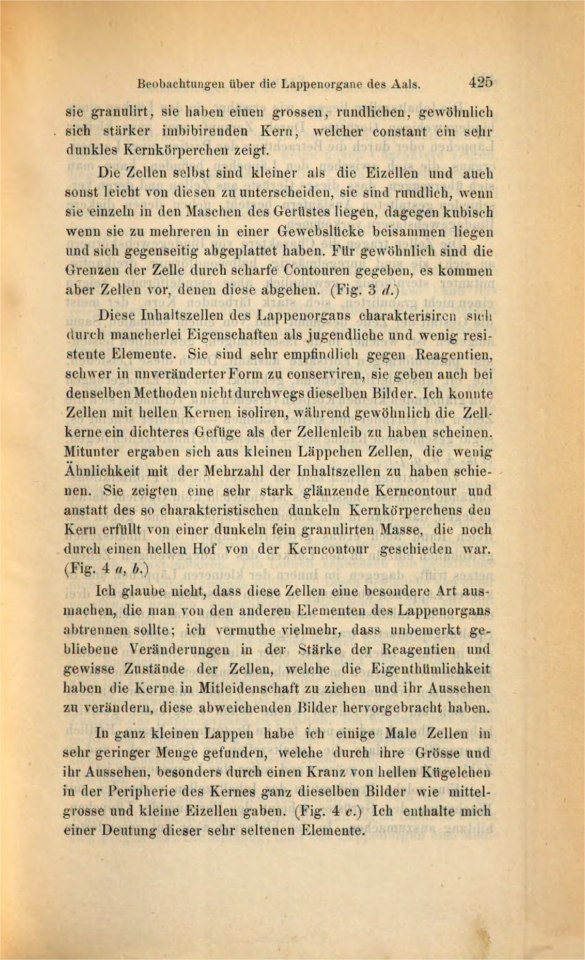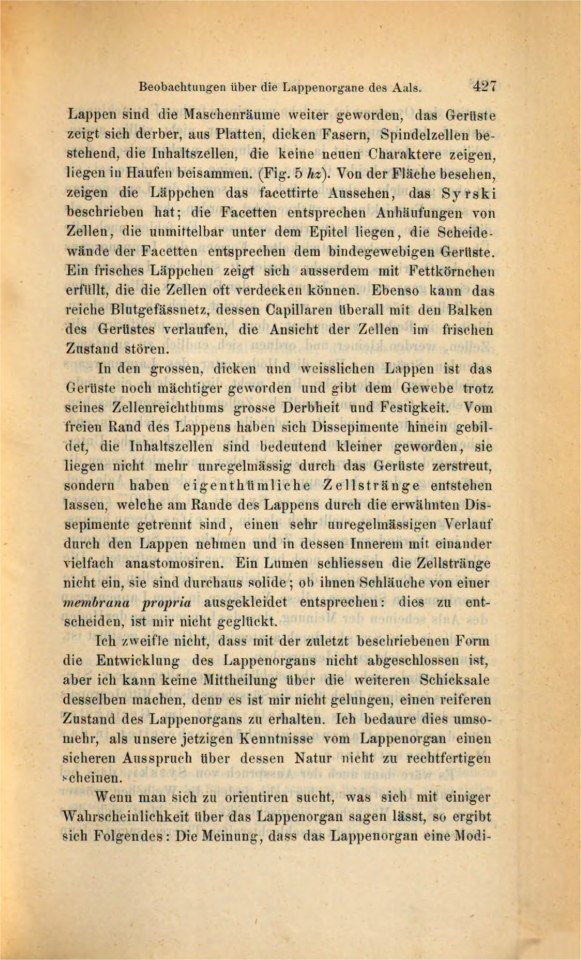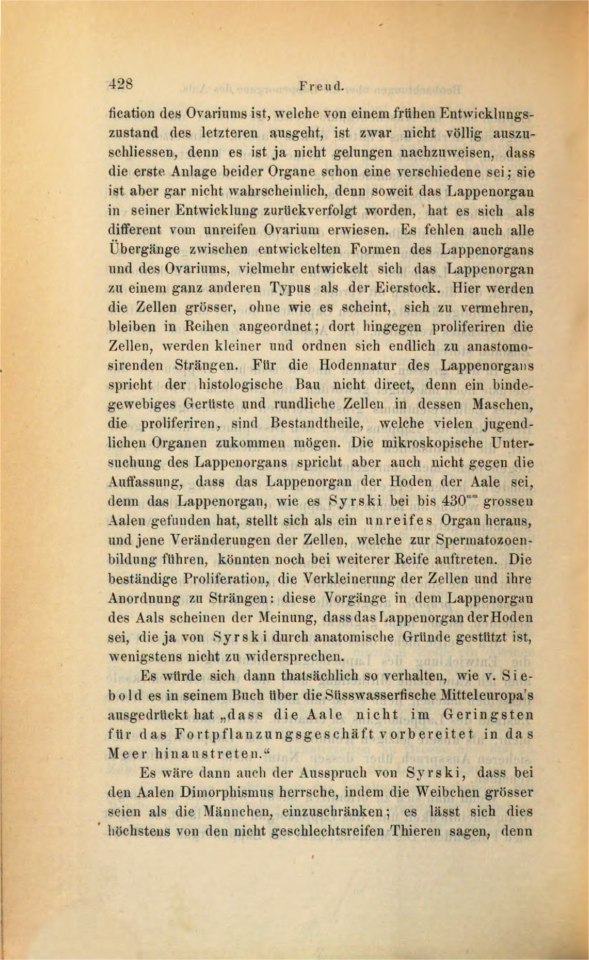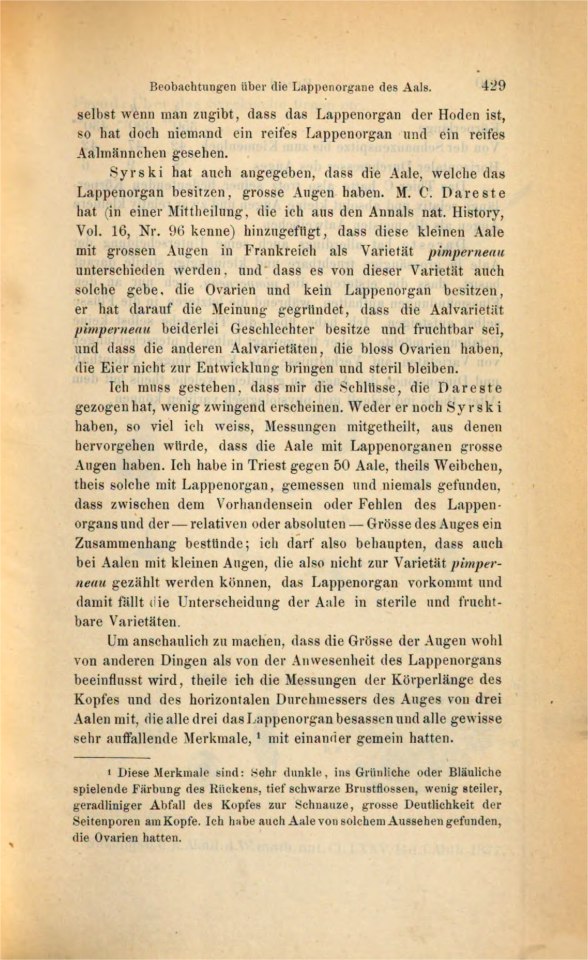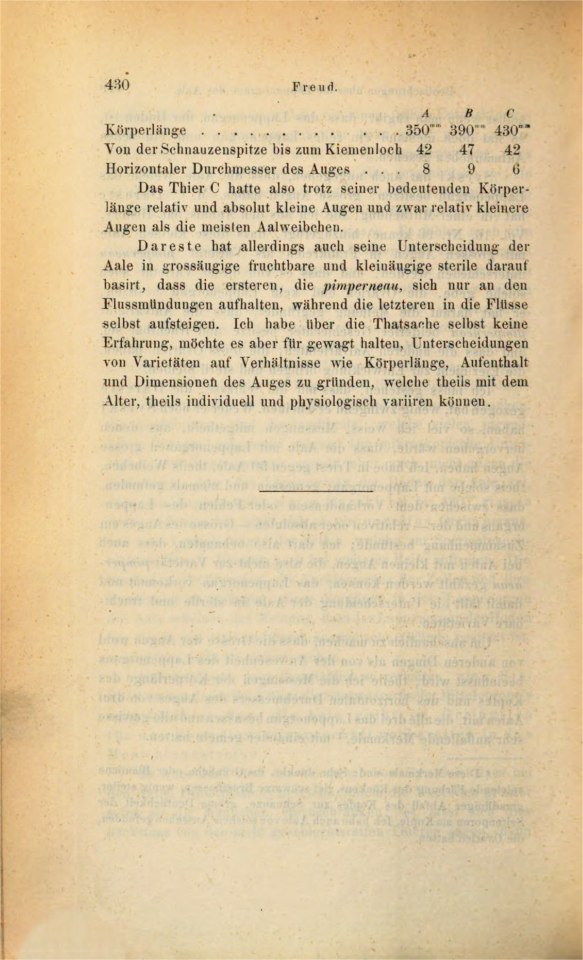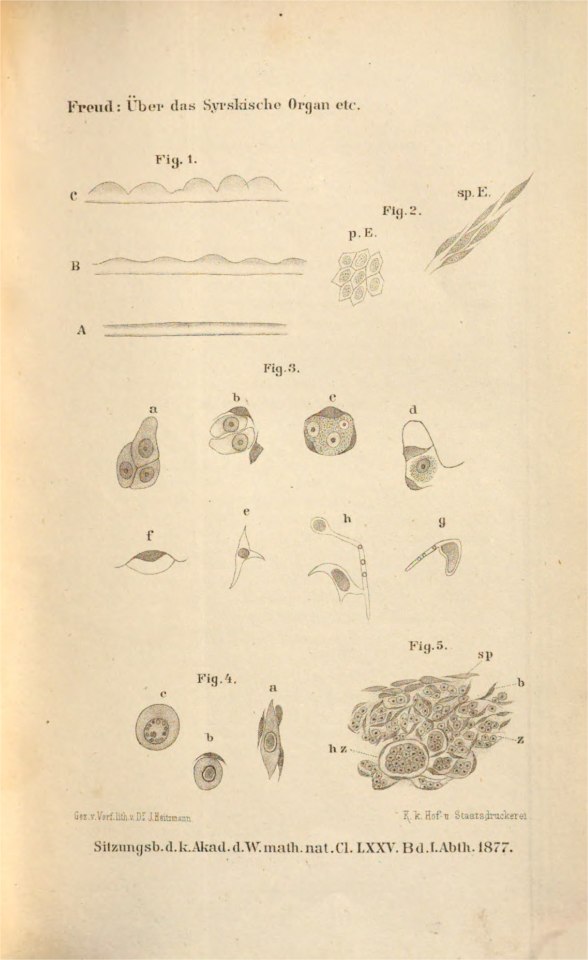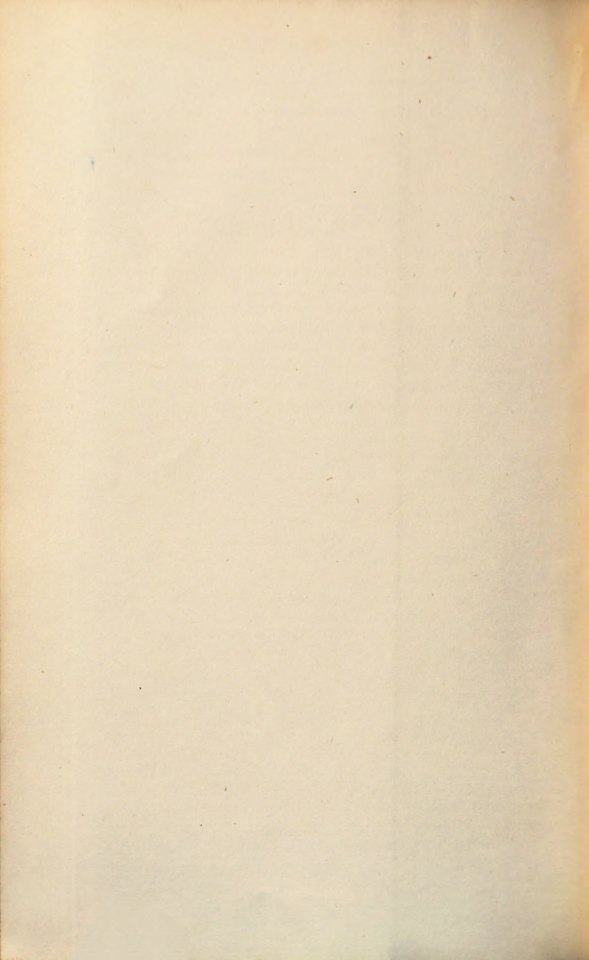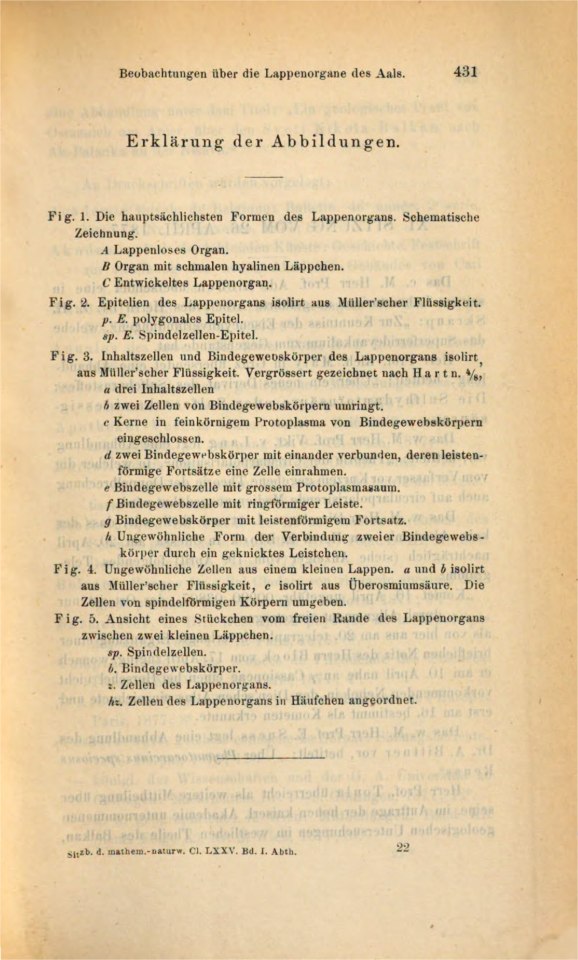S.
419
Beobachtungen über Gestaltung
und feineren Bau der als Hoden
beschriebenen L a p p e n o r g a n e des
Aals
(Mit 1 Tafel.)
Von Sigmund Freud, stud. med.
(Vorgelegt in der Sitzung am 15. März 1877.)
In den Monaten März und September des Jahres 1876
habe ich in der zoologischen Station zu Triest auf Anregung
meines Lehrers, des Herrn Professors C l a u s , die Geschlecht-
sorgane des Aals untersucht, über welche einige Zeit vorher
Dr. S y r s k i eine zu neuen Untersuchungen anregende
Mittheilung gemacht hatte. Diejenige Jahreszeit, welche von den Autoren als
die Laichzeit des Aals bezeichnet wird – von October bis Januar − konnte
ich nicht in Triest zubringen. Herr Professor Claus hat aber in den letztgenannten
Monaten eine grössere Menge von Aalen aus Triest kommen lassen
und sie mir zur Untersuchung im zoologisch-vergleichend-anatomischen
Institut übergeben. Dafür, wie für die anderweitige Unterstützung bei der
Ausführung dieser Arbeit, sei mir gestattet, Herrn Prof. Claus aufs Wärmste
zu danken.Ich habe im Ganzen etwa 400 Aale untersucht, die zwischen 200mm
und 650mm lang waren; doch befanden sich unter dieser Anzahl nur wenige
Thiere kleiner als 250mm oder grösser als 480mm, denn ich war nicht im
Stande mir hinreichend viele winzige Thierchen zu verschaffen und habe
andererseits die Untersuchung von Aalen, deren Länge einen halben Meter
überschritt, bald aufgegeben, weil ich bei keinem dieser grossenS.
420
Thiere das von S y r s k i beschriebene Organ auffinden konnte. Der Triester
Markt bot mir auch die Gelegenheit 36 Exemplare des Meeraals (Conger
vulgaris) auf ihre Geschlechtsorgane zu untersuchen; es ist mir aber nicht
geglückt ein dem S y r s k i ’schen Organe des Aals analoges Organ beim
Conger aufzufinden.Dr. S y r s k i hat in einer Abhandlung „über die Reproductionsorgane
der Aale“ (Sitzungsberichte der Wiener Akademie Bd. LXIX., I. Abth.) angegeben,
dass bei kleinen und mittelgrossen Aalen anstatt der Ovarien ein
paariges Organ gefunden wird, das aus einer Reihe von Läppchen besteht,
und das er für den lange gesuchten Hoden der Aale erklärte.E s f e h l t e a b e r d e r N a c h w e i s v o n S p e r m a t o -
z o e n u n d w a r ü b e r h a u p t k e i n e R ü c k s i c h t a u f
d e n h i s t o l o g i s c h e n B a u d e r L a p p e n o r g a n e genommen,
so dass die vom Entdecker gegebene Deutung als Hoden durchaus
nicht unanfechtbar zu sein schien. Besonders nahe lag für den Leser der
S y r s k i ’schen Mittheilung die Vermuthung, dass das Lappenorgan doch
nichts anderes als ein modificirter Eierstock sei.Es knüpfte sich auch ein so grosses Interesse an die Frage nach den Geschlechtsorganen
des Aals und waren so viele Bemühungen den Hoden mit
Sicherheit nachzuweisen missglückt.Wenn ich daher auch nicht erwarten konnte, durch eingehendere Untersuchung
jenes Organs, die seit Jahrhunderten schwebende Frage in Erledigung
zu bringen, so schien es doch angezeigt, die anatomischen Angaben von
S y r s k i einer Nachuntersuchung zu unterwerfen und Einiges über den
feineren Bau des Lappenorgans in Erfahrung zu bringen.Meine Untersuchungen führen mich nun dazu die Angaben S y r s k i ’s fast
durchgehends zu bestätigen. Die histologische Untersuchung des Lappenorgans
macht es mir aber nicht möglich, der Meinung, dass dieses der Hoden des Aals
sei, entschieden beizupflichten oder sie mit sichern Gründen zu widerlegen.Im Folgenden will ich nun das Lappenorgan nach seinen anatomischen
und histologischen Verhältnissen beschreiben und mit dem Ovarium vergleichen.
Die anatomische Beschreibung kann nichts wesentlich Neues zu dem
von S y r s k i Mitgetheilten hinzufügen.S.
421
Das Lappenorgan des Aals liegt jederseits in dem Winkel, wo sich
die Rückwand der Leibeshöhle mit den Seitenwänden derselben vereinigt, in
seltenen Fällen ist es weiter medianwärts gerückt und sitzt dem Peritonialüberzuge
der Schwimmblase auf. Seine paarigen Antheile ziehen durch die
ganze Länge der Leibeshöhle und erstreckten sich weithinein in die caudale
Fortsetzung derselben. Das rechte Lappenorgan beginnt etwas weiter vorne
und reicht zur Ausgleichung weniger weit nach hinten als das linke. Bis zur
Aftergegend verlaufen das rechte und das linke Lappenorgan parallel, von
da ab nähern sie sich einander immer mehr, bis sie im caudalen Antheil der
Leibeshöhle median neben einander zu liegen kommen und nur durch eine
dünne Scheidewand, die hinter der Afteröffnung beginnt, und die caudale
Leibeshöhle in zwei Theile theilt, getrennt werden. Genau die nämliche Lage
im Rumpf und im Abdomen haben auch die beiden gekrausten Blätter, die
man seit R a t h k e mit Sicherheit als die Ovarien des Aals kennt.Jedes Lappenorgan besteht aus einem schmalen bandartigen Streifen und
aus den Läppchen, welche dieser an seinem freien Ende trägt. Die Läppchen
sind derb und weisslich, die grössten finden sich im vordersten, die kleinsten
im Caudaltheil des Organs. Die einzelnen Läppchen decken sich manchmal
mit kleinen Partien ihrer anstossenden Flächen; zwischen zwei gut entwickelte
grössere Lappen schiebt sich oft ein kleinerer verkümmerter ein. Der
Caudaltheil des Organs besteht nicht mehr aus einer einfachen, sondern aus
einer doppelten Reihe von Läppchen, von denen die äussere Reihe in der
Continuität des Organs liegt, die innere aber das darstellt, was S y r s k i
pars accessoria oder pars recurrens genannt hat. Die pars accessoria fehlt oft
auf einer oder auf beiden Seiten, häufiger auf der rechten, weil das rechte
Lappenorgan nicht soweit nach hinten als das linke reicht.Auch der Eierstock hat eine pars accessoria. Im caudalen Theil der Leibeshöhle
kann zu jedem Blatt des Ovariums ein zweites inneres Blatt hinzutreten.
Man sieht die pars accessoria des Eierstockes aber nicht so leicht wie
die des Lappenorgans, weil die beiden Blätter des Ovariums an ihren breiten
Flächen mit einander verklebt sind. In seltenen Fällen kann man dieS.
422
Doppelblättrigkeit des Ovariums auch in der Leibeshöhle selbst auffinden.
E i n w e s e n t l i c h e r U n t e r s c h i e d d e s L a p p e n -
o r g a n s v o m E i e r s t o c k l i e g t d a r i n , d a s s d a s
e r s t e r e d e r Wa n d u n g e i n e s L ä n g s c a n a l s a u f -
s i t z t , w e l c h e r n u r z u g l e i c h m i t d e m L a p p e n -
o r g a n v o r k o m m t u n d d e n w e i b l i c h e n A a l e n
i m m e r f e h l t . ( S y r s k i )Dieser Längscanal folgt durchaus dem Verlaufe des Lappenorgans. Er
beginnt blind dort, wo jederseits das Lappenorgan beginnt und reicht mit
demselben bis hinter den After. Ich fand seine Wände jedesmal aufeinander
liegen, so dass sein Lumen geschlossen war, und er keinerlei Inhalt führte.
Er steht mittelst einer dreieckigen Ausbuchtung in der Gegend des Afters in
offener Communication mit der Leibeshöhle, denn man kann ihn mit Leimmasse
füllen, wenn man durch den porus genitalis des unversehrten Thieres
injicirt. S y r s k i erklärt diesen Canal für das Vas deferens.Man kann natürlich nichts Endgiltiges über denselben aussagen, bevor die
Natur des Lappenorgans sichergestellt ist, denn er scheint eine bestimmte
Beziehung zum Lappenorgan zu besitzen. Ich will bemerken, dass ich keine
Oeffnungen finden konnte, die aus den Läppchen in diesen Längscanal führen.
– In Betreff der Angaben über die Einfachheit des porus genitalis und das
Vorkommen einer Spalte zwischen Mastdarm und Hals der Harnblase muss
ich S y r s k i beistimmen. Ich habe mich überzeugt, dass beim Conger diese
Verhältnisse die nämlichen sind.Den erwähnten Längscanal konnte ich aber nur bei Thieren darstellen, wo
das Lappenorgan gut entwickelt, die einzelnen Läppchen breit, weisslich und
vollkommen von einander gesondert waren. Diesen am meisten vorgeschrittenen
Zustand des Lappenorgans habe ich nur bei den grösseren Aalen etwa
von 400mm bis 430mm und zwar häufiger im September und den folgenden
Monaten als im März angetroffen. Während des ganzen Zeitraumes meiner
Untersuchungen fand ich aber bei kleineren Aalen Formen des Lappenorgans,
die ich als minder entwickelte ansehen muss, und bei denen ich mich
vergebens bemühte, den Längscanal aufzufinden.S.
423
Das unentwickelte Lappenorgan ist ein schmales Bändchen, das nur
sehr schwer in situ zu sehen ist. Die einzelnen Läppchen sind nicht weisslich,
sondern hyalin- oder röthlichgrau von den reichen Blutgefässnetzen, die sie
führen, sie sind ferner dünner und schmäler als die entwickelten Lappen und
lassen zwischen sich grössere oder kleinere Strecken des ungelappten freien
Randes des Organs. Je kleiner das ganze Lappenorgan ist, desto undeutlicher
heben sich die einzelnen glashellen Läppchen von dem freien Rande des Organs
ab, desto seichter werden die Einkerbungen zwischen ihnen; bei kleinen
Aalen von 200mm sind die Läppchen ganz unkenntlich geworden: der freie
Rand des schmalen Bändchens, als welches das Lappenorgan nun erscheint,
zeigt eine schwach wellige oder gar vollkommen geradlinige Begrenzung. (Fig.
1.) Im letzteren Falle verdient das Lappenorgan seinen Namen nicht mehr, es
hat sein charakteristisches Aussehen eingebüsst und unterscheidet sich wenig
von einem schmalen, undeutlich gekrausten, hyalinen Ovarium, wie man es
bei 200mm grossen Aalen finden kann.Das „krausen“ oder manchettenförmige Aussehen des Eierstocks beruht
nämlich auf der Bildung von Querfalten auf der äusseren von der Leibeshöhle
abgekehrten Fläche des Organs und ist nur der Anfang einer complicirten
Falten- und Nebenfaltenbildung daselbst, die gleichen Schritt mit der
Reife des Organs hält. Wie die Lappung des Lappenorgans, so scheint die
Querfaltung des Eierstocks bloss ein Wachsthumsvorgang zu sein und einem
frühen Zustand des Organs abzugehen.Obwohl also die kleinsten Ovarien, die man bei Thieren von 200mm findet,
immer noch zwei bis drei Mal breiter sind als die kleinsten ungelappten
Formen des S y r s k i ’schen Organs bei gleich grossen Thieren, so muss
man doch zugestehen, dass das Aussehen des unentwickelten Lappenorgans
sich dem eines ganz unreifen Ovariums so sehr nähert, dass bei der Identität
aller topographischen Verhältnisse beider Organe nur mehr die histologische
Untersuchung entscheiden kann, ob das Lappenorgan ein Organ sui generis
oder eine Modification des Eierstocks ist, die sich aus einem sehr frühen
Zustand des letzteren entwickelt.S.
424
Die mikroskopische Untersuchung des Lappenorgans macht eine
solche Beziehung zum Ovarium sehr unwahrscheinlich. In Bezug auf den
feineren Bau unterscheidet sich die ungelappte Form des S y r s k i ’schen
Organs nicht wesentlich von den Formen mit deutlichen, aber noch schmalen
und hyalinen Lappen. Ich will darum eine der letzteren Formen zum
Ausgangspunkt der Beschreibung nehmen.Das Lappenorgan kehrt eine Fläche der Leibeshöhle zu, eine andere liegt
der Seitenwand derselben an. Von der ersteren, der inneren Fläche treten die
reichlichen Blutgefässe in das Organ ein, die sich zu einem capillaren Kranz
an dem freien Rande des Organs auflösen. Auch das wellige Bindegewebe des
Peritonäums rückt auf der inneren Seite weiter gegen den Rand des Organs
vor als auf der äusseren, wo die zelligen Elemente freiliegen. Man kann daher
beim Lappenorgan, wie beim Ovarium, das auch seine Gefässe an der Innenseite
empfängt und ausschliesslich auf seiner äusseren Fläche Falten bildet
(daher sich diese beim reifen Ovarium sammtartig anfühlt), die äussere Fläche
„K e i m s e i t e “ und die innere Fläche „B l u t g e f ä s s s e i t e “ nennen.
Beide Seiten des Lappenorgans werden bedeckt von einem Plattenepitelium,
das sich in das Peritonealepitel fortsetzt, aber kleinzelliger und leichter
zur Anschauung zu bringen ist als dieses. Die einzelnen Plattenepitelien sind
polygonal, mit grossen ovalen oder polygonalen Kernen, strecken sich aber
an manchen Stellen und zwar besonders an den Rändern der Läppchen und
am angehefteten Rand des Organs in die Länge und ziehen sich zu Spindelzellen
aus. (Fig. 2.)Auf der äusseren Fläche des Organs sind sie zu eigenthümlichen sternförmigen
Figuren angeordnet. Das Epitel des Eierstockes ist dem eben beschriebenen
sehr ähnlich. Unterhalb des Epitels findet sich ein bindegewebiges
Maschenwerk, das je nach der Reife des Organs eine mehr oder minder complicirte
Ausbildung erreicht hat, und in den Lücken dieses Gerüstes Zellen,
die ich als die wesentlichen und charakteristischen Elemente des Lappenorgans
betrachten muss.Diese Zellen sind, frisch untersucht, ganz durchsichtig, wie die frischen
Eizellen; nach Behandlung mit Reagentien werdenS.
425
sie granulirt, sie
haben einen grossen, rundlichen, gewöhnlich sich stärker imbibirenden Kern,
welcher constant ein sehr dunkles Kernkörperchen zeigt.Die Zellen selbst sind kleiner als die Eizellen und auch sonst leicht von
diesen zu unterscheiden, sie sind rundlich, wenn sie einzeln in den Maschen
des Gerüstes liegen, dagegen kubisch wenn sie zu mehreren in einer Gewebslücke
beisammen liegen und sich gegenseitig abgeplattet haben. Für gewöhnlich
sind die Grenzen der Zelle durch scharfe Contouren gegeben, es
kommen aber Zellen vor, denen diese abgehen. (Fig. 3 d.)Diese Inhaltszellen des Lappenorgans charakterisiren sich durch mancherlei
Eigenschaften als jugendliche und wenig resistente Elemente. Sie sind sehr
empfindlich gegen Reagentien, schwer in unveränderter Form zu conserviren,
sie geben auch bei denselben Methoden nicht durchwegs dieselben Bilder. Ich
konnte Zellen mit hellen Kernen isoliren, während gewöhnlich die Zellkerne
ein dichteres Gefüge als der Zellenleib zu haben scheinen. Mitunter ergaben
sich aus kleinen Läppchen Zellen, die wenig Ähnlichkeit mit der Mehrzahl
der Inhaltszellen zu haben schienen. Sie zeigten eine sehr stark glänzende
Kerncontour und anstatt des so charakteristischen dunkeln Kernkörperchens
den Kern erfüllt von einer dunkeln fein granulirten Masse, die noch durch
einen hellen Hof von der Kerncontour geschieden war. (Fig. 4 a, b.)Ich glaube nicht, dass diese Zellen eine besondere Art ausmachen, die man
von den anderen Elementen des Lappenorgans abtrennen sollte; ich vermuthe
vielmehr, dass unbemerkt gebliebene Veränderungen in der Stärke der
Reagentien und gewisse Zustände der Zellen, welche die Eigenthümlichkeit
haben die Kerne in Mitleidenschaft zu ziehen und ihr Aussehen zu verändern,
diese abweichenden Bilder hervorgebracht haben.In ganz kleinen Lappen habe ich einige Male Zellen in sehr geringer
Menge gefunden, welche durch ihre Grösse und ihr Aussehen, besonders
durch einen Kranz von hellen Kügelchen in der Peripherie des Kernes ganz
dieselben Bilder wie mittelgrosse und kleine Eizellen gaben. (Fig. 4 c.) Ich
enthalte mich einer Deutung dieser sehr seltenen Elemente.S.
426
Die Inhaltszellen liegen, wie erwähnt, in den Lücken eines bindegewebigen
Gerüstes. Durch Zerzupfungen ganz kleiner Läppchen oder
durch die Betrachtung der Partien eines Lappenorgans, die sich zwischen
den Läppchen befinden, kann man sich überzeugen, dass dieses Gerüste aus
Zellen und deren verschieden gestalteten Ausläufern besteht, neben denen
dickere Bindegewebsfasern vorkommen.Die Zellen tragen die Charaktere von Bindegewebskörpern an sich: sie
sind unregelmässig, halbmondförmig, dreikantig, mitunter sternförmig,
gewöhnlich aber spindelförmig, zeigen einen nicht granulirten, sich stark
färbenden Kern, der meist die Gestalt der Zelle bestimmt und von einem
schmalen Saum umgeben ist, welcher in die faserförmigen, gewöhnlich leisten-
und plattenförmigen Fortsätze ausläuft. Durch diese Leistchen, die
oft absonderlich geformt, geknickt und mit Einlagerungen von glänzenden
kleinen Körpern versehen sind, verbinden sich die Zellen mit einander und
stellen Rahmen – mitunter scheint es, sogar geschlossene Räume her, – in
denen die Inhaltszellen liegen. (Fig. 4 d, g, f.)Von letzteren erhält man oft Bilder, die auf Proliferationszustände schliessen
lassen. Es ist vielleicht kein Gewicht darauf zu legen, dass man in den
unreifsten Läppchen und gegen den freien Rand auch etwas grösserer Lappen
die Inhaltszellen gewöhnlich einzeln in den Lücken des bindegewebigen Zellennetzes
trifft, dagegen im Innern der kleineren Läppchen und in älteren
Läppchen überhaupt in einem Maschenraum zwei, drei oder mehr Inhaltszellen
antrifft, die ganz das Ansehen von Spaltungsproducten tragen. (Fig.
3 a, b.) Man sieht aber auch oft in einer Lücke anstatt einer einzigen Zelle
ein kleines Häufchen von Kernen im Protoplasma eingebettet, welches keine
Zellgrenzen erkennen lässt, (Fig. 3 c.) und dann andere Stellen, wo sich um
einige dieser Kerne schon Zellgrenzen gebildet haben, während andere noch
frei im Protoplasma liegen. Endlich ist anzuführen, dass die Inhaltszellen an
Grösse ab- und an Zahl zunehmen, je grösser und reifer das Lappenorgan ist.Eine solche Proliferation der Inhaltszellen verbunden mit Wucherung des
Gerüstes scheint den Vorgang der Läppchenbildung auszumachen. In den
kleineren aber gut gesondertenS.
427
Lappen sind die Maschenräume weiter
geworden, das Gerüste zeigt sich derber, aus Platten, dicken Fasern, Spindelzellen
bestehend, die Inhaltszellen, die keine neuen Charaktere zeigen,
liegen im Haufen beisammen. (Fig. 5 hz). Von der Fläche besehen, zeigen
die Läppchen das facettirte Aussehen, das S y r s k i beschrieben hat; die
Facetten entsprechen Anhäufungen von Zellen, die unmittelbar unter dem
Epitel liegen, die Scheidewände der Facetten entsprechen dem bindegewebigen
Gerüste. Ein frisches Läppchen zeigt sich ausserdem mit Fettkörnchen
erfüllt, die die Zellen oft verdecken können. Ebenso kann das reiche Blutgefässnetz,
dessen Capillaren überall mit den Balken des Gerüstes verlaufen,
die Ansicht der Zellen im frischen Zustand stören.In den grossen, dicken und weisslichen Lappen ist das Gerüste noch
mächtiger geworden und gibt dem Gewebe trotz seines Zellenreichthums
grosse Derbheit und Festigkeit. Vom freien Rand des Lappens haben sich
Dissepimente hinein gebildet, die Inhaltszellen sind bedeutend kleiner geworden,
sie liegen nicht mehr unregelmässig durch das Gerüste zerstreut,
sondern haben e i g e n t h ü m l i c h e Z e l l s t r ä n g e entstehen
lassen, welche am Rande des Lappens durch die erwähnten Dissepimente
getrennt sind, einen sehr unregelmässigen Verlauf durch den Lappen nehmen
und in dessen Innerem mit einander vielfach anastomosiren. Ein Lumen
schliessen die Zellstränge nicht ein, sie sind durchaus solide; ob ihnen
Schläuche von einer membrana propria ausgekleidet entsprechen: dies zu entscheiden,
ist mir nicht geglückt.Ich zweifle nicht, dass mit der zuletzt beschriebenen Form die Entwicklung
des Lappenorgans nicht abgeschlossen ist, aber ich kann keine Mittheilung
über die weiteren Schicksale desselben machen, denn es ist mir nicht
gelungen, einen reiferen Zustand des Lappenorgans zu erhalten. Ich bedaure
dies umsomehr, als unsere jetzigen Kenntnisse vom Lappenorgan einen sicheren
Ausspruch über dessen Natur nicht zu rechtfertigen scheinen.
Wenn man sich zu orientiren sucht, was sich mit einiger Wahrscheinlichkeit
über das Lappenorgan sagen lässt, so ergibt sich Folgendes: Die Mei-
nung, dass das Lappenorgan eine Modi-S.
428
fication des Ovariums ist,
welche von einem frühen Entwicklungszustand des letzteren ausgeht, ist zwar
nicht völlig auszuschliessen, denn es ist ja nicht gelungen nachzuweisen, dass
die erste Anlage beider Organe schon eine verschiedene sei; sie ist aber gar
nicht wahrscheinlich, denn soweit das Lappenorgan in seiner Entwicklung
zurückverfolgt worden, hat es sich als different vom unreifen Ovarium erwiesen.
Es fehlen auch alle Übergänge zwischen entwickelten Formen des
Lappenorgans und des Ovariums, vielmehr entwickelt sich das Lappenorgan
zu einem ganz anderen Typus als der Eierstock. Hier werden die Zellen grösser,
ohne wie es scheint, sich zu vermehren, bleiben in Reihen angeordnet;
dort hingegen proliferiren die Zellen, werden kleiner und ordnen sich endlich
zu anastomosirenden Strängen. Für die Hodennatur des Lappenorgans
spricht der histologische Bau nicht direct, denn ein bindegewebiges Gerüste
und rundliche Zellen in dessen Maschen, die proliferiren, sind Bestandtheile,
welche vielen jugendlichen Organen zukommen mögen. Die mikroskopische
Untersuchung des Lappenorgans spricht aber auch nicht gegen die Auffassung,
dass das Lappenorgan der Hoden der Aale sei, denn das Lappenorgan,
wie es S y r s k i bei bis 430mm grossen Aalen gefunden hat, stellt sich als
ein u n r e i f e s Organ heraus, und jene Veränderungen der Zellen, welche
zur Spermatozoenbildung führen, könnten noch bei weiterer Reife auftreten.
Die beständige Proliferation, die Verkleinerung der Zellen und ihre Anordnung
zu Strängen: diese Vorgänge in dem Lappenorgan des Aals scheinen
der Meinung, dass das Lappenorgan der Hoden sei, die ja von S y r s k i
durch anatomische Gründe gestützt ist, wenigstens nicht zu widersprechen.Es würde sich dann thatsächlich so verhalten, wie v . S i e b o l d es
in seinem Buch über die Süsswasserfische Mitteleuropa’s ausgedrückt hat
„d a s s d i e A a l e n i c h t i m G e r i n g s t e n f ü r d a s
F o r t p f l a n z u n g s g e s c h ä f t v o r b e r e i t e t i n d a s
M e e r h i n a u s t r e t e n . “
Es wäre dann auch der Ausspruch von S y r s k i , dass bei den Aalen Dimorphismus
herrsche, indem die Weibchen grösser seien als die Männchen, einzuschränken;
es lässt sich dies höchstens von den nicht geschlechtsreifen Thieren
sagen, dennS.
429
selbst wenn man zugibt, dass das Lappenorgan der Hoden ist,
so hat doch niemand ein reifes Lappenorgan und ein reifes Aalmännchen gesehen.
S y r s k i hat auch angegeben, dass die Aale, welche das Lappenorgan
besitzen, grosse Augen haben. M . C . D a r e s t e hat (in einer Mittheilung,
die ich aus den Annals nat. History, Vol. 16, Nr. 96 kenne) hinzugefügt,
dass diese kleinen Aale mit grossen Augen in Frankreich als Varietät
pimperneau unterschieden werden, und dass es von dieser Varietät auch solche
gebe, die Ovarien und kein Lappenorgan besitzen, er hat darauf die Meinung
gegründet, dass die Aalvarietät pimperneau beiderlei Geschlechter besitze und
fruchtbar sei, und dass die anderen Aalvarietäten, die bloss Ovarien haben,
die Eier nicht zur Entwicklung bringen und steril bleiben.Ich muss gestehen, dass mir die Schlüsse, die D a r e s t e gezogen hat,
wenig zwingend erscheinen. Weder er noch S y r s k i haben, so viel ich
weiss, Messungen mitgetheilt, aus denen hervorgehen würde, dass die Aale mit
Lappenorganen grosse Augen haben. Ich habe in Triest gegen 50 Aale, theils
Weibchen, theils solche mit Lappenorgan, gemessen und niemals gefunden,
dass zwischen dem Vorhandensein oder Fehlen des Lappenorgans und der −
relativen oder absoluten − Grösse des Auges ein Zusammenhang bestünde; ich
darf also behaupten, dass auch bei Aalen mit kleinen Augen, die also nicht zur
Varietät pimperneau gezählt werden können, das Lappenorgan vorkommt und
damit fällt die Unterscheidung der Aale in sterile und fruchtbare Varietäten.Um anschaulich zu machen, dass die Grösse der Augen wohl von anderen
Dingen als von der Anwesenheit des Lappenorgans beeinflusst wird, theile
ich die Messungen der Körperlänge des Kopfes und des horizontalen Durchmessers
des Auges von drei Aalen mit, die alle drei das Lappenorgan besassen
und alle gewisse sehr auffallende Merkmale,1 mit einander gemein hatten.1) Diese Merkmale sind: Sehr dunkle, ins Grünliche oder Bläuliche spielende Färbung
des Rückens, tief schwarze Brustflossen, wenig steiler, geradliniger Abfall
des Kopfes zur Schnauze, grosse Deutlichkeit der Seitenporen am Kopfe. Ich habe
auch Aale von solchem Aussehen gefunden, die Ovarien hatten.
Das Thier C hatte also trotz seiner bedeutenden Körperlänge relativ und absolut
kleine Augen und zwar relativ kleinere Augen als die meisten Aalweibchen.S.
430
A B C
Körperlänge 350mm 390mm 430mm
Von der Schnauzenspitze
bis zum Kiemenloch
42 47 42
Horizontaler Durchmesser des Auges 8 9 6D a r e s t e hat allerdings auch seine Unterscheidung der Aale in grossäugige
fruchtbare und kleinäugige sterile darauf basirt, dass die ersteren,
die pimperneau, sich nur an den Flussmündungen aufhalten, während die
letzteren in die Flüsse selbst aufsteigen. Ich habe über die Thatsache selbst
keine Erfahrung, möchte es aber für gewagt halten, Unterscheidungen von
Varietäten auf Verhältnisse wie Körperlänge, Aufenthalt und Dimensionen
des Auges zu gründen, welche theils mit dem Alter, theils individuell und
physiologisch variiren können.S.
S.
S.
431
Erklärung der Abbildungen.
Fig. 1. Die hauptsächlichsten Formen des Lappenorgans. Schematische
Zeichnung.
A Lappenloses Organ.
B Organ mit schmalen hyalinen Läppchen.
C Entwickeltes Lappenorgan.
Fig. 2. Epitelien des Lappenorgans isolirt aus Müller’scher Flüssigkeit.
p. E. polygonales Epitel.
sp. E. Spindelzellen-Epitel.
Fig. 3. Inhaltszellen und Bindegewebskörper des Lappenorgans isolirt, aus
Müller’scher Flüssigkeit. Vergrössert gezeichnet nach H a r t n . 4/8,
a drei Inhaltszellen
b zwei Zellen von Bindegewebskörpern umringt.
c Kerne in feinkörnigem Protoplasma von Bindegewebskörpern
eingeschlossen.
d zwei Bindegewebskörper mit einander verbunden, deren leistenförmige
Fortsätze eine Zelle einrahmen.
e Bindegewebszelle mit grossem Protoplasmasaum.
f Bindegewebszelle mit ringförmiger Leiste.
g Bindegewebskörper mit leistenförmigem Fortsatz.
h Ungewöhnliche Form der Verbindung zweier Bindegewebskörper
durch ein geknicktes Leistchen.
Fig. 4. Ungewöhnliche Zellen aus einem kleinen Lappen. a und b isolirt aus
Müller’scher Flüssigkeit, c isolirt aus Überosmiumsäure. Die Zellen
von spindelförmigen Körpern umgeben.
Fig. 5. Ansicht eines Stückchen vom freien Rande des Lappenorgans zwischen
zwei kleinen Läppchen.
sp. Spindelzellen.
b. Bindegewebskörper.
z. Zellen des Lappenorgans.
hz. Zellen des Lappenorgans in Häufchen angeordnet.
bsb11354451
419
–431