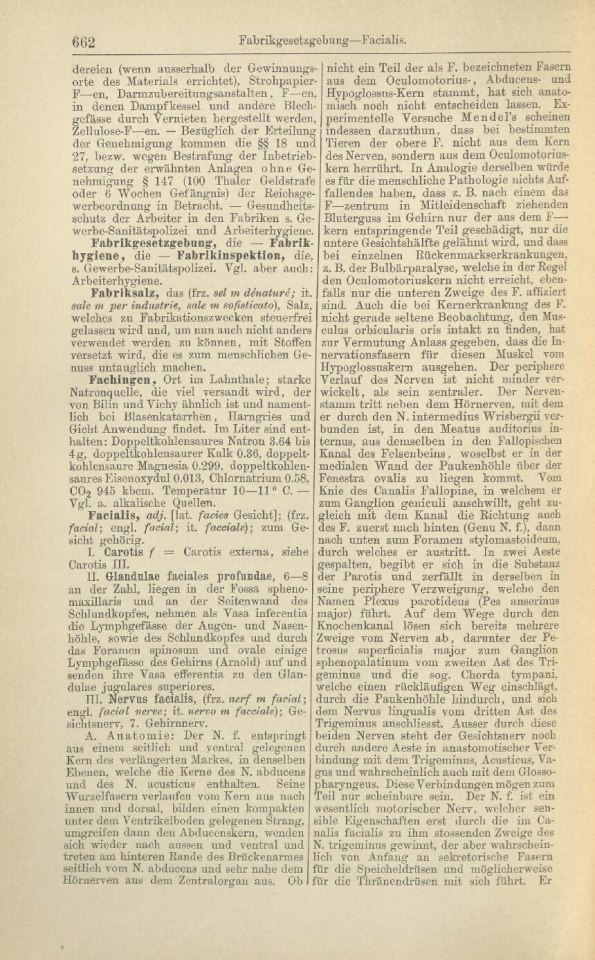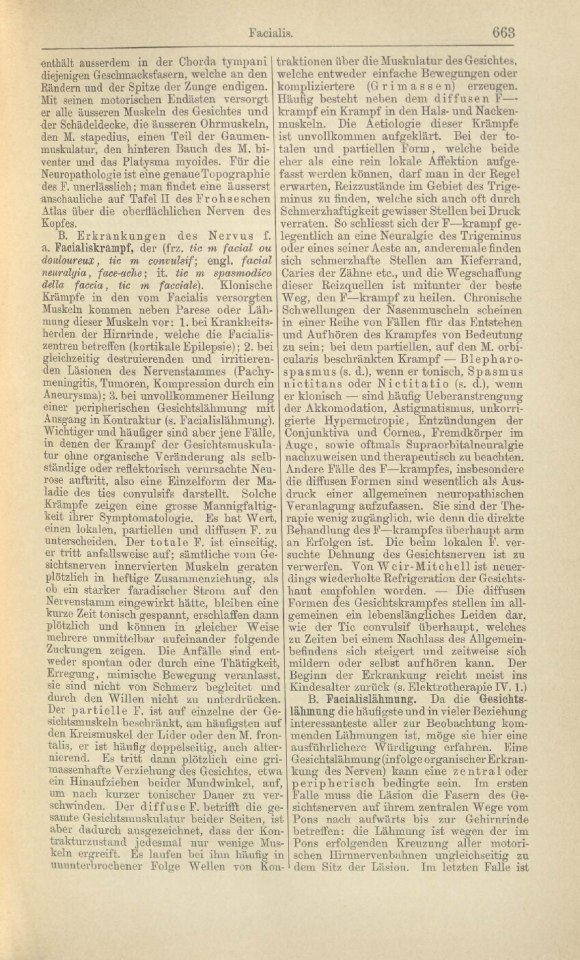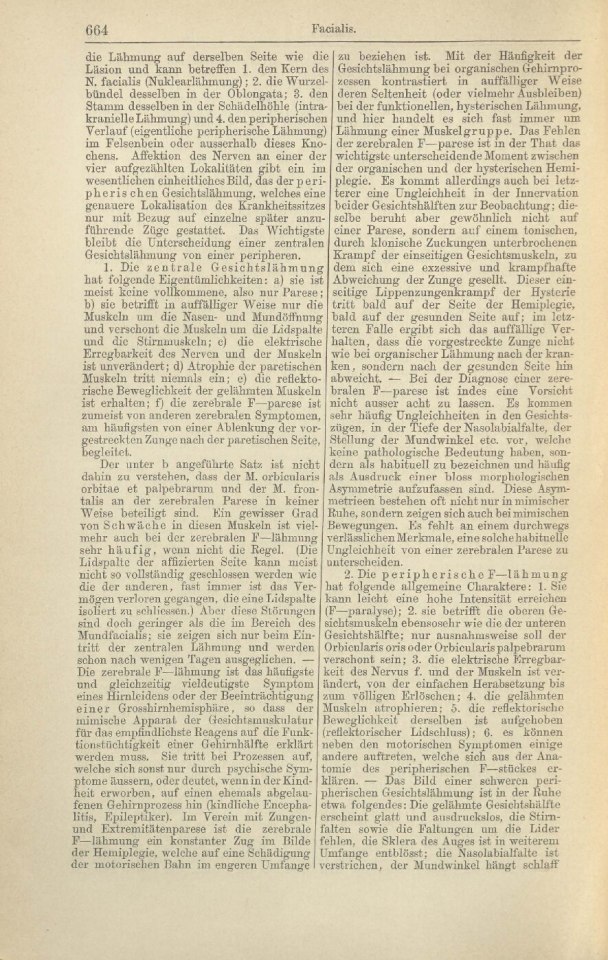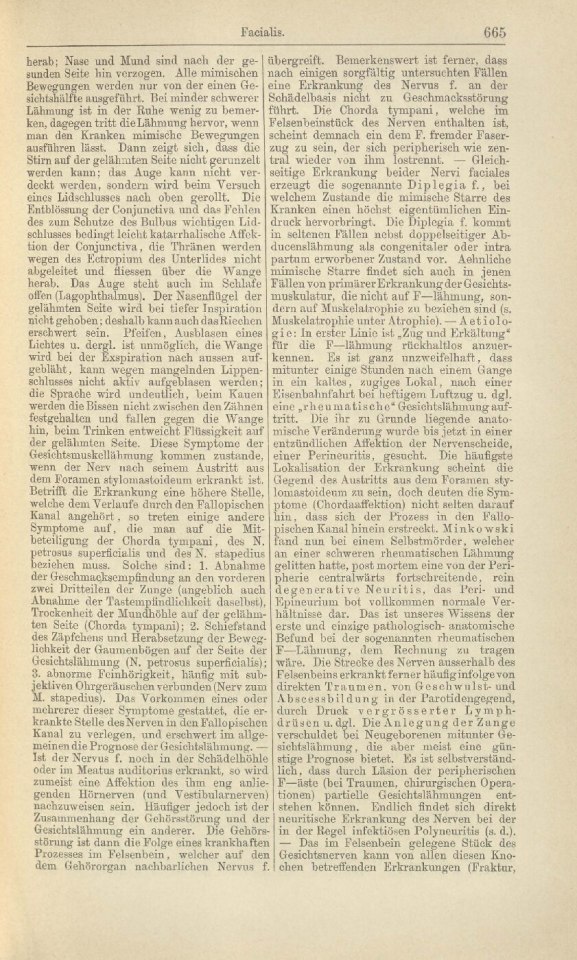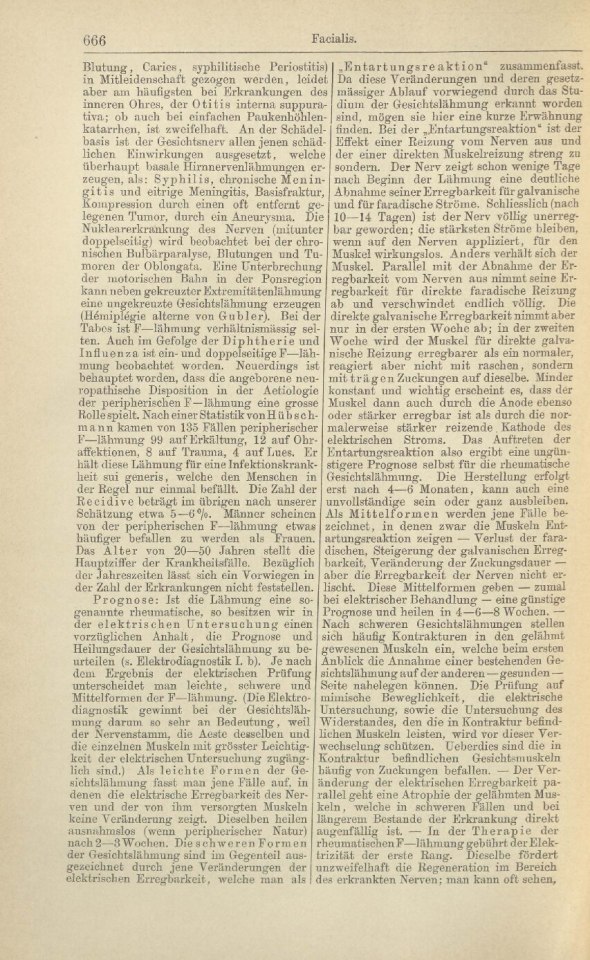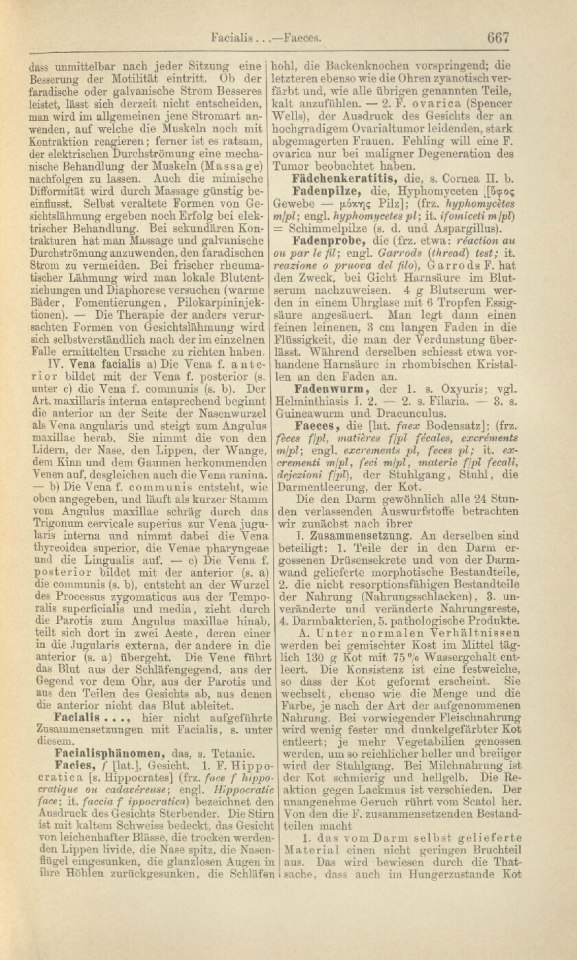S.
Facialis, adj. [lat. facies Gesicht]; (frz.
facial; engl. facial; it. facciale); zum Ge
sicht gehörig.
I. Carotis f = Carotis externa, siehe
Carotis III.
II. Glandulae faciales profundae, $6-8$
an der Zahl, liegen in der Fossa spheno
maxillaris und an der Seitenwand des
Schlundkopfes, nehmen als Vasa inferentia
die Lymphgefässe der Augen- und Nasen
höhle, sowie des Schlundkopfes und durch
das Foramen spinosum und ovale einige
Lymphgefässe des Gehirns (Arnold) auf und
senden ihre Vasa efferentia zu den Glan
dulae jugulares superiores.
III. Nervus facialis, (frz. nerf m facial;
engl. facial nerve; it. nervo m facciale); Ge
sichtsnerv, $7$. Gehirnnerv.
A. Anatomie: Der N. f. entspringt
aus einem seitlich und ventral gelegenen
Kern des verlängerten Markes, in denselben
Ebenen, welche die Kerne des N. abducens
und des N. acusticus enthalten. Seine
Wurzelfasern verlaufen vom Kern aus nach
innen und dorsal, bilden einen kompakten
unter dem Ventrikelboden gelegenen Strang,
umgreifen dann den Abducenskern, wenden
sich wieder nach aussen und ventral und
treten am hinteren Rande des Brückenarmes
seitlich vom N. abducens und sehr nahe dem
Hörnerven aus dem Zentralorgan aus. Ob
nicht ein Teil der als F. bezeichneten Fasern
aus dem Oculomotorius-, Abducens- und
Hypoglossus-Kern stammt, hat sich anato-
misch noch nicht entscheiden lassen. Ex-
perimentelle Versuche Mendel's scheinen
indessen darzuthun, dafs bei bestimmten
Tieren der obere F. nicht aus dem Kern
der Nerven, sondern aus dem Oculomotorius-
kern herrührt. In Analogie derselben würde
es für die menschliche Pathologie nichts Auf-
fälliges haben, dass z. B. nach einem das
F.-zentrum in Mitleidenschaft ziehenden
Bluterguss im Gehirn nur der aus dem F.-
kern entspringende Teil geschädigt, nur die
untere Gesichtshälfte gelähmt wird und dafs
bei einzelnen Rückenmarkserkrankungen,
z. B. der Bulbärparalyse, welche in der Regel
den Oculomotoriuskern nicht erreichen, eben-
falls nur die unteren Zweige des F. afficirt
sind. Auch die bei Kernerkrankung des F.
nicht gerade seltene Beobachtung, den Mus-
culus orbicularis oris intakt zu finden, hat
zur Vermutung Anlass gegeben, dass die In-
nervationsfasern für diesen Muskel vom
Hypoglossuskern ausgehen. Der periphere
Verlauf des Nerven ist nicht minder ver-
wickelt, als sein zentraler. Der Nerven-
stamm tritt neben dem Hörnerven, mit dem
er durch den N. intermedius Wrisbergi ver-
bunden ist, in den Meatus auditorius in-
ternus, aus demselben in den Fallopischen
Kanal des Felsenbeins, wo selbst er in der
medialen Wand der Paukenhöhle über der
Fenestra ovalis zu liegen kommt. Vom
Knie des Canalis Fallopiæ, in welchem er
zum Ganglion geniculatum anschwillt, geht zu-
gleich mit dem Kanal die Richtung auch
des F. zuerst nach hinten (Genu N. F.), dann
nach unten zum Foramen stylomastoideum,
durch welches er austritt. In zwei Aeste
gespalten, begibt er sich in die Substanz
der Parotis und zerfällt in derselben in
eine periphere Verzweigung, welche den
Namen Plexus Parotideus (Pes anserinus
major) führt. Auf dem Wege durch den
Knochenkanal lösen sich bereits mehrere
Zweige vom Nerven ab, darunter der Pe-
trosus superficialis major zum Ganglion
sphenopalatinum, vom zweiten Ast der Tri-
geminus und die sog. Chorda tympani,
welche einen rückläufigen Weg einschlägt,
durch die Paukenhöhle hindurch, und sich
zum Nervus lingualis, vom dritten Ast des
Trigeminus anschliesst. Ausser durch diese
beiden Nerven steht der Gesichtsnerv noch
durch andere Aeste in anatomischer Ver-
bindung mit dem Trigeminus, Acousticns, Va-
gus und wahrscheinlich auch mit dem Glosso-
pharyngeus. Diese Verbindungen mögen zum
Teil nur scheinbare sein. Der N. F. ist ein
wesentlich motorischer Nerv, welcher sen-
sible Eigenschaften erst durch die im Ca-
nalis facialis zu ihm stossenden Zweige des
N. trigeminus gewinnt, der aber wahrschein-
lich von Anfang an secretorische Fasern
für die Speicheldrüsen und möglicherweise
für die Thränendrüsen mit sich führt. Er
S.
enthält ausserdem in der Chorda tympani tre-
diejeningen Geschmacksfasern, welche an den
Rändern und der Spitze der Zunge endigen.
Mit seinen motorischen Endästen versorgt
er alle äusseren Muskeln des Gesichtes und
der Schädeldecke, die äusseren Ohrmuskeln,
den M. stapedius, einen Teil der Gaumen-
muskulatur, den hinteren Bauch des M. di-
venter und des Platysma myoides. Für die
Neuropathologie ist eine genaue Topographie
des F. unerlässlich; man findet ein Lässeres
ausschaulich auf Tafel II des Frohnschen
Atlas über die oberflächlichen Nerven des
Kopfes.B. Erkrankungen des Nervus f.
Facialiskrampf, der (frz. tic m facial ou
douloureux, tic m convulsif; engl. facial
neuralgia, facache; it. tic m spasmotico
della faccia, tic m facciale). Klonische
Krämpfe in den vom Facialis versorgten
Muskeln kommen neben Parese oder Läh-
mung dieser Muskeln vor: 1. bei Krankheits-
herden der Hirnrinde, welche die Facialis-
zentren betreffen (kortikale Epilepsie); 2. bei
gleichzeitig destruierenden und irritieren-
den Läsionen des Nervenstammes (Pachy-
meningitis, Tumoren, Kompression durch ein
Aneurysma); 3. bei unvollkommener Heilung
einer peripherischen Gesichtslähmung mit
Ausgang in Kontraktur (s. Facialislähmung).
Wichtiger und häufiger sind aber jene Fälle,
in denen der Krampf der Gesichtsmuskula-
tur ohne organische Veränderung als selb-
ständige oder reflektorisch verursachte Neu-
rose auftritt, also eine Einzelform der Ma-
ladie des Tics convulsifs darstellt. Solche
Krämpfe zeigen eine grosse Mannigfaltig-
keit ihrer Symptomatologie. Es hat Wert,
einen lokalen, partiellen und diffusen F. zu
unterscheiden. Der totale F. ist einseitig,
er tritt anfallsweise auf; sämtliche vom Ge-
sichtsnerven gerichteten Muskeln geraten
plötzlich in heftige Zusammenziehung, als
ob ein starker faradischer Strom auf den
Nervenstammm eingewirkt hätte, bleiben eine
kurze Zeit tonisch gespannt, erschlaffen dann
plötzlich und können in gleicher Weise
mehrere unmittelbar aufeinander folgende
Zuckungen zeigen. Die Anfälle sind ent-
weder spontan oder durch eine Thätigkeit,
Bewegung, mimische Bewegung veranlasst,
sie sind nicht von Schmerz begleitet und
durch den Willen nicht zu unterdrücken.
Der partielle F. ist auf einzelne Ge-
sichtsmuskeln beschränkt, am häufigsten auf
den Kreismuskel der Lider oder den M. fron-
talis, er ist mässig doppelseitig, auch alter-
nierend. Es tritt dann plötzlich eine gri-
massenhafte Verziehung des Gesichtes, etwa
ein Hinaufziehen beider Mundwinkel, auf,
um nach kurzer tonischer Dauer zu ver-
schwinden. Der diffuse F. betrifft die ge-
samte Gesichtsmuskulatur beider Seiten, ist
aber dadurch ausgezeichnet, dass der Kon-
trakturzustand jedesmal nur wenige Mus-
keln ergreift. Es folgen bei ihm häufig in
ununterbrochener Folge Wellen von Kon-
traktionen über die Muskulatur des Gesichtes,
welche entweder einfache Bewegungen oder
kompliziertere (Grimassen) erzeugen.
Häufig besteht neben dem diffusen F.-
krampf ein Krampf in den Hals- und Nacken-
muskeln. Die Aetiologie diesen Krampfes
ist unvollkommen aufgeklärt. Bei dem to-
talen und partiellen Form, welche beide
eher als eine rein lokale Affektion aufge-
fasst werden können, darf man in der Regel
erwarten, Reizzustände im Gebiete des Trige-
minus zu finden, welche sich auch oft durch
Schmerzhaftigkeit gewissen Stellen bei Druck
verraten. So schliesst sich der F.-krampf ge-
legentlich an eine Neuralgie des Trigeminus
oder eines seiner Aeste an, anderemals finden
sich schmerzhafte Stellen am Kieferrand,
Caries der Zähne etc. und die Wegschaffung
dieser Reizquellen ist mitunter der beste
Weg, den F.-krampf zu heilen. Chronische
Schwellungen der Kiefermuscheln scheinen
in einer Reihe von Fällen für das Entstehen
und Aufhören des Krampfes von Bedeutung
zu sein; bei dem partiellen, auf den M. obi-
cularis beschränkten Krampf – Blepharo-
spasmus (s. d.), wenn er tonisch, Spasmus
nictitans oder Nictitatio (s. d.), wenn
er klonisch – sind häufig Ueberanstrengung
der Akkomodation, Astigmatismus, unkorri-
gierte Hypermetropie, Entzündungen der
Conjunctiva und Cornea, Fremdkörper im
Auge, sowie oftmals Supraorbitalneuralge
nachzuweisen und therapeutisch zu beachten.
Andere Fälle des F.-krampfes insbesondere
die diffusen Formen sind wesentlich als Aus-
druck einer allgemeinen neuropathischen
Veranlagung aufzufassen. Sie sind der The-
rapie wenig zugänglich, wie denn die directe
Behandlung des F.-krampfes überhaupt arm
an Erfolgen ist. Die beim lokalen F. ver-
suchte Dehnung des Gesichtsnerven ist zu
verwerfen. Von Weir-Mitchell ist neuer-
dings wiederholte Refrigeration der Gesichts-
haut empfohlen worden. – Die diffusen
Formen des Gesichtskrampfes stehen im all-
gemeinen ein lebenslängliches Leiden dar,
wie der Tic convulsif überhaupt, welches
zu Zeiten bei seinem Nachlass des Allgemein-
befindens sich steigert und zeitweise sich
mildert oder selbst aufhören kann. Der
Beginn der Erkrankung reicht meist ins
Kindesalter zurück (s. Elektrotherapie IV, 1.)C. Facialislähmung. Da die Gesichts-
lähmung die häufigste und in vieler Beziehung
interessanteste aller zur Beobachtung kom-
menden Lähmungen ist, möge sie hier eine
ausführlichere Würdigung erfahren. Eine
Gesichtslähmung (infolge organischer Erkran-
kung des Nerven) kann eine zentral oder
p e r i p h e r i s c h bedingte sein. Im ersten
Falle muss die Läsion die Fasern des Ge-
sichtsnerven auf ihrem zentralen Wege vom
Pons nach aufwärts bis zur Gehirnrinde
betreffen; die Lähmung ist wegen der im
Pons erfolgenden Kreuzung aller motori-
schen Hirnnervenbahnen ungleichseitig zu
dem Sitz der Läsion. Im letzten Falle ist
S.
die Lähmung auf derselben Seite wie die
Läsion und kann betreffen 1. den Kern des
N. facialis (Nuklearlähmung); 2. die Wurzel-
bündel desselben in der Oblongata; 3. den
Stamm desselben in der Schädelhöhle (intra-
kranielle Lähmung) und 4. den peripherischen
Verlauf (eigentliche peripherische Lähmung)
im Felsenbein oder ausserhalb dieses Kno-
chens. Affektion des Nerven an einer der
vier aufgezählten Lokalitäten gibt ein im
wesentlichen einheitliches Bild, das der peri-
pherischen Gesichtslähmung, welches eine
genauere Lokalisation des Krankheitsherdes
nur mit Bezug auf einzelne später anzu-
führende Züge gestattet. Das Wichtigste
bleibt die Unterscheidung einer zentralen
Gesichtslähmung von einer peripheren.I. Die zentrale Gesichtslähmung
hat folgende Eigentümlichkeiten: a) sie ist
meist keine vollkommene, also nur Parese;
b) sie betrifft in auffälliger Weise nur die
Muskeln um die Nasen- und Mundöffnung
und verschont die Muskeln um die Lidspalte
und die Stirnmuskeln; c) die elektrische
Erregbarkeit des Nerven und der Muskeln
ist unverändert; d) Atrophie der paretischen
Muskeln tritt niemals ein; e) die reflektro-
rische Beweglichkeit der gelähmten Muskeln
ist erhalten; f) die zerebrale F.-parese ist
zumeist von anderen zerebralen Symptomen,
am häufigsten von einer Ablenkung der vor-
gestreckten Zunge nach der paretischen Seite,
begleitet.Der unter b angeführte Satz ist nicht
dahin zu verstehen, dass der M. orbicularis
orbitae et palpebrarum und der M. fron-
talis an der zerebralen Parese in keiner
Weise beteiligt sind. Ein gewisser Grad
von Schwäche in diesen Muskeln ist viel-
mehr auch bei der zerebralen F.-lähmung
mehr häufig wenn nicht die Regel. (Die
Lidspalte der affizierten Seite kann meist
nicht so vollständig geschlossen werden wie
die der anderen, fast immer ist das Ver-
mögen verloren gegangen, die eine Lidspalte
isoliert zu schliessen.) Aber diese Störungen
sind doch geringer als im Bereiche der
Mundfacialis; sie zeigen sich nur beim Ein-
tritt der zentralen Lähmung und werden
schon nach wenigen Tagen ausgeglichen.
Die zerebrale F.-lähmung ist das häufigste
und gleichzeitig vielseitigste Symptom
eines Hirnleidens oder der Beeinträchtigung
einer Grosshirnhemisphäre so dass der
mimische Apparat der Gesichtsmuskulatur
für das empfindlichste Reagens auf die Funk-
tionstüchtigkeit einer Gehirnhälfte erklärt
werden muss. Sie tritt bei Prozessen auf,
welche sich sonst nur durch psychische Sym-
ptome äussern, oder deutet, wenn in der Kind-
heit erworben, auf einen ehemals abgelau-
fenen Gehirnprozess im kindliche Encepha-
litis (Kinderlähm.). Im Verein mit Zungen-
und Extremitätenparese ist die zerebrale
F.-lähmung ein konstante Zug im Bilde
der Hemiplegie, welche auf eine Schädigung
der motorischen Bahn im engeren Umfange
zu beziehen ist. Mit der Häufigkeit der
Gesichtslähmung bei organischen Gehirnpro-
zessen kontrastiert in auffälliger Weise
deren Seltenheit (oder vielmehr Ausbleiben)
bei der funktionellen, hysterischen Lähmung
und hier handelt es sich fast immer um
Lähmung einer Muskelgruppe. Das Fehlen
der zerebralen F.-parese ist in der That das
wichtigste unterscheidende Moment zwischen
der organischen und der hysterischen Hemi-
plegie. Es kommt allerdings auch bei Letz-
terem eine Ungleichheit in der Innervation
beider Gesichtshälften zur Beobachtung; die-
selbe beruht aber gewöhnlich nicht auf
einer Parese, sondern auf einem tonischen
durch klonische Zuckungen unterbrochenen
Krampf der einseitigen Gesichtsmuskeln,
dem sich eine exzessive und krampfhafte
Abweichung der Zunge gesellt. Dieser ein-
seitige Lippenzungenkrampf der Hysterie
tritt bald auf der Seite der Hemiplegie,
bald auf der gesunden Seite auf; im letz-
teren Falle ergibt sich das auffällige Ver-
halten, dass die vorgestreckte Zunge nicht
wie bei organischer Lähmung nach der kran-
ken sondern nach der gesunden Seite hin
abweicht. Bei der Diagnose einer zere-
bralen F.-parese ist indes eine Vorsicht
nicht ausser acht zu lassen. Es kommen
sehr häufig Ungleichheiten in den Gesichts-
zügen, in der Tiefe der Nasolabialfalte, der
Stellung der Mundwinkel etc. vor, welche
keine pathologische Bedeutung haben, son-
dern als habituell zu bezeichnen und häufig
als Ausdruck einer bloss morphologischen
Asymmetrie aufzufassen sind. Diese Asym-
metrieen bestehen oft nicht nur im mimischen
Ruhe, sondern zeigen sich auch bei mimischen
Bewegungen. Es fehlt an einem durchwegs
verlässlichen Merkmale, eine solche habituelle
Ungleichheit von einer zerebralen Parese zu
unterscheiden.II. Die peripherische F.-lähmung
hat folgende allgemeine Charaktere: 1. Sie
kann leicht eine hohe Intensität erreichen
(F.-paralyse); 2. sie betrifft die obere Ge-
sichtsmuskeln ebensowier wie die der unteren
Gesichtshälfte; nur ausnahmsweise soll der
Orbicularis oris oder Orbicularis palpebrarum
verschont sein; 3. die elektrische Erregbar-
keit des Nervus f. und der Muskeln ist ver-
ändert, von der einfachen Herabsetzung bis
zum völligen Erlöschen; 4. die gelähmten
Muskeln atrophieren; 5. die reflektorische
Beweglichkeit derselben ist aufgehoben
(reflektorischer Verschluss); 6. es können
neben den motorischen Symptomen einige
andere auftreten, welche sich aus der Ana-
tomie der peripherischen F.-stückes er-
klären. – Das Bild einer schweren peri-
pherischen Gesichtslähmung ist in der Ruhe
etwa folgendes: Die gelähmte Gesichtshälfte
erscheint glatt und ausdruckslos, die Lider
fehlen, sowie die Faltungen um die Lider
fehlen, die Skleras des Auges ist in weiterem
Umfange entblösst, die Nasolabialfalte ist
verstrichen, der Mundwinkel hängt schlaff
S.
herab; Nase und Mund sind nach der ge-
sunden Seite hin verzogen. Alle mimischen
Bewegungen werden nur von der einen Ge-
sichtshälfte ausgeführt. Bei minder schwerer
Lähmung ist in der Ruhe nichts zu bemer-
ken, dagegen tritt die Lähmung hervor, wenn
man den Kranken mimische Bewegungen
ausführen lässt. Dann zeigt sich, dass die
Stirn auf der gelähmten Seite nicht gerunzelt
werden kann; das Auge kann nicht ver-
deckt werden, sondern wird beim Versuch
einen Lidschlusses nach oben gerollt. Die
Entblössung der Conjunctiva und das Fehlen
des zum Schutze des Bulbus wichtigen Lid-
schlusses bedingt nicht katarrhalische Affek-
tion der Conjunctiva. Die Thränen werden
wegen des Ectropium des Unterlides nicht
abgeleitet und fliessen über die Wange
herab. Das Auge sieht auch im Schlafe
offen (Lagophthalmus). Der Nasenflügel der
gelähmten Seite wird bei tiefer Inspiration
nicht gehoben, deshalb kann auch das Riechen
erschwert sein. Pfeifen, Ausblasen eines
Lichtes u. dergl. ist unmöglich, die Wange
wird bei der Exspiration nach aussen auf-
gebläht; kann wegen mangelnden Lippen-
schlusses nicht aktiv aufgeblasen werden;
die Sprache wird undeutlich, beim Kauen
werden die Bissen nicht zwischen den Zähnen
festgehalten und fallen gegen die Wange
hin, beim Trinken entweicht Flüssigkeit auf
der gelähmten Seite. Diese Symptome der
Gesichtsmuskellähmung können zustande
wenn der Nerv nach seinem Austritt aus
dem Foramen stylomastoideum erkrankt ist.
Betrifft die Erkrankung eine höhere Stelle,
welche dem Verlaufe durch den Fallopischen
Kanal angehört, so treten einige andere
Symptome auf, die man auf die Mit-
beteiligung der Chorda tympani, des N.
petrosus superficialis und des N. stapedius
beziehen muss. Solche sind: 1. Abnahme
der Geschmacksempfindung an den vorderen
zwei Dritteln der Zunge (angeblich auch
Abnahme der Tastenempfindlichkeit daselbst),
Trockenheit der Mundhöhle auf der gelähm-
ten Seite (Chorda tympani); 2. schlaffstand
des Zäpfchens und Herabsetzung der Beweg-
lichkeit der Gaumenbögen auf der Seite der
Gesichtslähmung (N. petrosus superficialis);
3. abnorme F e i n h ö r i g k e i t, häufig mit sub-
jektiven Ohrgeräuschen verbunden (Nerv zum
M. stapedius). Das Vorkommen eines oder
mehrerer dieser Symptome gestattet, die er-
krankte Stelle des Nerven in den Fallopischen
Kanal zu verlegen, und erschwert im allge-
meinen die Prognose der Gesichtslähmung.
Ist der Nervus f. noch in der Schädelhöhle
oder im Meatus auditoris erkrankt, so wird
zumeist eine Affektion des ihm anlie-
genden Hörnerven (und Vestibularnerven)
nachzuweisen sein. Häufiger jedoch ist der
Zusammenhang der Gehörsstörung und der
Gesichtslähmung ein anderer. Die Gehörs-
störung ist dann die Folge eines krankhaften
Prozesses im Felsenbein, welcher auf den
dem Gehörorgan nachbarlichen Nervus f.
übergreift. Bemerkenswert ist ferner, dass
nach einigen sorgfältig untersuchten Fällen
eine Erkrankung des Nervus f. an der
Schädelbasis nicht zu Geschmackssstörung
führt. Die Chorda tympani, welche im
Felsenbeinstück des Nerven enthalten ist,
scheint dermnach ein dem F. fremder Faser-
zug zu sein, der sich peripherisch wie zen-
tral wieder von ihm lostrennt. – Gleich-
seitige Erkrankung beider Nervi faciales
erzeugt die sogenannte Diplegia f., bei
welchem Zustande die mimische Starre des
Kranken einen höchst eigentümlichen Ein-
druck hervorbringt. Die Diplegia f. kommt
in seltenen Fällen nebst doppelseitiger Ab-
ducenslähmung als congenitaler oder intra
parturn erworbener Zustand vor. Ähnliche
mimische Starre findet sich auch in jenen
Fällen von primärer Erkrankung der Gesichts-
muskulatur, die nicht auf F.-lähmung, son-
dern auf Muskelatrophie zu beziehen sind (s.
Muskelatrophie unter Atrophie). – Aetiolo-
g i e : In erster Linie ist Zug und Erkältung
für die F.-lähmung rückhaltlos anzuer-
kennen. Es ist ganz unzweifelhaft dass
mitunter einige Stunden nach einem Gange
in ein kaltes, zugiges Local, nach einer
Eisenbahnfahrt bei heftigem Luftzug u. dgl.
eine „rheumatische” Gesichtslähmung auf-
tritt. Die ihr zu Grunde liegende anato-
mische Veränderung wurde bis jetzt in einer
entzündlichen Affektion der Nervenscheide,
einer Perineuritis, gesucht. Die häufigste
Lokalisation der Erkrankung scheint die
gegend des Austritts aus dem Foramen sty-
lomastoideum zu sein, doch deuten die Sym-
ptome (Chordaffektion) nicht selten dar auf
hin, dass sich der Prozess in den Falo-
pischen Kanal hinein erstreckt. Minkowski
fand nun bei einem Seilermeister, welcher
an einer schweren rheumatische Lähmung
gelitten hatte, post mortem eine von der Peri-
phere centralwärts fortschreitende: non-
degenerative Neuritis d. h. dass Peri-
und Epineurium bot vollkommen normale Ver-
hältnisse dar. Das ist unseres Wissens der
erste und einzige pathologisch anatomische
Befund bei der sogenannten rheumatischen
F.-Lähmung, dem Rechnung zu tragen
wäre. Die Strecke des Nerven ausserhalb des
Felsenbeins erkrankt ferner häufiginfolge von
direkten Traumen, von Geschwulst-
und
Abscessbildung in der Parotidengegend,
durch Druck vergrösserter Lymph-
drüsen u. dgl. Die Anlegung der Zunge
verschiedenerlei Nebenorganen mitunter ve-
gleichslähmung, die aber meist eine gün-
stige Prognose bietet. Es ist selbstverständ-
lich, dass durch Läsion der peripherischen
Äste (bei Traumen, chirurgischen Opera-
tionen) partielle Gesichtslähmungen ent-
stehen können. Endlich findet sich direkt
neuritischer Erkrankung des Nerven bei der
in der Regel infektiösen Polyneuritis (s. d.).
– Das im Felsenbein gelegene Stück des
Gesichtsnerven kann von allen diesen Kno-
chen betreffenden Erkrankungen (Fraktu-
S.
Blutung, Caries, syphilitische Periostitis)
in Mitleidenschaft gezogen werden, leidet
aber am häufigsten den Erkrankungen des
inneren Ohres; der Otitis interna suppura-
tiva; ob auch bei einfachen Paukenhöhlen-
katarrhen, ist zweifelhaft. An der Schädel-
basis ist der Gesichtsnerv allen jenen schäd-
lichen Einwirkungen ausgesetzt, welche
überhaupt basale Hirnnervenlähmungen er-
zeugen, als: Syphilis, chronische Menin-
gitis und einige Meningitis Basisfraktur,
Kompression durch einen oft entfernt ge-
legenen Tumor, durch ein Aneurysma. Die
Nuklearenerkrankung des Nervus f. (unter
doppelseitig) wird beobachtet bei der chro-
nischen Bulbärparalyse, Blutungen und Tu-
moren der Oblongata. Eine Unterbrechung
der motorischen Bahn in der Ponsregion
kann neben gekreuzter Extremitätenlähmung
eine ungekreuzte Gesichtslähmung erzeugen
(Hemiplegie alternata von G u b l e r). Bei der
Tabes ist F.-lähmung verhältnismässig sel-
ten. Auch im Gefolge der Diphtherie und
Influenza ist ein- und doppelseitige F.-läh-
mung beobachtet worden. Neuerdings ist
behauptet worden, dass die angeborene neu-
ropathische Disposition in der Aetiologie
der peripherischen F.-lähmung eine grosse
Rolle spielt. Nach einer Statistik von H ü b s c h-
mann kamen von 138 Fällen peripherischer
F.-lähmung 98 auf Erkältung, 42 auf Ohr-
affektionen, 8 auf Trauma, 4 auf Lues. Er
hält diese Lähmung für eine Infektionskrank-
heit sui generis, welche den Menschen in
der Regel nur einmal befällt. Die Zahl der
Recidive beträgt im übrigen nach unserer
Schätzung etwa 5–6 %. Männer scheinen
von der peripherischen F.-lähmung etwas
häufiger befallen zu werden als Frauen.
Das Alter von 20–50 Jahren stellt die
hauptsächlichste Krankheitszeit. Bezüglich
der Jahreszeiten lässt sich ein Vorwiegen in
der Zahl der Erkrankungen nicht feststellen.Prognose. Ist die Lähmung eine so-
genannte rheumatische, so besitzen wir in
der elektrischen Untersuchung einen
vorzüglichen Anhalt, die Prognose und
Heilungsdauer der Gesichtslähmung zu be-
urteilen (s. Elektrodiagnostik I, b). Je nach
dem Ergebnis der elektrischen Prüfung
unterscheidet man leichte, schwere und
Mittelformen der F.-lähmung. (Die Elektro-
diagnostik gewinnt bei der Gesichtsläh-
mung darum so sehr an Bedeutung, weil
der Nervenstamm, die Aeste desselben und
die einzelnen Muskeln mit grösster Leichtig-
keit der elektrischen Untersuchung zugäng-
lich sind.) Als l e i c h t e Form der Ge-
sichtslähmung fasst man jene Fälle auf, in
denen die elektrische Erregbarkeit des Ner-
ven und der von ihm versorgten Muskeln
keine Veränderung zeigt. Dieselben heilen
ausnahmslos (wenn peripherischer Natur) au
nach 2–3 Wochen. Die s c h w e r e n Formen
der Gesichtslähmung sind im Gegenteil aus-
gezeichnet durch jene Veränderungen der
elektrischen Erregbarkeit, welche man als des
Entartungsreaktion zusammenfasst.
Da diese Veränderungen und deren gesetz-
mässiger Ablauf vorwiegend durch das Stu-
dium der Gesichtslähmung erkannt worden
sind, mögen sie hier eine kurze Erwähnung
finden. Bei der Entartungsreaktion ist der
Effekt einer Reizung vom Nerven aus und
der einer direkten Muskelreizung streng zu
sondern. Der Nerv zeigt schon wenige Tage
an, nach Beginn der Lähmung, eine deutliche
Abnahme seiner Erregbarkeit für galvanische
und für faradische Ströme. Schliesslich (nach
10–14 Tagen) ist der Nerv völlig unerreg-
bar geworden; die stärksten Ströme bleiben,
wenn auf den Nerven appliziert, für den
Muskel wirkungslos. Anders verhält sich der
Muskel. Parallel mit der Abnahme der Er-
regbarkeit vom Nerven aus nimmt seine Er-
regbarkeit für direkte faradische Reizung
ab und verschwindet endlich völlig. Die
direkte galvanische Erregbarkeit nimmt aber
nur in der ersten Woche ab; in der zweiten
Woche wird der Muskel für direkte galva-
nische Reizung erregbarer als er normal,
reagiert aber nicht mit raschen, sondern
mit trägen Zuckungen auf dieselbe. Minder
konstant und wichtig erscheint es, dass der
Muskel dann auch durch die Anode ebenso
oder stärker erregbar ist als durch die nor-
malerweise stärker reizende Kathode des
elektrischen Stroms. Das Auftreten der
Entartungsreaktion also ergibt eine ungün-
stigere Prognose selbst für die rheumatische
Gesichtslähmung. Die Herstellung erfolgt
erst nach 4–6 Monaten, kann auch eine
unvollständige sein oder ganz ausbleiben.
Als M i t t e l f o r m werden jene Fälle be-
zeichnet, in denen zwar die Muskeln Ent-
artungsreaktion zeigen – Verlust der fara-
dischen, Steigerung der galvanischen Erreg-
barkeit, Veränderung der Zuckungsdauer –
aber die Erregbarkeit des Nerven nicht er-
lischt. Diese Mittelformen geben zumeist
bei elektrischer Behandlung eine günstige
Prognose und heilen in 4–8 Wochen.
Nach schweren Gesichtslähmungen stellen
sich häufig Kontrakturen in den gelähmt
gewesenen Muskeln ein, welche beim ersten
Anblick die Annahme einer bestehenden Ge-
sichtslähmung auf der anderen, gesunden
Seite nahelegen können. Die Prüfung auf
mimische Beweglichkeit, die elektrische
Untersuchung, sowie die Untersuchung des
Widerstandes, den die in Kontraktur befind-
lichen Muskeln leisten, wird vor dieser Ver-
wechselung schützen. Ueberdies sind die in
Kontraktur befindlichen Gesichtsmuskeln
häufig von Zuckungen befallen. Der Ver-
änderung der elektrischen Erregbarkeit pa-
rallel geht eine Atrophie der gelähmten Mus-
keln, welche in schwereren Fällen und bei
längerem Bestande der Erkrankung direkt
augenfällig ist. – In der Therapie der
rheumatischen F.-lähmung gebührt der Elek-
trizität der erste Rang. Dieselbe fördert
unzweifelhaft die Regeneration im Bereich
des erkrankten Nerven; man kann oft sehen,
S.
dass unmittelbar nach jeder Sitzung eine
Besserung der Motilität eintritt. Ob der
faradische oder galvanische Strom Besseres
leistet, lässt sich derzeit nicht entscheiden,
man wird im allgemeinen jene Stromart an-
wenden, auf welche die Muskeln noch mit
Kontraktion reagieren; ferner ist es ratsam,
der elektrischen Durchströmung eine mecha-
nische Behandlung der Muskeln (Massage)
nachfolgen zu lassen. Auch die mimische
Durchformung wird durch Massage günstig be-
einflusst. Selbst veraltete Formen von Ge-
sichtslähmung ergeben noch Erfolg bei elek-
trischer Behandlung. Bei sekundären Kon-
trakturen hat man Massage und galvanische
Durchströmung anzuwenden, den faradischen
Strom zu vermeiden. Bei frischer rheuma-
tischer Lähmung wird man lokale Blutent-
ziehungen und Diaphorese versuchen (warme
Bäder, Fomentierungen, Pilokarpininjek-
tionen). – Die Therapie der anders verur-
sachten Formen von Gesichtslähmung wird
sich selbstverständlich nach der im einzelnen
Falle ermittelten Ursache zu richten haben.IV. Vena facialis. a) Die Vena f. a n t e-
r i o r bildet mit der Vena f. p o s t e r i o r (s.
unter c) die Vena f. c o m m u n i s (s. b). Der
Art. maxillaris interna entsprechend beginnt
die anterior an der Seite der Nasenwurzel
als Vena angularis und steigt zum Angulus
maxillae herab. Sie nimmt die von den
Lidern, der Nase, den Lippen, der Wange,
dem Kinn und dem Gaumen herkommenden
Venen auf, desgleichen auch die Vena ranina.– b) Die Vena f. c o m m u n i s entsteht, wie
oben angegeben, und läuft als kurzer Stamm
vom Angulus maxillae schräg durch das
Trigonum cervicale superius zur Vena jugu-
laris interna und nimmt dabei die Vena
thyreoidea superior, die Venae pharyngeae
und die Lingualis auf. – c) Die Vena f.
p o s t e r i o r bildet mit der anterior (s. a)
die communis (s. b), entsteht an der Wurzel
des Processus zygomaticus, aus der Tempo-
ralis superficialis und Media, zieht durch
die Parotis zum Angulus maxillae hinab,
teilt sich dort in zwei Aeste, deren einer
in die Jugularis externa, der andere in die
anterior (s. a) übergeht. Die Vene führt
das Blut aus der Schläfengegend, aus der
Gegend vor dem Ohr, aus der Parotis und
aus den Teilen des Gesichts ab, aus denen
die anterior nicht das Blut ableitet.
662
–667