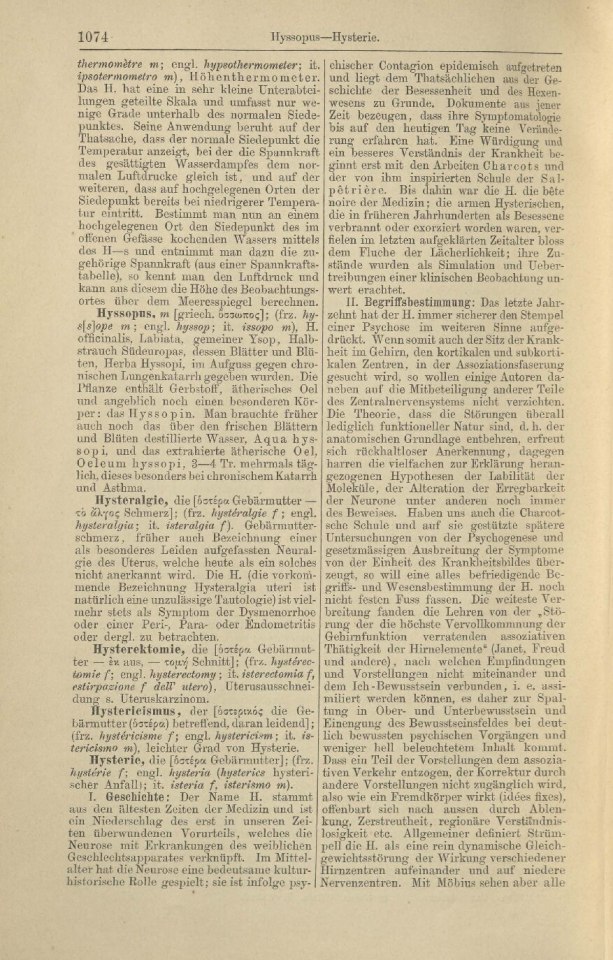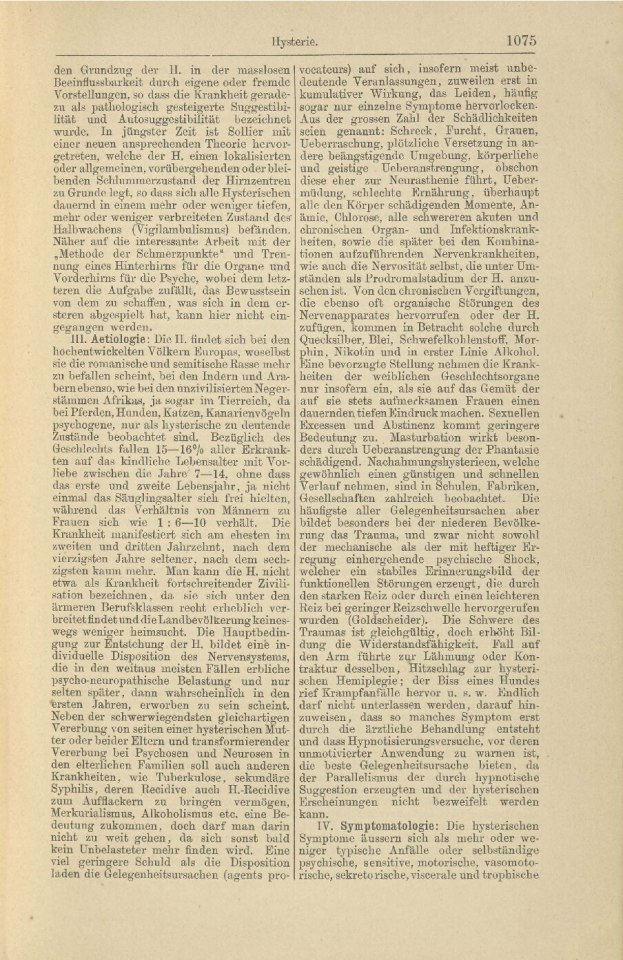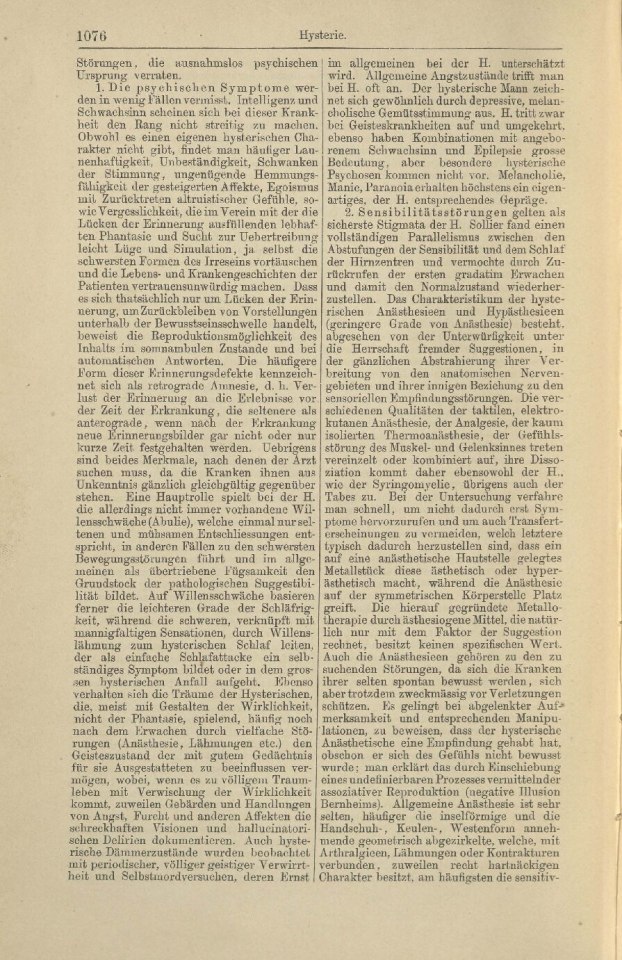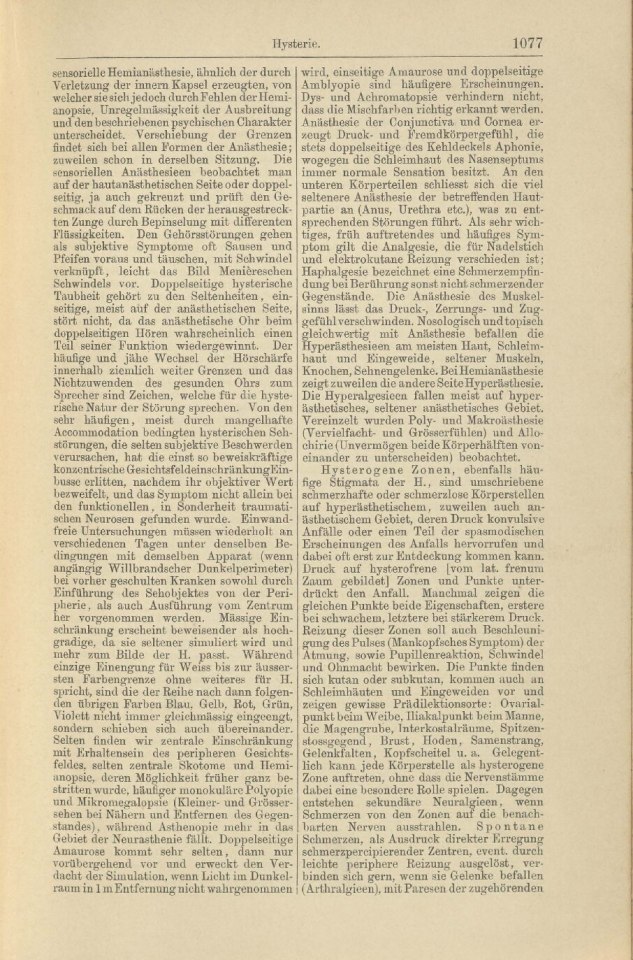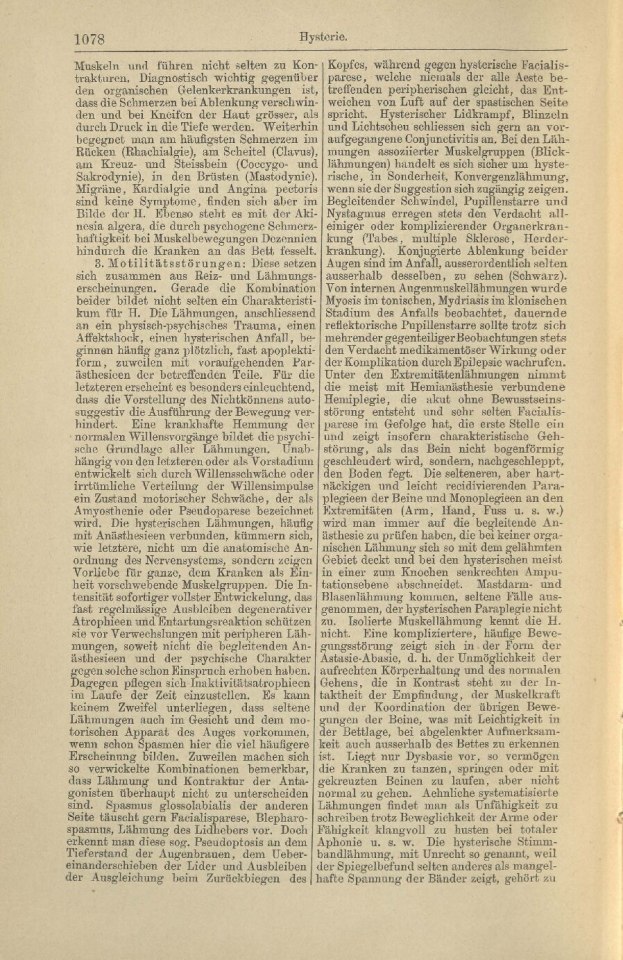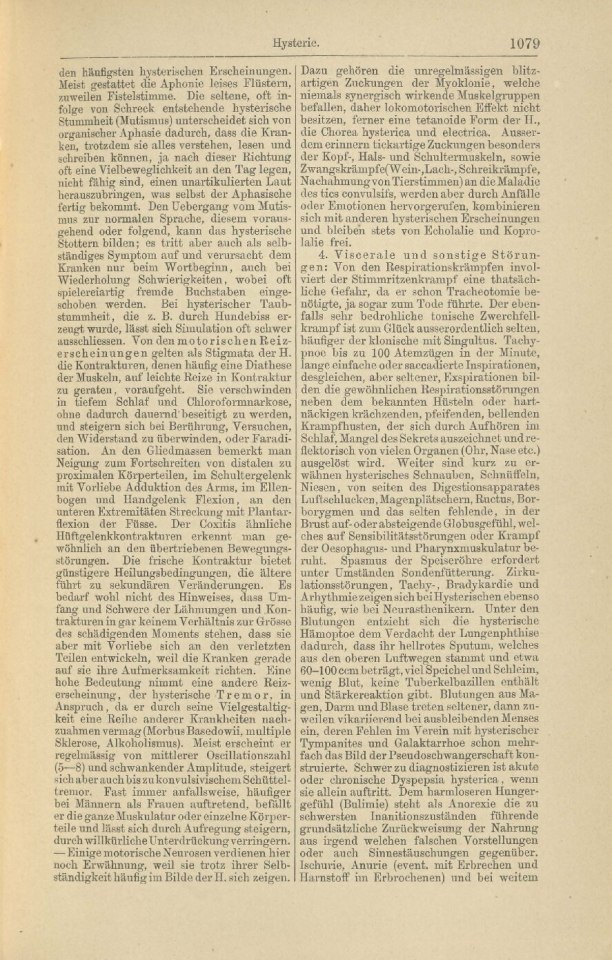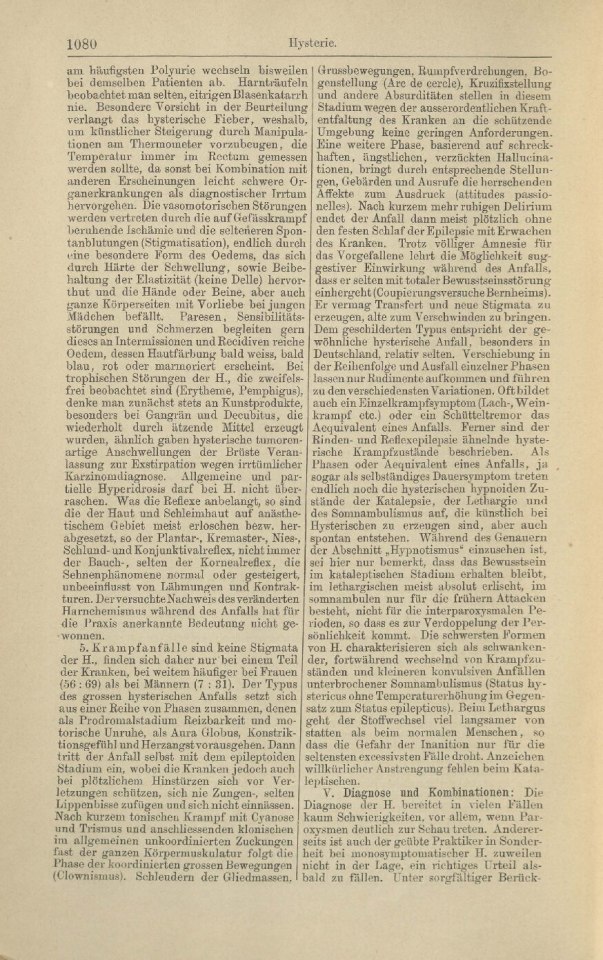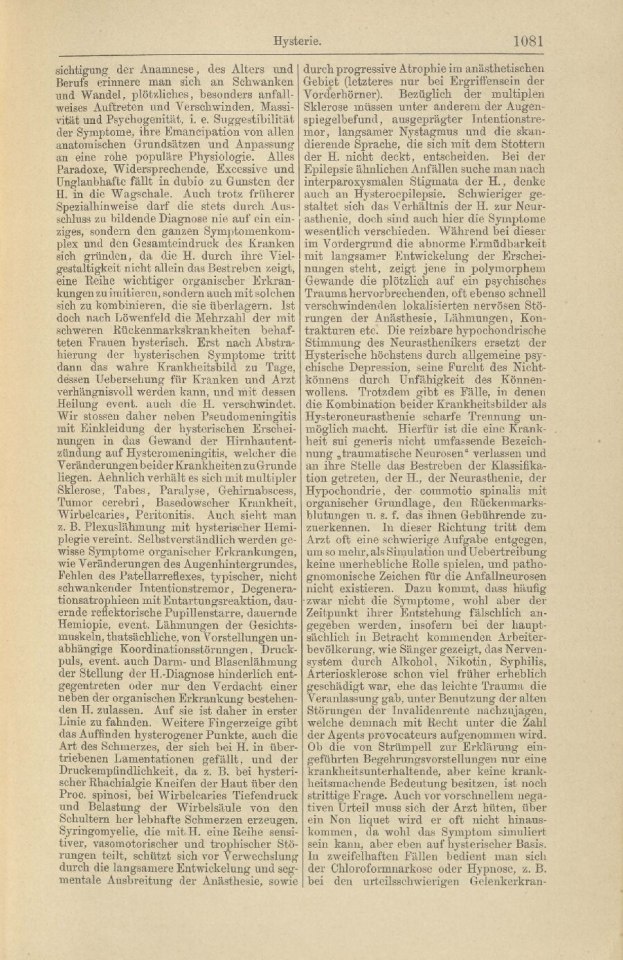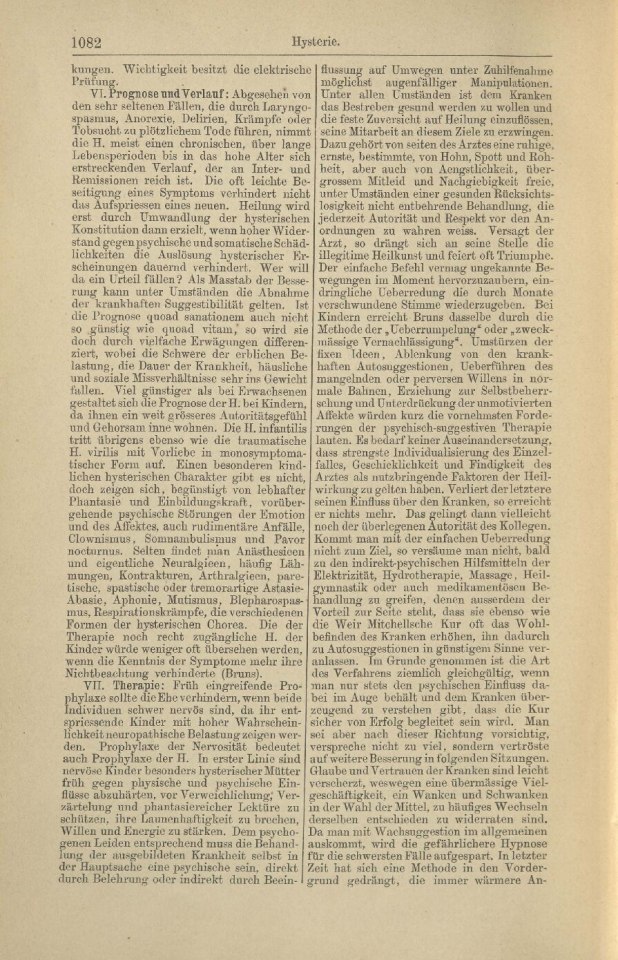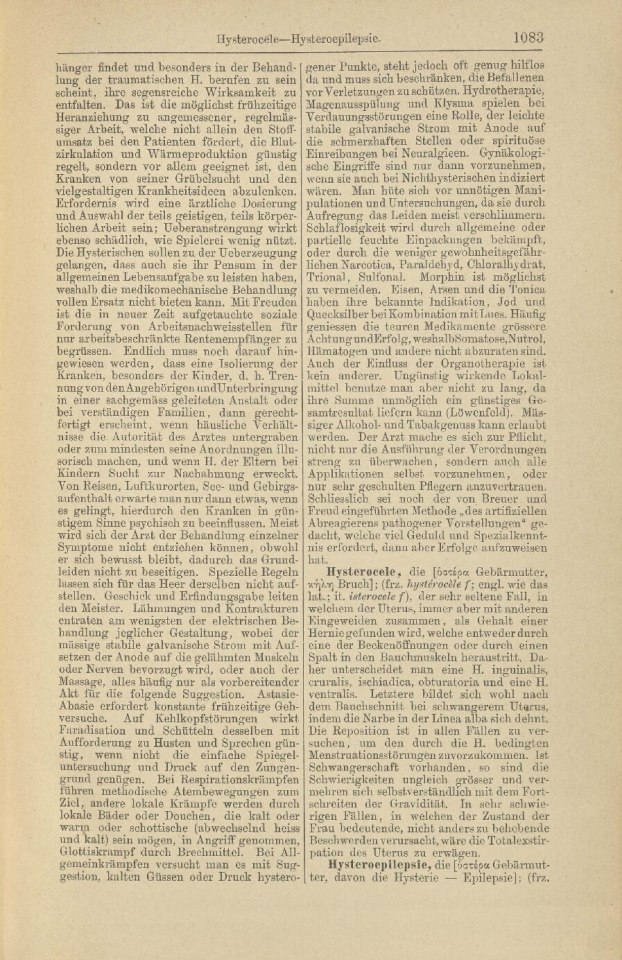S.
1074/1
Hysterie, die [ὑστέρα, Gebärmutter]; (frz.
hystérie f; engl. hysteria; (hysterics hysteri-
scher Anfall); isteria f, isterismo m).
μέτρα (metra) oder ὑστέρα (hystera)I. Geschichte: Der Name H. stammt
aus den ältesten Zeiten der Medizin und ist
ein Niederschlag des erst in unseren Zei-
tenüberwundenen Vorurteils, welches die
Neurose mit Erkrankungen des weiblichen
Geschlechtsapparates verknüpft. Im Mittel-
alter hat die Neurose eine bedeutsame kultur-
historische Rolle gespielt; sie ist infolge psy-1074/2
chischer Contagion epidemisch aufgetreten
und liegt dem Thatsächlichen aus der Ge-
schichte der Besessenheit und des Hexen-
wesens zu Grunde. Dokumente aus jener
Zeit bezeugen, dass ihre Symptomatologie
bis auf den heutigen Tag keine Verände-
rung erfahren hat. Eine Würdigung und
ein besseres Verständnis der Krankheit be-
ginnt erst mit den Arbeiten Charcots und
der von ihm inspirierten Schule der Sal-
pětrière. Bis dahin war die H. die běte
noire der Medizin; die armen Hysterischen,
die in früheren Jahrhunderten als Besessene
verbrannt oder exorziert worden waren, ver-
fielen im letzten, aufgeklärten Zeitalter bloss
dem Fluche der Lächerlichkeit; ihre Zu-
stände wurden als Simulation und Ueber-
treibungen einer klinischen Beobachtung un
wert erachtet.II. Begriffsbestimmung: Das letzte Jahr-
zehnt hat der H. immer sicherer den Stempel
einer Psychose im weiteren Sinne aufge-
drückt. Wenn somit auch der Sitz der Krank-
heit im Gehirn, den kortikalen und subkorti-
kalen Zentren, in der Assoziationsfaserung
gesucht wird, so wollen einige Autoren da-
neben auf die Mitbeteiligen anderer Teile
des Zentralnervensystems nicht verzichten.
die Theorie, dass die Störungen überall
lediglich funktioneller Natur sind, d. h. der
anatomischen Grundlage entbehren, erfreut
sich rückhaltloser Anerkennung, dagegen
harren die vielfachen zur Erklärung heran-
gezogenen Hypothesen der Labilität der
Moleküle, der Alteration der Erregbarkeit
der Neurone unter anderen noch immer
das Beweises. Haben uns auch die Charcot-
scheint Schule und auf sie gestützte spätere
Untersuchungen von der Psychogenese und
gesetzmäßigen Ausbreitung der Symptome
von der Einheit des Krankheitsbildes über-
zeugt, so will eine alles befriedigende Be-
Griffs- und Wesensbestimmung der H. noch
nicht festen Fuss fassen. Die weiteste Version-
Bereitung fanden die Lehren von der „Stö-
rung der die höchste Vervollkommnung der
Gehirnfunktion verratenden assoziativen
Thätigkeit der Hirnelemente" (Janet, Freud
und andere), nach welchen Empfindungen
und Vorstellungen nicht miteinander und
dem Ich-Bewusstsein verbunden, i.e. assi
miliert werden können, es daher zur Spal-
tung in Ober- und Unterbewusstsein und
Einengung des Bewusstseinsfeldes bei deut-
lich bewussten psychischen Vorgängen und
weniger hell beleuchtetem Inhalt kommt.
Dass ein Teil der Vorstellungen dem assozia-
tiven Verkehr entzogen, der Korrektur durch
andere Vorstellungen nicht zugänglich wird,
also wie ein Fremdkörper wirkt ( idées fixes),
offenbart sich sich nach aussen durch Allen-
kung, Zerstreutheit, regionäre Verständnis-
losigkeit etc. Allgemeiner definiert Strom-
pell die Ha. als eine rein dynamische Gleich-
Gewichtsstörung der Wirkung verschiedener
Hirnzentren aufeinander und auf niedere
Nervenzentren. Mit Möbius sehen aber alleS.
den Grundzug der H. in der masslosen
Beeinflussbarkeit durch eigene und fremde
Vorstellungen, so dass die Krankheit gerade-
zu als pathologisch gesteigerte Suggestibi-
lität und Autosuggestibilität bezeichnet
wurde. In jüngster Zeit ist Sollier mit
einer neuen ansprechenden Theorie hervor-
getreten, welche der H. einen kortikalen
oder allgemeinen, vorübergehenden oder bei-
den
dauernden Hemmzustand der Hirnzentren
zu Grunde legt, so dass alle hysterischen
Symptome
in einem mehr oder weniger tiefen,
mehr oder weniger verbreiteten Zustand des
Halb
wachse
ns
(**Vigilambulismus**)
befinden.
Näher auf die interessante Arbeit mit der
„Methode der Schmerzpunkte“ und Tren-
nung eines Hinterhirns für die Organe und
Vorderhirns für die Psyche, wobei dem letz-
teren die Aufgabe zufällt, das Bewusstsein
von dem zu schaffen, was sich in dem er-
steren abgespielt hat, kann hier nicht ein-
gegangen werden.
III. Ätiologie: Die H. findet sich bei den
hoch
entwickelten Völkern Europas, woselbst
sie die romanische und semitische Rasse mehr
zu befallen scheint, bei den Indern und Ara-
bern, ebenso wie bei den zivilisierten Neger-
stämmen Afrikas, ja sogar im Tierreich, da
bei Pferden, Hunden, Katzen, Kanarien
vögeln
Psycho
sen
nur auf hysterische Zustände
übertragene beobachtet sind. Bezüglich des
Geschlechts fallen 15–16 % aller Erkran-
kten auf das männliche Lebewesen, nur vor-
liebe zwischen die Jahre 7–14, ohne dass
das erste und zweite Lebensjahr, ja nicht
einmal das Säuglingsalter sich frei hielten,
während das Verhältnis von Männern zu
Frauen sich wie 1:6–10 verhält. Die
Krankheit manifestiert sich am ehesten im
zweiten und dritten Jahrzehnt, nach dem
vierzigsten Jahre seltener, nach dem sech-
zigsten kaum mehr. Man kann die H. nicht
stowrig als Krankheit **obschreitender Zivili**-
sation bezeichnen, da sie sich unter den
ärmeren Bevölkerungsschichten rechts erheblich ver-
breitet findet und die Landbevölkerung keines-
wegs weniger heimsucht. Die Hauptbedin-
gung zur Entstehung der H. bildet eine in-
dividuelle Disposition des Nervensystems,
die in den weitaus meisten Fällen erbliche
psycho-neuropathische Belastung und nur
selten später, dann wahrscheinlich in den
ersten Jahren, erworben zu sein scheint.
Neben der schwerwiegendsten gleichartigen
Vererbung von Seiten einer hysterischen Mut-
ter oder beider Eltern und transformierender
Vererbung bei Psychosen und Neurosen in
den elterlichen Familien soll auch anderen
Krankheiten wie Tuberkulose, sekundäre
Syphilis, deren Recidive auch H.-Recidive
zum Aufflackern zu bringen vermögen,
Merkurialismus, Alkoholismus etc. eine Be-
deutung zukommen, doch darf man darin
nicht zu weit gehen, da sich sonst mild
**kaum Übelbefind**en
mehr fin
den
will. Eine
viel geringere Schuld als die Disposition
laden die Gelegenheitsursachen (agents pro-
vocateurs) auf sich, insofern meist unbe-
deutende Vernässungen, zuweilen erst in
kumulativer Wirkung, das Leiden, häufig
sogar nur einzelne Symptome hervorlocken.
Aus der grossen Zahl der Schädlichkeiten
seien genannt: Schock, Furcht, Grauen,
Ueberraschung, plötzliche Versetzung in an-
dere, belästigende Umgebung, körperliche
und geistige Ueberanstrengung, obschon
diese eher zur Neurasthenie führt, Ueber-
müdung, schlechte Ernährung, überhaupt
alle dem Körper schädigenden Momente, An-
ämie, Chlorose, alle schwereren akuten und
chronischen Organ- und Infektionskrank-
heiten, sowie die später bei den Kombina-
tionen aufzuführenden Nervenkrankheiten,
welche die Nervosität selbst die unter Um-
ständen als Prodromalstadium der H. anzu-
sehen ist. Von den chemischen Vergiftungen,
die ebenso oft organische Störungen des
Nervenapparates hervorrufen oder der H.
zufügen, kommen in Betracht solche, durch
Quecksilber, Blei, Schwefelkohlenstoff, Mor-
phin, Nikotin und in erster Linie Alkohol.
Eine bevorzugte Stellung nehmen die Krank-
heiten der weiblichen Geschlechtsorgane
nur insofern ein, als sie auf das Gemüt der
auf sie stets aufmerksamen Frauen einen
dauernden tiefen Eindruck machen. Sexuellen
Exzessen und Abstinenz kommt geringere
Bedeutung zu. Masturbation wirkt beson-
ders durch Ueberanstrengung der Phantasie
schädigend. Nach dem Hysterica, welche
gewöhnlich einen günstigen und schnellen
Verlauf nehmen, sind in Schulen, Fabriken,
Gesellschaften zahlreich beobachtet. Die
häufigste aller Gelegenheitsursachen aber
bildet besonders bei der niederen Bevölke-
rung das **Trauma**, und zwar nicht sowohl
der mechanische als der mit heftiger Er-
regung einhergehende psychische Schock,
welche ein stabiles Erinnerungsbild der
funktionellen Störungen erzeugt, die durch
den starken Reiz oder durch einen leichteren
Reiz bei geringen Reizschwelle hervorgerufen
wurden (Goldscheider). Die Schwere des
Traumas ist gleichgültig, doch erhöht Bil-
dung die Widerstandsfähigkeit. Fall auf
den Arm führende Zurückziehung oder Kon-
traktur desselben, Hitzschlag zur hysteri-
schen Hemiplegie; der Biss eines Hundes
rief Krampfanfälle hervor u. s. w. Schliesslich
darf nicht unterlassen werden, darauf hin-
zuweisen, dass so manches Symptom erst
durch die ärztliche Behandlung entsteht
und dass Hypnotisierungsversuche, vor deren
unmotivierter Anwendung zu warnen ist,
die beste Gelegenheitsursache bieten, da
der **Parallelismus** der durch hypnotische
Suggestion erzeugten und der hysterischen
Erscheinungen nicht bezweifelt werden
kann.
IV. Symptomatologie:
Die hysterischen
Symptome äussern sich als mehr oder we-
niger typische Anfälle oder selbstständige
psychische, sensitive, motorische, vasomotorische,
sekretorische, viscerale und trophische
S.
Störungen, die ausnahmslos psychischen
Ursprungs verraten.
1. Die psychischen Symptome wer-
den in den wenigen Fällen vermisst, Intelligenz und
Schwachsinn scheinen sich bei dieser Krank-
heit den Rang nicht streitig zu machen.
Obwohl es einen eigenen hysterischen Cha-
rakter gibt, findet man häufiger Lau-
nenhaftigkeit, Unbeständigkeit, Schwanken
der Stimmung, ungenügende Hemmungs-
fähigkeit der gesteuerten Affekte, Egoismus
mit Zurücktreten altruistischer Gefühle, so-
wie Vergesslichkeit, die im Verein mit der die
Lücken der Erinnerung ausfüllenden lebhaf-
ten Phantasie und Sucht zum Uebertreibung
leicht Lüge und Simulation, ja selbst die
schwersten Formen des Irreseins vortäuschen
und die Lebens- und Krankengeschichten der
Patienten vertrauensunwürdig machen. Dass
es sich thatsächlich nur um Lücken der Erin-
nerung, um Zurückbleiben von Vorstellungen
unterhalb der Bewusstseinsschwelle handelt,
beweist die Reproduktionsmöglichkeit des
Inhalts im sogenannten Zustande und bei
automatischen Antworten. Die häufigere
Form dieser Erinnerungsdefekte kennzeich-
net sich als retrograde Amnesie, d. h. Ver-
lust der Erinnerung an die Erlebnisse vor
der Zeit der Erkrankung, die seltenere als
anterograde, wenn nach der Erkrankung
neue Erinnerungsbilder gar nicht oder nur
kurze Zeit festgehalten werden. Uebrigens
sind beides Merkmale, nach denen der Arzt
suchen muss, da sie den Kranken ihnen an
Unkenntnis gänzlich gleichgültig gegenüber
stehen. Eine Hauptrolle spielt bei der H.
die allerdings nicht immer vorhandene Wil-
lensschwäche (Abulie), welche einmal nur sel-
tenen und mühsamen Entschliessungen ent-
spricht, in anderen Fällen zu den schwersten
Bewegungsstörungen führt, und im allge-
meinen als übertriebene Fügsamkeit den
Grundstock der pathologischen Suggestibi-
lität bildet. Auf Willensschwäche basieren
ferner die leichteren Grade der Schläfrigkeit,
während die schweren, verknüpft mit
mannigfaltigen Sensationen, durch Willens-
lähmung zum hysterischen Schlaf leiten,
der als einfache Schlafatacke ein selb-
ständiges Symptom bildet oder in dem gros-
sen hysterischen Anfall aufgeht. Hiermit
verhalten sich die Träume der Hysterischen,
die, meist mit Gestalten der Wirklichkeit,
nicht der Phantasie spielend, häufig noch
nach dem Erwachen durch vielfache Stö-
rungen (Anästhesie, Lähmungen etc.) den
Geisteszustand der mit guten Gedächtnis
für sie Ausgestatteten zu beeinflussen ver-
mögen, wobei, wenn es zu völligem Trau-
leiben mit Verwirrung der Wirklichkeit
kommt, zuweilen Gebärden und Handlungen
von Angst, Furcht und anderen Affekten die
schreckhaften Visionen und halluzinatori-
schen Delirien dokumentalisieren. Auch hyste-
rische Dämmerzustände wurden beobachtet
mit periodischer, völliger geistiger Verwirrt-
heit und Selbstmordversuchen, deren Ernst
im allgemeinen bei der H. unterschätzt
wird. Allgemeine Angstzustände trifft man
bei H. oft an. Der hysterische Mann zeich-
net sich gewöhnlich durch depressive, melan-
cholische Gemütsstimmung aus, H. tritt zwar
bei Geisteskrankheiten auf und umgekehrt,
ebenso haben Kombinationen mit angebo-
renem Schwachsinn und Epilepsie grosse
Bedeutung, aber besondere hysterische
Psychosen kommen nicht vor, Melancholie,
Manie, Paranoia erscheinen höchstens ein eigen-
artiges, der H. entsprechendes Gepräge.
2. Sensibilitätsstörungen gelten als
sicherste Stigmata der H., Sollier fand einen
vollständigen Parallelismus zwischen den
Abstufungen der Sensibilität und dem Schlaf
der Hirnzentren und vermochte durch Zu-
rückrufen der ersten Gradation (Erwachen)
und damit den Normalzustand wiederher-
zustellen. Das Charakteristikum der hyste-
rischen Anästhesieen und Hypästhesieen
(geringere Grade von Anästhesie) besteht
abgesehen von der Unterwürfigkeit unter
die Herrschaft fremder Suggestion, in
der gänzlichen Abstrahierbarkeit ihrer Ver-
breitung von den anatomischen Nerven-
gebieten und ihrer innigen Beziehung zu den
sensorischen Empfindungsstörungen. Die ver-
schiedenen Qualitäten der taktilen, elektro-
kutanen Anästhesie, der Analgesie, des kaum
isolierten Thermoanästhesie, der Gefühls-
störung des Muskel- und Gelenksinnes treten
vereinzelt oder kombiniert auf, ihre Disso-
ziabilität kommt daher ebensowohl der H.,
wie der Syringomyelie, übrigens auch der
Tubes zu. Bei der Untersuchung verfahre
man schnell, um nicht dadurch erst Sym-
ptome hervorzurufen, und um auch Transfer-
erscheinungen zu vermeiden, welch letztere
typisch dadurch herzustellen sind, dass sich
auf eine anästhetische Hautstelle Gelegtes
Metallstück diese ästhetisch oder hyp-
erästhetisch macht, während die Anästhesie
auf der symmetrischen Körperstelle Platz
greift. Die hierauf gegründete Metallo-
therapie durch ästhesiogene Mittel, die natür-
lich nur mit dem Faktor der Suggestion
rechnet, besitzt keinen spezifischen Wert.
Auch die Anästhesieen gehören zu den zu
suchenden Störungen, da sich die Kranken
ihrer selten spontan bewusst werden, sich
aber trotzdem zweckmässig der Verletzungen
schützen. Es gelingt bei abgelenkter Auf-
merksamkeit und entsprechenden Manipu-
lationen zu beweisen, dass der hysterische
Anästhetische eine Empfindung gehabt hat,
obschon er sich dieser Gefühl nicht bewusst
wurde, man erklärt das durch hinzunehm-
endes undefinierbares Prozesses vermittelnder
assoziativer Reproduktion (negative Illusion
Deschamp). Allgemeine Anästhesie ist sehr
selten, häufiger die inselörmige und die
Handschuh- Keulen- u.
W. Gestaltenformen anneh-
mende, genetisch abgestreifte, welche mit
Athralgieen, Lähmungen der Kontrakturen
verbunden zuweilen recht hartnäckigen
Charakter besitzt, am häufigsten die sensitiv-
S.
sensorielle Hemiänästhesie, ähnlich der durch
Verletzung der innern Kapsel erzeugten, von
welcher sie sich jedoch durch Fehlen der Hemi-
anopsie, Unabhängigkeit der Ausbreitung
und des beschriebenen psychischen Charakters
unterscheidet. Verschiebung der Grenzen
findet sich bei allen Formen der Anästhesie;
zuweilen schon in derselben Sitzung. Die
sensoriellen Anästhesieen beobachtet man
auf der Hautanästhetischen Seite oder doppel-
seitig, ja auch gekreuzt und prägt sich im Ge-
schmack, auf dem Rücken der herausgestreckten
Zunge durch Bepinselung mit differenten
Flüssigkeiten. Den Gehörstörungen gehen
als subjective Symptome oft Sausen und
Pfeifen voraus und täuschen, mit Schwindel
verknüpft, leicht das Bild Menièrescher
Schwindels vor. Doppelseitige hysterische
Taubheit gehört zu den Seltenheiten; eine
seitige, meist auf der anästhetischen Seite,
stört nicht, da eine anästhetische Ohr kein
doppelseitiges Hören wahrnimmt, einen
Teil seiner Funktion wiedergewinnt. Der
häufige und jähe Wechsel der Hörschärfe
innerhalb ziemlich weiter Grenzen und das
Nichtzuwenden des gesunden Ohrs zum
Sprecher sind Zeichen, welche für die hyste-
rische Natur der Störung eintreten. Von den
sehr häufigen, meist durch mangelhafte
Accommodation bedingten hysterischen Seh-
störungen, die selten subjective Beschwerden
verursachen, hat die einzigst beweiskräftige
konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung Ein-
busse erlitten, nachdem ihr objectives Wert
bezweifelt, und das Symptom nicht allein bei
den funktionellen, in Sonderheit traumati-
schen Neurosen gefunden wurde. Einwand-
freie Untersuchungen müssen wiederholt, an
verschiedenen Tagen unter denselben Be-
dingungen mit demselben Apparat (wenn
angängig Wellenauzischem Dunkelzimmer) bei
vorher geschulten Kranken sowohl durch
Einführung des Sehobjektes von der Peri-
pherie als auch Ausführung vom Zentrum
her vorgenommen werden. Massige Ein-
schränkung erscheint beweisender als hoch-
gradige, da sie seltener simuliert wird und
mehr zum Bilde der H. passt. Während
einzige Einengung für Weiss bis zur äusser-
sten Farbengrenze ohne weiteres für H.
spricht, sind die der Reihe nach dann folgenden
der übrigen Farben Blau, Gelb, Rot, Grün,
Violett nicht immer gleichmässig eingeengt,
sondern schieben sich auch auf deviateden
Seiten, finden wir zentrale Einschränkung
mit Erhaltensein des peripheren Gesichts-
feldes, selten zentrale Skotome und Hemi-
anopsie, deren Möglichkeit früher ganz be-
stritten wurde, häufiger monokuläre Polyopie
und Mikromegalopsie (Kleiner- und Grösser-
sehen bei Näher- und Entfeinen des Gegen-
standes), während Asthenopie mehr in das
Gebiet der Neurasthenie fällt. Doppelseitige
Amaurose kommt sehr selten, da eine
vorübergehend war und erweckt den Ver-
dacht der Simulation, wenn Licht im Dunkel-
raum in 1 m Entfernung nicht wahrgenommenwird, einseitige Amaurose und doppelseitige
Amblyopie sind häufigere Erscheinungen.
Dys- und Achromatopsie verhindern nicht,
dass die Missfarben richtig erkannt werden.
Anästhesie der Conjunctiva und Cornea er-
zeugt Druck- und Fremdkörpergefühl, die
stets doppelseitig den Schnüffelreflex Aphonic,
wogegen die Schleimhaut des Nasenseptums
immer normale Sensation besitzt. An den
unteren Körperteilen schliesst sich die viel
seltenere Anästhesie der betreffenden Haut-
partie an (Anus, Urethra etc.), was zu ent-
sprechenden Störungen führt, als sehr wich-
tiges, früh auftretendes und häufiges Sym-
ptom gilt die Analgesie, die für Nadelstich
und Elektrotausch Reizung verschieden ist;
Haphalgesie bezeichnet eine Schmerzempfin-
dung bei Berührung sonst nicht schmerzerter
Gegenstände. Die Anästhesie des Muskel-
sinns lässt das Druck-, Zerrungs- und Zug-
gefühl verschwinden. Nosologisch und topisch
gleichwertig mit Anästhesie befallen die
Hyperästhesieen am meisten Haut, Schleim-
haut und Rürgeweide, seltener Muskeln,
Knochen, Sehnengelenke. Bei Hemianästhesie
zeigt zuweilen die andere Seite Hyperästhesie.
Die Hyperalgesieen fallen meist auf hyper-
ästhetische, seltener anästhetisches Gebiet.
Vereinzelt wurden Poly- und Makroästhesie
(Vervielfacht- und Grösserfühlen) und Allo-
cheirie (unvermögen beide Körperhälften von-
einander zu unterscheiden) beobachtet,
Hysterogene Zonen ebenfalls häu-
fige Stigmatas der H. und umschrieben
schmerzhafte oder schmerzlose Körperstellen
auf hyperästhetischem zuweilen auch an-
ästhetischem Gebiet, deren Druck konvulsive
Anfälle oder einen Teil der spasmotischen
Erscheinungen des Anfalls hervorrufen und
dabei oft erst zur Entdeckung kommen kann.
Druck auf hysterogene [vom lat. fremdum
Zaum gebildet] Zonen und Punkte unter-
drückt den Anfall. Manchmal zeigen die
gleichen Punkte beide Eigenschaften, erstere
bei schwächerem, letztere bei stärkerem Druck.
Reizung dieser Zonen soll auch Beschleuni-
gung des Pulses (Manikopsisches Symptom), die
Steigerung sowie Pupillenreaktion, Schwindel
und Ohnmacht bewirken. Die Punkte finden
sich genau oder subjektiv, kommen auch an
Schleimhäuten und Eingeweiden vor und
zeigen gewisse Prädilektionsorte: Ovarial-
punkt beim Weibe, Iliacalpunkt beim Mann,
die Magengegend, Interscapularregion, Spitzen-
stossgegend, Brust, Hoden, Samenstrang,
Gelenkfalten, Kopfscheitel u. a. Gelegent-
lich kann jede Körperstelle als hysterogene
Zone auftreten, ohne dass die Nervenstämme
dabei eine besondere Rolle spielen. Dagegen
entstehen sekundäre Neuralgieen, wenn
Schmerzen von den Zonen auf die benach-
barten Nerven ausstrahlen. Spontane
Schmerzen, als Ausdruck direkter Erregung
schmerzvollerer Zentralsystem, event.
leichte periphere Reizung ausgelöst, ver-
binden sich gern, wenn sie Gelenke befallen
(Arthralgieen), mit Parosen der zugehörendenS.
muskeln und führen nicht selten zu Kon-
trakturen, Diagnostisch wichtig gegenüber
den organischen Gelenkerkrankungen ist,
dass die Schmerzen bei Ablenkung verschwin-
den und bei Kneifen der Haut grösser, als
durch Druck in die Tiefe werden. Weiterhin
begegnet man am häufigsten Schmerzen im
Rücken (Rachialgie), im Scheitel (Clavus
am Kreuz- und Steissbein (Coccygo- und
Sacrodynie), in den Brüsten (Mastodynie),
Migräne, Kardialgie und Angina pectoris
sind keine Symptome, finden sich aber im
Bilde der H. Ebenso steht es mit der Aki-
nesia algera, die durch psychogene Schmerz-
haftigkeit bei Muskelbewegungen Deformität
hindurch die Kranken an den Bett fesselt.
3. Motilitätsstörungen: Diese setzen
sich zusammen aus Reiz- und Lähmungs-
erscheinungen. Gerade die Kombination
beider bildet nicht selten ein Charakteristi-
cum für die H. Die Lähmungen, anschliessend
an ein physisch-psychisches Trauma, einen
Affektschock, einen hysterischen Anfall, be-
ginnen häufig ganz plötzlich, fast apoplekti-
form, zuweilen mit voraufgehender Par-
ästhesieen der betreffenden Teile. Für die
letzteren erscheint es besonders einleuchtend,
dass die Vorstellung des Nichtkönnens auto-
suggestiv die Ausführung der Bewegung ver-
hindert. Ein krankhafte Hemmung der
normalen Willensvorgänge bildet die psychi-
sche Grundlage aller Lähmungen. Unab-
hängig von den letzteren oder als Vorstadium
entwickelt sich durch Willensschwäche oder
irrtümliche Verteilung der Willensimpulse
ein Zustand motorischer Schwäche, der als
Amyosthenie oder Pseudoparese bezeichnet
wird. Die hysterischen Lähmungen, häufig
mit Anästhesieen verbunden, kümmern sich,
wie letztere, nicht um die anatomische An-
ordnung des Nervensystems, sondern zeigen
Vorliebe für ganze, dem Kranken als Ein-
heit vorschwebende Muskelgruppen. Die In-
tensität erfolgter voller Entwicklung, die fast
stet regelmässige Ausbleiben degenerativer
Atrophieen und Entartungsreaktion schützen
sie vor Verwechslungen mit peripheren Läh-
mungen, soweit nicht die begleitenden An-
ästhesieen und der psychische Charakter
gegen solche schon Fürsprache erhoben haben.
Dagegen pflegen sich Inaktivitätsatrophieen
im Laufe der Zeit einzustellen. Es kann
keinem Zweifel unterliegen, dass seltene
Lähmungen nach im Gesicht und dem mo-
torischen Apparat des Auges vorkommen,
wenn schon Spasmen hier die viel häufigere
Erscheinung bilden. Zuweilen machen sich
so verwickelte Kombinationen bemerkbar,
dass Lähmung und Kontraktur der Anta-
gonisten überhaupt nicht zu unterscheiden
sind. Spasmus glosso-labialis, der dem
Seite täuscht gen Facialisparese, Blepharo-
spasmus, Lähmung des Lidhebers vor. Doch
erkennt man diese sog. Pseudoptosin an dem
Tiefenstand der Augenbraue, dem Ueber-
einanderchieben der Lider und Ausbleiben
der Ausgleichung beim Zurückbiegen desKopfes, während gegen hysterische Facialis-
parese, welche niemals die volle Äste be-
treffenden peripherischen gleicht, das Ent-
weichen von Luft auf der spastischen Seite
spricht. Hysterischer Lidsrampf, Blinzeln
und Lichtscheu schliessen sich gern an vor-
aufgegangene Conjunctivitis an. Bei den Läh-
mungen assoziierter Muskelgruppen (Blick-
lähmungen) handelt es sich sicher um hyste-
rische, in Sonderheit, Konvergenzlähmung,
wenn sie der Suggestion sich zugängig zeigen,
Begleitender Schwindel, Pupillenstarre und
Nystagmus erregen stets den Verdacht all-
einiger oder komplizierender Organerkran-
kung (Tabes, multiple Sklerose, Herder-
krankung). Konjugierte Ablenkung beider
Augen sind im Anfall, ausserordentlich selten
ausserhalb desselben, zu sehen (Schwarz).
Von internen Augenmuskellähmungen wurde
Myosis im tonischen, Mydriasis im klonischen
Stadium des Anfalls beobachtet, dauernde
reflektorische Pupillenstarre sollte trotz noch
stehenden gegenteiliger Beobachtungen stets
den Verdacht medikamentöser Wirkung oder
der Komplikation durch Epilepsie wachrufen.
Unter den Extremitätenlähmungen nimmt
die meist mit Hemianästhesie verbundene
Hemiplegie, die aber ohne Bewusstseins-
störung entsteht und sehr selten Faciallis-
parese im Gefolge hat, die erste Stelle ein
und zeigt insofern charakteristische Geh-
störung, als das Bein nicht bogenförmig
geschleudert wird, sondern nachgeschleppt
den Boden fegt. Die selteneren, aber hart-
näckigen und leicht recidivierenden Para-
plegien der Beine und Monoplegieen an den
Extremitäten (Arm, Hand, Fuss u. s. w.)
wird man immer auf die begleitende An-
ästhesie zu prüfen haben, die bei keiner orga-
nischen Lähmung sich so mit dem gelähmten
Gebiet deckt und bei den hysterischen meist
in einer den Knochen senkrechten Am-
putationenbene abschneidet. Mastdarm- und
Blasenlähmung kommen seltene Fälle aus-
genommen, der hysterischen Paraplegie nicht
zu, isolierte Muskellähmung kennt die H.
nicht. Eine kompliziertere, häufige Bewe-
gungsstörung zeigt sich in der Form der
Astasie-Abasie, d. h. der Unmöglichkeit der
aufrechten Körperhaltung und des normalen
Gehens, die im Kontrast steht zu der In-
taktkeit der Empfindung, der Muskelkraft
und der Koordination der übrigen Bewe-
gungen der Beine, was mit Leichtigkeit in
der Bettlage, bei abgelenkter Aufmerksamkeit
kein auch ausserhalb des Bettes zu erkennen
ist. Liegt nur Dysbasie vor, so vermögen
die Kranken zu tanzen, springen oder mit
gekreuzten Beinen zu laufen, aber nicht
normal zu gehen. Aehnliche systematisierte
Lähmungen findet man als Unfähigkeit zu
schreiben trotz Bewehrtheit der Arme oder
Fähigkeit klangvoll zu husten bei totaler
Aphonie u. s. w. Die hysterische Stimm-
bandlähmung, mit Unrecht so genannt, weil
der Spiegelbefund selten anderes als mangel-
hafte Spannung der Bänder zeigt, gehört zuS.
den häufigsten hysterischen Erscheinungen.
Meist gestattet die Aphonie leises Flüstern,
zuweilen Fistelstimme. Die seltene, oft in-
folge von Schreck entstehende hysterische
Stummheit (Mutismus) unterscheidet sich von
organischer Aphasie dadurch, dass die Kran-
ken, trotzdem sie alles verstehen, lesen und
schreiben können, ja nach dieser Richtung
oft eine Vielbeweglichkeit an den Tag legen,
nicht fähig sind, einen unartikulierten Laut
herauszubringen, was selbst der Aphasische
fertig bekommt. Den Uebergang von Mutis-
mus zur normalen Sprache, diesen voraus-
gehend oder folgend, kann das hysterische
Stottern bilden; es tritt aber auch als selb-
ständiges Symptom auf und verursacht dem
Kranken nur beim Wortbeginn, auch bei
Wiederholung Schwierigkeiten, wobei oft
spieleartiagte fremde Buchstaben einge-
schoben werden. Bei hysterischer Taub-
stummheit, die z. B. durch Hundegebiss er-
zeugt wurde, lässt sich Simulation oft schwer
ausschliessen. Von den motorischen Reiz-
erscheinungen gelten als Stigmata der H.
die Kontrakturen, denen häufig eine Diathese
der Muskeln, auf leichte Reize in Kontraktur
zu geraten, voraufgeht. Sie verschwinden
in tiefem Schlaf und Chloroformnarkose,
ohne dadurch dauernd beseitig zu werden,
und steigern sich bei Berührung, Versuch,
den Widerstand zu überwinden oder Per-
suasion. An den Gliedmassen bemerkt man
Neigung zum Fortschreiten von distalen zu
proximalen Körperteilen, im Schultergelenk
mit Vorliebe Adduktive des Arms, im Ellen-
bogen und Handgelenk Flexion, an den
unteren Extremitäten Streckung mit Planta-
flexion der Füsse. Bei Coxitis ähnliche
Hüftgelenkkontrakturen erkennt man ge-
wöhnlich an den übertriebenen Bewegungs-
schüssen. Die frischen Kontrakturen, meist
günstigere Heilungsbedingungen, die ältere
führt zu sekundären Veränderungen. Es
bedarf wohl nicht des Hinweises, dass Um-
fang und Schwere der Lähmungen und Kon-
trakturen in gar keinem Verhältnis zur Grösse
des schädigenden Moments stehen, dass sie
aber mit Vorliebe sich an den verletzten
Teilen entwickeln, weil die Kranken gerade
auf sie ihre Aufmerksamkeit richten, Eine
hohe Bedeutung nimmt eine andere Reiz-
erscheinung, der hysterische T r e m o r, in
Anspruch, da er durch seine Vielgestaltig-
keit eine Reihe anderer Krankheiten nach-
zuahmen vermag (Morbus Basedowii, multiple
Sklerose, Alkoholismus). Meist erscheint er
regelmässig, von mittlerer Oscillationszahl
(5–8) und schwankender Amplitude, steigert
sich aber auch bis zu konvulsivischem Schüttel-
tremor. Fast immer, anfallsweise, häufiger
bei Männern als Frauen auftretend, befällt
er die ganze Muskulatur oder einzelne Körper-
teile und lässt sich durch Aufregung steigern,
durch willkürliche Unterdrückung verringern.
Einige motorische Temroren verdienen hier
noch Erwähnung, weil sie trotz ihrer Selb-
ständigkeit häufig im Bilde der H. sich zeigen.Dazu gehören die unregelmässigen blitz-
artigen Zuckungen der Myoklonie, welche
niemals synergisch wirkende Muskelgruppen
befallen, daher lokomotorischen Effekt nicht
besitzen, ferner eine tanoide Form, teil-
die Chorea hysterica, und electrice. Ausser-
dem erinnern tickartige Zuckungen besonders
der Kopf-, Hals- und Schultermuskeln, sowie
Zwangskrämpfe (Wein-,Lach-, Schreikrämpfe,
Nachahmung von Tierstimmen) an die Melodie
des Tic convulsif, werden aber durch Affekte
oder Emotionen hervorgerufen, kombinieren
sich mit anderen hysterischen Erscheinungen
und bleiben stets von Echolalie und Kopro-
lalie frei.
4. Viscerale und sonstige Störun-
gen: Von den Respirationskrämpfen inno-
viert der Stimmritzenkrampf eine thödsich-
liche Gefahr, da er schon Tracheotomie be-
nötigte, ja sogar zum Tod führte. Der eben-
falls sehr bedrohliche tonische Zwerchfell-
krampf ist zum Glück ausserordentlich selten,
häufiger der klonische mit Singultus. Tachy-
pnoë bis zu 100 Athemzügen in der Minute,
lange einfache oder sacadierede Inspirationen,
desgleichen, abortiertere Expirationen bil-
den die gewöhnlichen Respirationsstörungen
neben dem bekannten Hüsteln oder hart-
näckigem krächzenden, pfeifenden, bellenden
Krupphusten, der sich durch Ausführen im
Schlaf, Mangel des Sekrets auszeichnet und re-
flektorisch von vielen Organen (Ohr, Nase etc.)
ausgelöst wird. Selten sind, kurz vor er-
wöhnen hysterisches Schnauben, Schnüffeln,
Niesen von Seiten des Digestionsapparates
Luftschlucken, Magenplätschern, Ructus, Bor-
borygmen und Erbrechen fehlen; an der
Brust auf- oder absteigende Globusgefühl, wel-
ches auf Sensibilitätsstörungen oder Krampf
der Oesophageus und Pharynxmuskulatur be-
ruht. Spasmus der Speiseröhre erfordert
unter Umständen Sondeninfürung. Zirku-
lationsstörungen, Tachy-, Bradykardie und
Arrhytmie zeigen sich bei Hysterischen ebenso
häufig, wie bei Neurasthenikern. Unter den
Blutungen entzieht sich die hysterische
Hämoptoë dem Verdacht der Lungenphthise
dadurch, dass ihr hellrotes Sputum, welches
aus den oberen Luftwegen stammt und etwa
50–100 ccm beträgt, viel Speichel und Schleim,
wenig Blut, keine Tuberkelbazillen enthält
und Stärkerereaktion gibt. Blutungen aus Ma-
gen, Darm und Blase treten selten, da man zu-
weilen vikariierend bei ausbleibenden Menses
ein deren Fehlen im Verein mit hysterischer
Tempanitie und Galaktarrhoë schon mehr
fach das Bild der Pseudschwangerschaft kon-
struiere. Schwer zu diagnostizieren ist akute
oder chronische Dysphobie hysterica, wenn
sie allein auftritt. Dem harmloseren Hunger-
gefühl (Bulimie) steht als Anorexie die zu
schwereren Irritationszuständen führende
grundsätzliche Zurückweisung der Nahrung
aus irgend welchen falschen Vorstellungen
oder nach Simuliationsträgungen gegenüber.
Echte, Anorexie (event. mit Erbrechen und
Ischurie, Anästhesieen und bei weitem
Harmstoff im Erbrochenen)S.
am häufigsten Polyurie wechseln bisweilen
bei demselben Patienten ab. Harnträufeln
beobachtet man selten, entgegen Blasenkatarrh
etc. Besondere Vorsicht in der Beurteilung
verlangt das hysterische Fieber, weshalb,
um klinischer Steigerung durch Manipula-
tionen am Thermometer vorzubeugen, die
Temperatur immer im Rectum gemessen
werden sollte, da sonst bei Kombination mit
anderen Erscheinungen leicht schwerere Or-
ganerkrankungen als diagnostischer Irrtum
hervorgehen. Die vasomotorischen Störungen
werden vertreten durch die auf Gefässkrampf
beruhende Ischämie und die selteneren Spon-
tanblutungen (Stigmatisation), endlich durch
eine besondere Form des Oedems, das sich
durch Härte der Schwellung, sowie Bei-
haltung der Elastizität (keine Delle) hervor-
thut und die Hände oder Beine, aber auch
ganze Körperpartien mit Vorliebe bei jungen
Mädchen befällt. Paresen, Sensibilitäts-
störungen und Schmerzen begleiten gern
dieses an Intensität und Recidive reiche
Oedem, dessen Hautfärbung bald weiss, bald
blau, rot oder marmoriert erscheint. Bei
trophischen Störungen der H. die zweifel-
frei beobachtet sind (Erytheme, Pemphigus),
denke man zunächst stets an Kunstprodukte,
besonders bei Gangrän und Decubitus, da
wiederholt durch ätzende Mittel erzeugt
wurden, ähnlich gaben hysterische Tumoren
artige Anschwellungen der Brüste Veran-
lassung zur Exstirpation wegen irrtümlicher
Karzinomdiagnose. Allgemeine und par-
tielle Hyperhidrosis darf bei H. nicht über-
raschen. Was die Reflexe anbelangt, so sind
die der Haut und Schleimhaut auf anästhe-
tischem Gebiet meist erloschen bezw. her-
abgesetzt, so der Pharynx-, Kränzmus-, Nie-
Schlund- und Konjunktivalreflex, nicht immer
der Bauch-, selten der Cornealreflex; die
Sehnenphänomene normal oder gesteigert,
unbeeinflusst von Lähmungen und Kontrak-
turen. Derversuchte Nachweis des verminderten
Hirnhautwiderstands während des Anfalls hat ihr
die früher anerkannte Bedeutung nicht ge-
wonnen.
5. Krampfanfälle sind keine Stigmata
der H., finden sich daher nur bei einem Teil
der Kranken, bei weitem häufiger bei Frauen
(56: 18) als bei Männern (7: 31). Der Typus
des grossen hysterischen Anfalls setzt sich
aus einer Reihe von Phasen zusammen, denen
als Prodromiumstadium Reizbarkeit und mo-
torische Unruhe, als Aura (Globus, Konstruk-
tionsgefühl und Herzangstvoraussgehen.
Tritt der Anfall selbst mit dem epileptoiden
Stadium ein, wobei die Kranken jedoch auch
bei plötzlichem Hinstürzen sich vor Ver-
letzungen schützen, sich vor Zungen-, selten
Lippenbisse zu fügen und sich nicht einnässen.
Nach kurzem tonischen Krampf mit Cyanose
und Trismus und anschliessendem klonischen
im allgemeinen unkoordinierten Zuckungen
fast der ganzen Körpermuskulatur folgt die
Phase der koordinierten grossen Bewegungen
(Clownismus). Schleudern der Gliedmassen,
Grussbewegungen, Rumpfverdrehungen, Bo-
genstellung (Arc de cercle), Kruzifixstellung
und andere Absurditäten stellen in diesem
Stadium wegen der ausserordentlichen Kraft-
entfaltung den Kranken an die schützende
Umgebung keine geringen Anforderungen.
Die 4., weitere Phase, basierend auf schreck-
haften, ängstlichen, verzückten Hallucina-
tionen, bringt durch entsprechende Stellun-
gen, Gebärden und Ausrufe die herrschenden
Affekte zum Ausdruck (attitudes passio-
nelles). Nach kurzem mehr ruhigem Delirium
endet der Anfall dann meist plötzlich ohne
den festen Schlaf der Epilepsie mit Erwachen
des Kranken. Trotz völliger Amnesie für
das Vorgefallene lehrt die Möglichkeit sug-
gestiver Einwirkung während des Anfalls,
dass er seltener totale Bewusstseinsstörung
einhergeht (Coprolage, perorale Berührung).
Er vermag Transfert und neue Stigmata zu
erzeugen, alte zum Verschwinden zu bringen.
Dem geschilderten Typus entspricht der ge-
wöhnliche hysterische Anfall, besonders in
Deutschland, relativ selten, Verschiebung in
der Reihenfolge und Ausfall einzelner Phasen
lassen nur Rudimente aufkommen und führen
zu den verschiedensten Variationen. Oft bildet
auch ein Einzelkrampfsymptom (Lach-, Wein-
krampf etc.) oder ein Schütteltremor das
Äequivalent eines Anfalls. Ferner sind der
Rinden- und Reflexepilepsie ähnelnde hyste-
rische Krampfzustände beschrieben. Ab-
phasen oder Äequivalent eines Anfalls, ja
sogar als selbständiges Dauersymptom treten
endlich noch die hysterischen Hypnoiden, Zu-
stände der Katalepsie, der Lethargie und
des Somnambulismus auf, die künstlich bei
Hysterischen zu erzeugen sind, aber auch
spontan entstehen. Während des Letzteren
der Abschnitt H y p n o t i s m u s einzusehen ist,
sei hier nur bemerkt, dass das Bewusstsein
im kataleptischen Stadium erhalten bleibt,
im lethargischen meist absolut erlöscht, im
somnambulen nur für die frühern Attaken
besteht, nicht für die Interparoxysmalen, die
wieder so gross zur Verdoppelung der Per-
sönlichkeit kommt. Die schwersten Formen
von H. charakterisieren sich als schwanken-
der, fortwährend wechselnd von Krampfzu-
ständen und kleineren konvulsiven Anfällen
unterbrochener Somnambulismus (Status hy-
stericus ohne Temperaturerhöhung im Gegen-
satz zum Status epilepticus). Beim Lethargicus
geht der Stoffwechsel viel langsamer von
Statten, als beim normalen Menschen, so
dass die Gefahr der Inanition nur für die
seltensten exzessiven Fälle droht, Anzeichen
willkürlicher Anstrengung fehlen beim Kata-
leptischen.
V. Diagnose und Kombinationen:
Die
Diagnose der H. bereitet in vielen Fällen
kaum Schwierigkeiten von allen, wenn Par-
oxysmen deutlich zur Schau tragen. Ander-
seits ist auch der geübte Praktiker in Sonder-
heit bei monosymptomatischer H. zuweilen
nicht in der Lage, ein schlüssiges Urteil als-
bald zu fällen. Unter sorgfältiger Berück-S.
sichtigung der Anamnese, des Alters und
Berufs erinnere man sich an Schwanken
und Wandel, plötzliches, besonders anfalls-
weises Auftreten und Verschwinden, Massi-
vität und Psychogenität, i. e. Suggestibilität
der Symptome, ihre Emancipation von allen
anatomischen Grundsätzen, ihre Anpassung
an eine rohe populäre Physiologie, Alles
Paradoxe, Widersprechende, Exzessive und
Ungenügende fällt in diesen zu Gunsten der
H. in die Waagschale. Auch trotz früherer
Spezialhinweise darf die stets durch Aus-
schluss zu bildende Diagnose nie auf ein ein-
ziges, sondern den ganzen Symptomenkom-
plex und den Gesamteindruck des Kranken
sich gründen, da die H. durch ihre Viel-
gestaltigkeit nicht allein das Bestreben zeigt,
eine Reihe wichtiger organischer Erkran-
kungen zu imitieren, sondern auch mit solchen
sich zu kombinieren, die sie überlagern. Da-
durch nach Löwenfeld die Mehrzahl der mit
schweren Rückenmarkskrankheiten behaf-
teten Frauen hysterisch. Erst nach Abstra-
hierung der hysterischen Symptome tritt
dann das wahre Krankheitsbild zu Tage,
dessen Uebersehung für Kranken und Arzt
verhängnisvoll werden kann, und mit dessen
Heilung event. auch die H. verschwindet.
Wir stossen daher neben Pseudomeningitis
mit Einkleidung der hysterischen Erschei-
nungen in das Gewand der Gehirnent-
zündung auf Hysteromeningitis, welcher die
Veränderungen beider Krankheiten zu Grunde
liegen. Aehnlich verhält es sich mit multipler
Sklerose, Tabes, Paralyse, Gehirnabsces,
Tumor cerebri, Basedowscher Krankheit,
Wirbelcaries, Peritonitis. Auch sieht man
z. B. Plexuslähmung mit hysterischer Hemi-
plegie vereint. Selbstverständlich werden ge-
wisse Symptome organischer Erkrankungen,
wie Veränderungen des Augenhintergrunds,
Fehlen des Patellarreflexes, typischer, nicht
schwankender Intentionstremor, Degenera-
tionsatrophieen mit Entartungsreaktion, da-
uernde reflektorische Pupillenstarre, dauernde
Hemiopie, event. Lähmungen der Gesichts-
muskeln, thatsächliche, von Vorstellungen un-
abhängige Koordinationsstörungen, Druck-
puls, event. auch Darm- und Blasenlähmung
der Stellung der H.-Diagnose hinderlich ent-
gegenstehen oder muss der Verdacht einer
neben der organischen Erkrankung bestehen-
den H. zulassen. Auf sie ist daher in erster
Linie zuzuhnden. Weitere Fingerzeige gibt
das Auffinden hysterogener Punkte, auch die
Art des Schmerzes, der sich bei H. in über-
triebenen Lamentationen gefällt und der
Druckempfindlichkeit, da z. B. bei hysteri-
scher Rachialgie Kneifen der Haut über den
Proc. spinosi, bei Wirbelcaries Tiefendruck
und Belastung der Wirbelsäule von den
Schultern her lebhafte Schmerzen erzeugen.
Syringomyelie, die mit H. eine Reihe sensi-
tiver, vasomotorischer und trophischer Stö-
rungen teilt, schützt sich vor Verwechslung
durch die langsamere Entwickelung und seg-
mentale Ausbreitung der Anästhesie, sowiedurch progressive Atrophie in anästhetischen
Gebiet (Letzteres nur bei Ergriffensein der
Vorderhörner). Bezüglich der multiplen
Sklerose müssen unter anderen der Augen-
spiegelbefund, ausgeprägter Intentionstre-
mor, langsamer Nystagmus und die skan-
dierende Sprache, die sich mit dem Stottern
der H. nicht deckt, entscheiden. Bei der
Epilepsie ähnlichen Anfällen suche man nach
interparoxysmalen Stigmata der H., denke
auch an hysterogene Anfälle. Schwieriger ge-
staltet sich das Verhältnis der H. zur Neur-
asthenie, doch sind auch hier die Symptome
wesentlich verschieden. Während bei diesem
im Vordergrund die abnorme Ermüdbarkeit
mit langsamer Entwickelung der Erschei-
nungen steht, zeigt jene in polymorphen
Gewande, die plötzlich auf ein psychisches
Trauma hervorbrechen, oft ebenso schnell
verschwindenden, lokalisierten nervösen Stö-
rungen, der Anästhesie, Lähmungen, Kon-
trakturen etc. Die reizbare hypochondrische
Stimmung des Neurasthenikers ersetzt der
Hysterische höchstens durch allgemeine psy-
chische Depression, seine Furcht des Nicht-
könnens durch Unfähigkeit des Können-
wollens. Trotzdem gibt es Fälle, in denen
die Kombination beider Krankheitsbilder als
Hysteroneurasthenie scharfe Trennung un-
möglich macht. Hierfür ist die eine Krank-
heit sei zumeist nicht umfassender Bezeich-
nung t r a u m a t i s c h e n Neurosen verlassen und
an ihre Stelle das Bestreben, der Klassifika-
tion getrennt der H., der Neurasthenie, der
Hypochondrie, der commotio spinalis mit
organischer Grundlage, dem Rückenmarks-
blutungen u. s. f. das ihnen Gebührende zu-
zuerkennen. In dieser Richtung tritt dem
Arzt oft eine schwierige Aufgabe entgegen,
um so mehr, als Simulation und Uebertreibung
keine anempfehlbare Rolle spielen und path-
gnomonische Zeichen für die Anfallneurosen
nicht existieren. Dazu kommt, dass häufig
zwar nicht die Symptome, wohl aber der
Zeitpunkt ihrer Entstehung fälschlich an-
gegeben werden, insofern bei der Haupt-
sächlich in Betracht kommende Arbeiter-
bevölkerung, wie Sänger gezeigt, das Nerven-
system durch Alkohol, Nikotin, Syphilis,
Arteriosklerose schon viel früher erheblich
geschädigt war, ehe das leichte Trauma die
Veranlassung gab, unter Benutzung der alten
Störungen der Invalidenrente nachzujagen,
welche demnach mit Recht unter die Zahl
der Agents provocateurs aufgenommen wird.
Ob die von Stümpell zur Erklärung ein-
geführten Begehrensvorstellungen nur eine
krankheitsunterhaltende, aber keine kran-
heitsmachende Bedeutung besitzen, ist noch
strittige Frage. Auch unvoreingenommen nega-
tiven Urteil muss sich der Arzt hüten über
ein Non liquet wird er oft nicht hinaus-
kommen, da wohl das Symptom simuliert
sein kann, aber eben auf hysterischer Basis.
In zweifelhaften Fällen bedient man sich
der Chloroformnarkose oder Hypnose, z. B.
bei den urteilsschwierigeren Gelenkerkran-S.
kungen Wichtigkeit besitzt die elektrische
Prüfung.
VI. Prognose und Verlauf: Abgesehen von
den sehr seltenen Fällen, die durch Laryngo-
spasmus, Anorexie, Delirium, Hämoptoë oder
Tobsucht zu plötzlichem Tode führen, nimmt
die H. meist einen chronischen, über lange
Lebensperioden bis in das hohe Alter sich
erstreckenden Verlauf, der an Inter- und
Remissionen reich ist. Die oft leichte Be-
einflussung eines Symptoms verhindert nicht,
dass Ansprechen eines neuen, Heilung wird
erst durch Umwandlung der hysterischen
Konstitution dann erzielt, wenn hoher Wider-
stand gegen psychische und somatische Schäd-
lichkeiten die Auslösung hysterischer Er-
scheinungen dauernd verhindert. Wer will
da ein Urteil fällen? Als Massstab der Bese-
rung kann unter Umständen die Abnahme
der krankhaften Suggestibilität gelten. Ist
die Prognose quoad sanationem auch nicht
so günstig wie quoad vitam, so wird sie
doch durch vielfache Erwägungen differen-
ziert, wobei die Schwere der örtlichen Be-
lastung, die Dauer der Krankheit, häusliche
und soziale Missverhältnisse sehr ins Gewicht
fallen. Viel günstiger als bei Erwachsenen
gestaltet sich die Prognose der H. bei Kindern,
da ihnen ein weit grösseres Autoritätsgefühl
und Gehorsam inne wohnen. Die H. infantilis
tritt übrigens ebenso wie die traumatische
H. virilis mit Vorliebe in monosymptoma-
tischer Form auf. Einen besonderes kind-
lichen hysterischen Charakter gibt es nicht,
doch zeigen sich, begünstigt von lebhafter
Phantasie und Einbildungskraft, vorüber-
gehende psychische Störungen der Emotion
und des Affektes, auch rudimentäre Anfälle,
Clownismus, Somnambulismus und Pavor
nocturnus. Selten findet jener Anästhesieen
und eigentliche Neuralgieen, häufig Läh-
mungen, Kontrakturen, Arthralgieen, pare-
tische, spastische oder tremorartige Astasie-
Abasie, Aphonie, Mutismus, Blepharospas-
mus, Respirationskrämpfe, die verschiedenen
Formen der hysterischen Chorea. Da die
Therapie noch recht zugängliche H. der
Kinder würde weniger oft übersehen werden,
wenn die Kenntnis der Symptome mehr ihre
Nichtbeachtung verhinderte (Bann).
VII. Therapie: Früh eingreifende Pro-
phylaxe sollte die Ehe verhindern, wenn beim
Individuen schwer nervös sind, da ihr ent-
sprissende Kinder mit hoher Wahrschein-
lichkeit neuronpathische Belastung zeigen, wel-
cher die Prophylaxe der Nervosität, bedeutet
auch Prophylaxe der H. In erster Linie sind
nervöse Kinder, besonders hysterische Mütter
Früh gegen physische und psychische Ein-
flüsse abzuhüten, vor Verweichlichung, Ver-
zärtelung und phantasiereicher Lektüre zu
schützen, ihrer Aufmerksamkeit zu brechen,
Willen und Energie zu stärken. Den psycho-
genen Leiden entsprechend muss die Behand-
lung der ausgebreiteten Krankheit selbst in
der Hauptsache eine psychische sein, Direkt
durch Belehrung oder indirekt durch Beein-
flussung auf Umwegen unter Zuhilfenahme
möglichst unauffälliger Manipulationen.
Unter allen Umständen ist dem Kranken
das Bestreben gesund werden zu wollen und
die feste Zuversicht auf Heilung einzuflössen,
seine Mitarbeit an diesem Ziele zu erzwingen.
Dazu gehört von Seiten des Arztes eine ruhige,
ernste, bestimmte, von Hohn, Spott und Roh-
heit, aber auch von Aengstlichkeit über-
grossem Mitleid und Nachgiebigkeit freie,
inner Unständen einen gesunden Rücksichts-
losigkeit nebst betonter Berücksichtigung der
jederzeit Autorität und Respekt vor dem un-
geordneten zu wahren Weiss. Versagt der
Arzt, so drängt sich an seine Stelle die
illegitime Heilkunst und feiert oft Triumph.
Der einfache Befehl vermag ungekannte Be-
wegungen im Moment hervorzubringem, ein-
dringliche Ueberredung die durch Monate
verschwundene Stimme wiederzugeben. Bei
Kindern erreicht Bruns dasselbe durch die
Methode der U m b e z u m p e l u n g oder z w e c k -
m ä s s i g e Vernachlässigung. Umstürzen der
fixen Ideen, Ablenkung von den krank-
haften Autosuggestionen, Ueberführen des
Mängelns oder nervösen Willens in nor-
male Bahnen, Erziehung zur Selbstbeherr-
schung und Unterdrückung der unmotivierten
Affekte werden durch die vornehmserten Forde-
rungen der psychisch-suggestiven Therapie
lauten. Es bedarf keiner Auseinandersetzung,
dass strengste Individualisierung des Einzel-
falles, Geschicklichkeit und Fügigkeit des
Arztes als nutzbringende Faktoren der Heil-
wirkung zu gelten haben, Verliert der letztere
seinen Eindruck über den Kranken, so erreicht
er nichts mehr. Das gelingt dann vielleicht
noch der überlegenen Autorität des Kollegen.
Kommt man mit der einfachen Ueberredung
nicht zum Ziel, so versäume man nicht, bald
zu den indirekt-psychischen Hilfsmitteln der
Elektrizität, Hydrotherapie, Massage, Heil-
gymnastik oder auch medikamentösen Be-
handlung zu greifen, denen ausserdem der
Vorteil zur Seite steht, dass sie ebenso wie
die Weir Mitchellsche Kur oft das Wohl-
befinden des Kranken erhöhen, ihn dadurch
zu Autosuggestionen in günstigem Sinne ver-
anlassen. Im Grunde genommen ist die Art
des Verfahrens ziemlich gleichgültig, wenn
man nur stets den psychischen Einfluss da-
bei im Auge behält und dem Kranken über-
zeugend zu verstehen gibt, dass die Kur
sicher von Erfolg begleitet sein wird. Man
sei aber nach dieser Richtung vorsichtig,
versspreche nicht zu viel, sondern vertröste
auf weitere Besserung in folgenden Sitzungen.
Glaube und Vertrauen des Kranken sind leicht
verscherzt, weswegen eine übermässige Vier-
geschäftigkeit, ein Wanken und Schwanken
in der Wahl der Mittel zu häufiges Wechseln
derselben, entschieden zu widerraten sind.
Das mit Wachsuggestion im allgemeinen
auskommt, wird die gefährlichere Hypnose
für die schwersten Fälle ausgespart. In letzter
Zeit hat sich eine Methode in den Vorder-
grund gedrängt, die immer wärmere An-
S.
hänger findet und besonders in der Behand-
lung der traumatischen H. berufen zu sein
scheint, ihre sogenannte Wirksamkeit zu
entfalten. Das ist die möglichst frühzeitige
Heranziehung zu angemessener, regelmäs-
siger Arbeit, welche nicht allein den Stoff-
umsatz bei den Patienten forciert, die Blut-
zirkulation und Wärmeproduktion geistig
regelt, sondern vor allem geeignet ist, den
Kranken von seiner Grübelsucht und den
vielgestaltigen Krankheitsideen abzulenken.
Erfordernis wird eine ärztliche Dosierung
und Auswahl des teils geistigen, teils körper-
lichen Arbeit sein; Ueberanstrengung wirkt
ebenso schädlich, wie Spielerei wenig nützt.
Die Hysterischen sollen zu der Ueberzeugung
gelangen, dass auch sie ihr Pensum in der
allgemeinen Lebensaufgabe zu leisten haben,
weshalb die medikomechanische Behandlung
voller Ersatz nicht bieten kann. Mit Freuden
ist die in neuer Zeit aufgetauchte sociale
Forderung von Arbeitsnachweisstellen für
nur arbeitbeschränkte Rentenempfänger zu
begrüssen. Endlich muss noch darauf hin-
gewiesen werden, dass eine Isolierung der
Kranken, besonders der Kinder, d. h. Tren-
nung von den Angehörigen und Unterbringung
in einer sachgemäss geleiteten Anstalt oder
bei verständigen Familien, dünn genügt-
fertiger erscheint, wenn häusliche Verhält-
nisse die Autorität des Arztes untergraben
oder zum sinnlosen Serieanordnungen illu-
sorisch machen, und wenn H. des zweiten
Kindern Sucht zur Nachahmung erweckt.
Von Reisen, Luftkurorten, See- und Gebirgs-
aufenthalt erwarte nur der dann etwas, wenn
es gelingt, hierdurch den Kranken in gün-
stigerem Sinne psychisch zu beeinflussen. Meist
wird sich der Arzt der Schamflüge einzelner
Symptome nicht entziehen können, obwohl
er sich bewusst bleibt, dadurch das Grund-
leiden nicht zu beseitigen. Spezielle Regeln
lassen sich für das Herr derselben nicht auf-
stellen. Geschick und Erfindungsgebae leiten
den Meister. Lähmungen und Kontrakturen
entraten am wenigsten der elektrischen Be-
handlung jeglicher Gestaltung, wobei der
mässige, stabile galvanische Strom mit Auf-
setzen der Anode auf die gelähmten Muskeln
oder Nerven bevorzugt wird, oder auch der
Massage, alles häufig nur als vorbereitender
Akt für die folgende Suggestion. Astasie-
Abasie erfordert konstante frühzeitige Geh-
versuche. Auf Kehlkopfstörungen wirkt
Persuafion und Schütteln desselben mit
Aufforderung zu Husten und Sprechen gün-
stiger, wenn nicht die einfache Spiegel-
untersuchung und Druck auf den Zungen-
grund genügen. Bei Respirationskrämpfen
führen methodische Athemtemwegungen zum
Ziele, andere lokale Krämpfe werden durch
lokale Bäder oder Douchen, die kalt oder
warm oder schottische (abwechselnd heiss
und kalt) sein mögen, in Angriff genommen.
Glottiskrampf durch Brechmittel. Bei All-
gemeinkrämpfen versucht man es mit Sug-
gestion, kalten Güssen oder Druck hystero-
gener Punkte, steht jedoch oft genug hilflos
da und muss sich beschränken, die Befallenen
vor Verletzungen zu schützen. Hydrotherapie,
Magenspülung und Klysma spielen bei
Verdauungsstörungen eine Rolle, der leichte
stabile galvanische Strom mit Anode auf
die schmerzhaften Stellen oder spirituose
Einreibungen bei Neuralgieen. Gynäkologi-
sche Eingriffe sind nur dann vorzunehmen,
wenn sie auch bei Nichthysterischen indiziert
wären. Man hüte sich vor unnötigen Mani-
pulationen und Untersuchungen, da sie durch
Aufregung das Leiden meist verschlimmern.
Schlaflosigkeit wird durch allgemeine oder
partielle feuchte Einpackungen bekämpft,
oder durch die weniger gewohnheitsgefähr-
lichen Narcotica, Paraldehyd, Chloralhydrat,
Trional, Sulfonal. Morphium ist möglichst
zu vermeiden. Eisen, Arsen und die Tonica
haben ihre bekannte Indikation, Jod und
Quecksilber bei Kombination mit Lues. Häufig
geniessen die teuren Medikamente grössere
Achtung und Erfolg, weshalb Somatose, Nutrol,
Hämatogen und andere nicht abzureden sind.
Auch der Einfluss der Organotherapie ist
kein anderer. Ungünstig wirkende Lokal-
mittel benutze man aber nicht zu lang, da
ihre Summe unmöglich ein günstiges Ge-
samtresulat liefern kann (Löwenfeld). Mäs-
siger Alkohol- und Tabakgenuss kann erlaubt
werden. Der Arzt mache es sich zur Pflicht,
nicht nur die Ausführung der Verordnungen
streng zu überwachen, sondern auch alle
Applikationen selbst vorzunehmen, oder
nur sehr geschulten Pflegern anzuvertrauen.
Schliesslich sei noch der von Breuer und
Freud eingeführten Methode „des artifiziellen
Abreagierens pathogener Vorstellungen“ ge-
dacht, welche viel Geduld und Spezialkennt-
nis erfordert, dann aber Erfolge aufzuweisen
hat.
1074
–1083