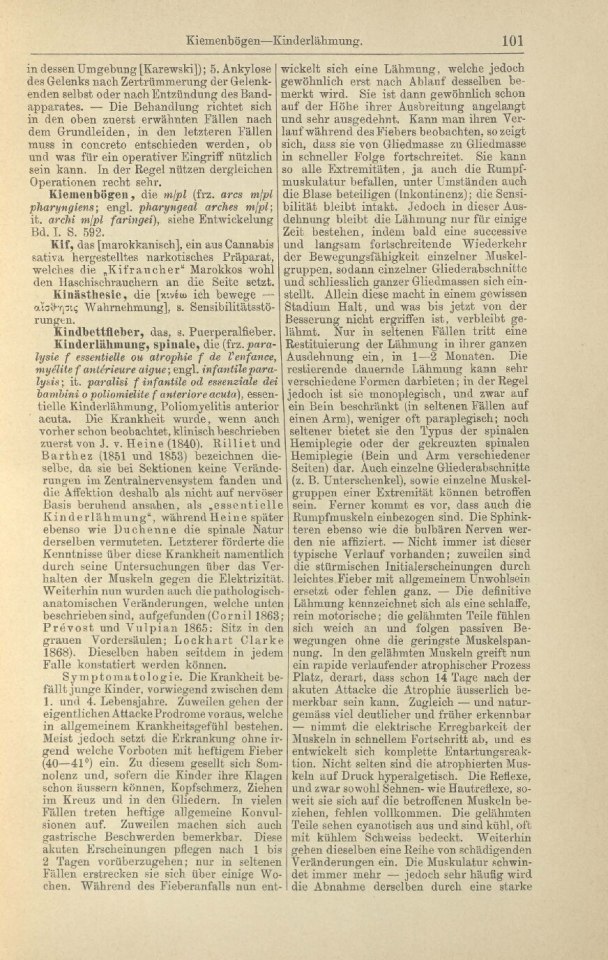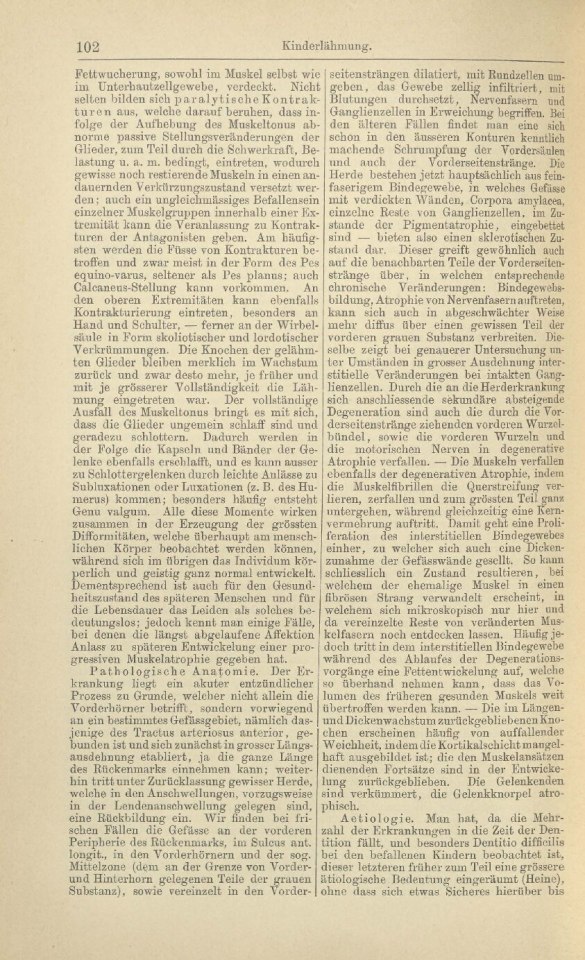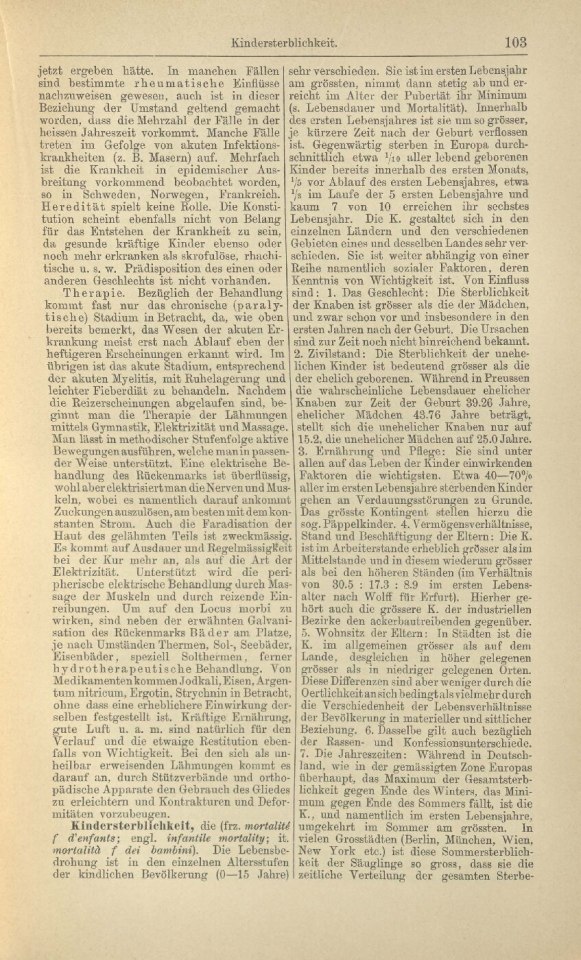S.
Kinderlähmung, spinale, die (frz. para-
lysie **essentielle ou atrophie de l’enfance,** myélite antérieure
aigue; engl. infantile paralysis; it. paralisi infantile
od essenziale dei bambini o poliomielite anteriore
acuta), essentielle Kinderlähmung, Poliomyelitis an-
terior acuta. Die Krankheit wurde, wenn auch
vorher schon beobachtet, klinisch beschrieben zu
erst von **J. v. Heine** (1840). Rilliet und
Barthez (1851 und 1853) bezeichneten die-
selbe, da sie bei Sektionen keine Verände-
rungen im Zentralnervensystem fanden und
die Affektion deshalb als nicht auf nervöser
Basis beruhend ansahen, als „essenielle
Kinderlähmung“, während Heine später
ebenso wie Duchenne die spinale Natur
derselben vermuteten. Letzterer förderte die
Kenntnisse über diese Krankheit namentlich
durch seine Untersuchungen über das Ver-
halten der Muskeln gegen die Elektrizität
und über die gerade hier sehr wichtige elektri-
sche Behandlung der Kranken.
Weiterhin nun wurden auch die pathologisch-
anatomischen Veränderungen, welche unten
beschrieben sind, aufgefunden (Cornil 1863;
Prévost und Vulpian 1865; Sitz in den
grauen Vordersäulen; Lockhart Clarke
1868). Dieselben haben seitdem in jedem
Falle konstatiert werden können.
Symptomatologie. Die Krankheit be-
fällt junge Kinder, vorwiegend zwischen dem
1. und 4. Lebensjahre. Zuweilen gehen der
eigentlichen Attacke Prodrome voraus, welche
in allgemeinem Krankheitsgefühl bestehen.
Meist jedoch setzt die Erkrankung ohne ir-
gend welche Vorboten mit heftigem Fieber
(40—41°) ein. Zu diesem gesellt sich Som-
nolenz und, sofern die Kinder ihre Klagen
schon äussern können, Kopfschmerz, Ziehen
im Kreuz und in den Gliedern. In vielen
Fällen treten heftige allgemeine Konvul-
sionen auf. Zuweilen machen sich auch
gastrische Beschwerden bemerkbar. Diese
akuten Erscheinungen pflegen nach 1 bis
2 Tagen vorüberzugehen; nur in seltenen
Fällen erstrecken sie sich über einige Wo-
chen. Während des Fieberanfalls nun ent-
wickelt sich eine Lähmung, welche jedoch
gewöhnlich erst nach Ablauf desselben be-
merkt wird. Sie ist dann gewöhnlich schon
auf der Höhe ihrer Ausbreitung angelangt
und sehr ausgedehnt. Kann man ihren Ver-
lauf während des Fieberns beobachten, so zeigt
sich, dass sie von Gliedmaasse zu Gliedmaasse
in schneller Folge fortschreitet. Sie kann
so alle Extremitäten, ja auch die Rumpf-
muskulatur befallen, unter Umständen auch
die Blase beteiligen (Inkontinenz); die Sensi-
bilität bleibt intakt. Jedoch in dieser Aus-
dehnung bleibt die Lähmung nur für einige
Zeit bestehen, indem bald eine sukzessive
und langsam fortschreitende Wiederkehr
der Bewegungsfähigkeit einzelner Muskel-
gruppen, sodann einzelner Gliederabschnitte
und schliesslich ganzer Gliedmaassen sich ein-
stellt. Allein diese macht in einem gewissen
Stadium Halt, und was bis jetzt von der
Besserung nicht ergriffen ist, verbleibt ge-
lähmt. Nur in seltenen Fällen tritt eine
Restituierung der Lähmung in ihrer ganzen
Ausdehnung erst in 1—2 Monaten ein. Die
restierende dauernde Lähmung kann sehr
verschiedene Formen darbieten; in der Regel
jedoch ist sie monoplegisch, und zwar auf
ein Bein beschränkt (in seltenen Fällen auf
einen Arm), weniger oft paraplegisch; noch
seltener bietet sie den Typus der spinalen
Hemiplegie oder der gekreuzten spinalen
Hemiplegie (Bein und Arm verschiedener
Seiten) dar. Auch einzelne Gliederabschnitte
(z. B. Unterschenkel) sowie einzelne Muskel-
gruppen einer Extremität können betroffen
sein. Ferner kommt es vor, dass auch die
Rumpfmuskeln einbezogen sind, die Sphinc-
teren ebenso wie die bulbären Nerven wer-
den nie affiziert. Nicht immer ist dieser
typische Verlauf vorhanden; zuweilen sind
die stürmischen Initialerscheinungen durch
leichtes Fieber mit allgemeinem Unwohlsein
ersetzt oder fehlen ganz. Die definitive
Lähmung kennzeichnet sich als eine schlaffe,
rein motorische; die gelähmten Teile fühlen
sich weich an und folgen passiven Be-
wegungen ohne die geringste Muskelspan-
nung. In den gelähmten Muskeln greift nun
ein rapide verlaufender atrophischer Prozess
Platz, derart, dass schon 14 Tage nach der
akuten Attacke die Atrophie äusserlich be-
merkbar sein kann. Zugleich und natur-
gemäss viel deutlicher und früher erkennbar,
nimmt die elektrische Erregbarkeit der
Muskeln in schnellem Fortschritt ab, und es
entwickelt sich komplizierte Entartungsreak-
tion. Nicht selten sind die atrophischen Mus-
keln auf Druck hyperalgetisch. Die Reflexe,
und zwar sowohl Sehnen- wie Hautreflexe, so-
weit sie sich auf die betroffenen Muskeln be-
ziehen, fehlen vollkommen. Die gelähmten
Teile sehen cyanotisch aus und sind kalt, oft
mit kaltem Schweiss bedeckt. Weiterhin
geht derselben eine Reihe von schädigenden
Veränderungen ein. Die Muskulatur schwin-
det immer mehr, jedoch sehr häufig wird
die Abnahme derselben durch eine starkeS.
Fettwucherung, sowohl im Muskel selbst wie
im Unterhautzellgewebe verdeckt. Nicht
selten bilden sich paralytische Kontrak-
turen aus, welche darauf beruhen, dass in-
folge der Aufhebung des Muskeltonus ab-
norme passive Stellungsveränderungen der
Glieder zum Teil durch die Schwerkraft, Be-
lastung u. a. m. bedingt, eintreten, wodurch
gewisse noch residierende Muskeln in einen an-
dauernden Verkürzungszustand versetzt wer-
den; auch ein ungleichmässiges Befallensein
einzelner Muskelgruppen innerhalb einer Ex-
tremität kann die Verkürzung zu Kontrak-
turen der Antagonisten geben. Am häufig-
sten werden die Füsse von Kontrakturen be-
troffen und zwar meist in der Form des Pes
equino-varus, seltener als Pes planus; auch
Calcaneo-Stellung kann vorkommen. An
den oberen Extremitäten kann ebenfalls
Kontraktuierung eintreten, besonders an
Hand und Schulter, ferner an der Wirbel-
säule in Form skoliotischer und lordotischer
Verkrümmungen. Die Knochen der gelähmten
Glieder bleiben merklich im Wachstum zu-
rück und zwar desto mehr, je früher und
mit je grösserer Vollständigkeit die Lähmung
eingetreten war. Der vollständige
Ausfall der Muskelfunktion bringt es mit sich,
dass die Glieder allgemein schlaff sind und
geradezu schlottern. Dadurch werden in
der Folge die Kapseln und Bänder der Ge-
lenke ebenfalls erschlafft, und es kann ausser
zu Schlottergelenken durch leichte Anlässe zu
Subluxationen oder Luxationen (z. B. des Hu-
merus) kommen, besonders häufig entsteht
**änn** vagans. Alle diese Momente wirken
zusammen in der Erzeugung der grossen
Deformitäten, welche überhaupt am mensch-
lichen Körper beobachtet werden können,
während sich im übrigen das Individuum kör-
perlich und geistig ganz normal entwickelt.
Dementsprechend ist auch für den Gesund-
heitszustand des späteren Menschen und für
die Lebensdauer das Leiden als solches be-
deutungslos; jedoch kennt man einige Fälle
bei denen die längst abgelaufene Affektion
Anlass zu späteren Entwicklung einer pro-
gressiven Muskelatrophie gegeben hat.
Pathologische Anatomie. Der Er-
krankung liegt ein akuter entzündlicher
Prozess zu Grunde, welcher nicht allein die
Vorderhörner betrifft, sondern vorwiegend
an ein bestimmtes Gefässgebiet, nämlich das-
jenige des **Tractus arteriosus anterior**, ge-
bunden ist und sich zunächst in grösserer Längs-
ausdehnung etabliert, ja die ganze Länge
des Rückenmarks einnehmen kann; weiter-
hin tritt unter Zurücklassung gewisser Herde,
welche in den Anschwellungen, vorzugsweise
in der Lendenschwellung gelegen sind,
eine Rückbildung ein. Wir finden bei fri-
schen Fällen die Gefässe an der vorderen
Peripherie des Rückenmarks, im Sulcus ant.
longit., in den Vorderhörnern und den sog.
Mittelzonen (dem an der Grenze von Vorder-
und Hinterhorn gelegenen Teile der grauen
Substanz), sowie vereinzelt in den Vorder-
e seitensträngen dilatiert, mit Rundzellen und
Blutungen durchsetzt, Nervenfasern und
Ganglienzellen in Erweichung begriffen. Bei
den älteren Fällen findet man eine sich
schon in den äusseren Konturen kenntlich
machende Schrumpfung der Vordersäulen
und auch der Vorderseitenstränge, welche die
Herde bestehen, jetzt hauptsächlich aus fett-
fasrigem Bindegewebe, in welches Gefässe
mit verdickten Wänden, Corpora amylacea,
einzelne Reste von Ganglienzellen, im Zu-
stande der Pigmentatrophie, eingebettet
sind — bieten also einen sklerotischen Zu-
stand dar. Diesen greift gewöhnlich auch
auf die benachbarten Teile der Vorderseiten-
stränge über, in welchen entsprechende
chronische Veränderungen: Bindegewebs-
bildung, Atrophie von Nervenfasern aufweisen,
kann sich auch in abgeschwächter Weise
mehr diffus über einen gewissen Teil der
vorderen grauen Substanz verbreiten. Die-
selbe zeigt bei genauerer Untersuchung un-
ter Umständen in grosser Ausdehnung inter-
stitielle Veränderungen bei intakten Gang-
lienzellen. Durch die an die Herderkrankung
sich anschliessende sekundäre absteigende
Degeneration sind auch die durch die Vor-
derseitenstränge ziehenden vorderen Wurzel-
bündel sowie die vorderen Wurzeln und
die motorischen Nerven in degenerativer
Atrophie verfallen. Die Muskeln erfahren
ebenfalls der degenerativen Atrophie, indem
die Muskelfibrillen die Querstreifung ver-
lieren, zerfallen und zum grössten Teil ganz
untergehen, während gleichzeitig eine Kern-
vermehrung auftritt. Damit geht eine Proli-
feration des interstitiellen Bindegewebes
einher, zu welcher sich auch eine Dicken-
zunahme der Gefässwände gesellt. So kann
schliesslich ein Zustand resultieren, bei
welchem der ehemalige Muskel in einen
fibrösen Strang verwandelt erscheint, in
welchem sich mikroskopisch nur hier und
da vereinzelte Reste von veränderten Mus-
kelfasern noch entdecken lassen. Häufig je-
doch tritt in dem interstitiellen Bindegewebe
während des Ablaufes der Degenerations-
vorgänge eine Fettentwicklung auf, welche
so überhand nehmen kann, dass das Vo-
lumen des früheren gesunden Muskels weit
übertroffen werden kann. Die im Längen-
und Dickenwachstum zurückgebliebenen Kno-
chen erscheinen häufig auf auffallender
Weichheit, indem die Kortikalschicht mangel-
haft ausgebildet ist; die den Muskelansätzen
dienenden Fortsätze sind in der Entwicke-
lung zurückgeblieben. Die Gelenkenden
sind indessen durch Gelenkknorpelatrophie
verkrümmt, die Gelenkknorpel atro-
phisch.
**Aetiologie**. Man hat, da die Mehrzahl
der Erkrankungen in die Zeit der Den-
tition fallen und besonders Dentitio difficilis
bei den befallenen Kindern beobachtet ist,
dieser letzteren früher zum Teil eine grössere
ätiologische Bedeutung eingeräumt (Heine),
ohne dass sich etwas Sicheres hierüber bis
S.
jetzt ergeben hätte. In manchen Fällen sind
bestimmte rheumatische Einflüsse nachzuweisen
gewesen, auch ist in dieser Beziehung der Umstand
geltend gemacht worden, dass die Mehrzahl der Fälle
in der nassen Jahreszeit vorkommt. Manche Fälle
treten im Gefolge von akuten Infektions-
krankheiten (z. B. Masern) auf. Mehrfach
ist die Krankheit in epidemischer Ausbreitung
vorkommend beobachtet worden,
so in Schweden, Norwegen, Frankreich.
Heredität spielt keine Rolle. Die Konsti-
tution scheint ebenfalls nicht von Belang
für das Entstehen der Krankheit zu sein,
da gesunde kräftige Kinder ebenso oder
noch mehr erkranken als skrofulöse, rhachi-
tische u. s. w. Prädisposition des einen oder
anderen Geschlechts ist nicht vorhanden.
Therapie. Bezüglich der Behandlung
kommt fast nur das chronische (paraly-
tische) Stadium in Betracht, da, wie oben
bereits bemerkt, das Wesen der akuten Er-
krankung meist erst nach Ablauf eben der
heftigeren Erscheinungen erkannt wird. Im
übrigen ist das akute Stadium, entsprechend
der akuten Myelitis, mit Ruhe, Lagerung und
leichter Fieberdiät zu behandeln. Nachdem
die Reizerscheinungen abgelaufen sind, be-
ginnt man die Therapie der Lähmungen
mittels Gymnastik, Elektrizität und Massage.
Man lässt in methodischen Stufenfolge aktive
Bewegungsübungen, welche man in passiver
Weise unterstützt. Eine elektrische Be-
handlung des Rückenmarks ist überflüssig,
wohl aber elektisiert man die Nerven und Mus-
keln, wobei es namentlich darauf ankommt,
Zuckungen auszulösen, am besten mit dem kon-
stanten Strom. Auch die Faradisation der
Haut des gelähmten Teils ist zweckmässig.
Es kommt auf Ausdauer und Regelmässigkeit
bei der Kur mehr an, als auf die Art der
Elektrizität. Unterstützt wird die peri-
pherische elektrische Behandlung durch Mas-
sage der Muskeln und durch reizende Ein-
reibungen. Um auf den Locus morbi zu
wirken, sind neben der erwähnten Galvani-
sation des Rückenmarks Bäder an dem Platze,
je nach Umständen (Thermen, Sol-, Seebäder,
Eisenbäder, speziell Solthermen, ferner
Hydrotherapeutische Behandlung. Von
Medikamenten kommen Jodkali, Eisen, Argen-
tum nitricum, Ergotin, Strychnin in Betracht,
ohne dass eine erhebliche Einwirkung der-
selben festgestellt ist. Kräftige Ernährung,
gute Luft u. a. m. sind natürlich für den
Verlauf und die etwaige Restitution eben-
falls von Wichtigkeit. Bei den sich als un-
heilbar erweisenden Lähmungen kommt es
darauf an, durch Stützverbände und ortho-
pädische Apparate den Gebrauch des Gliedes
zu erleichtern und Kontrakturen und Defor-
mitäten vorzubeugen.
101
–103