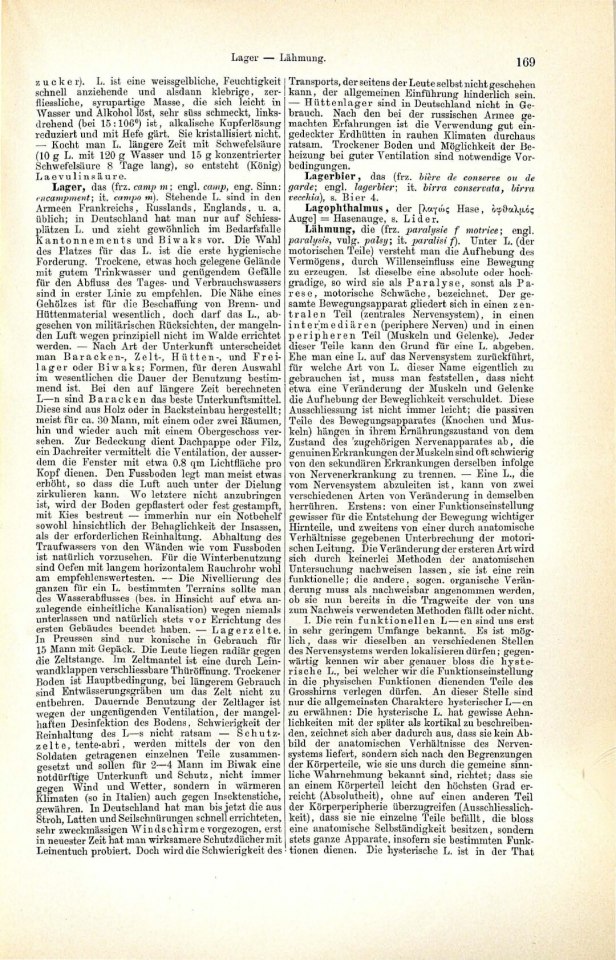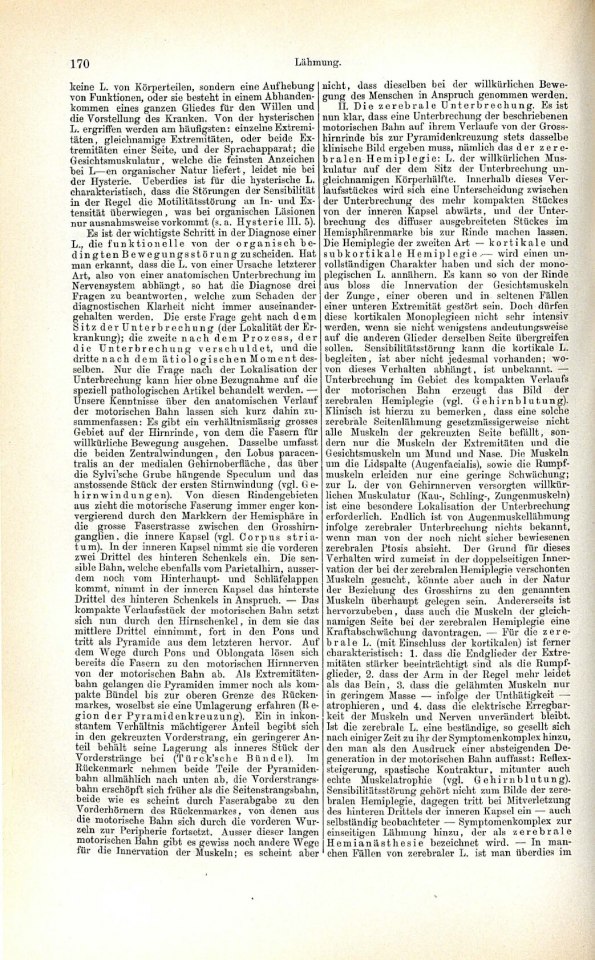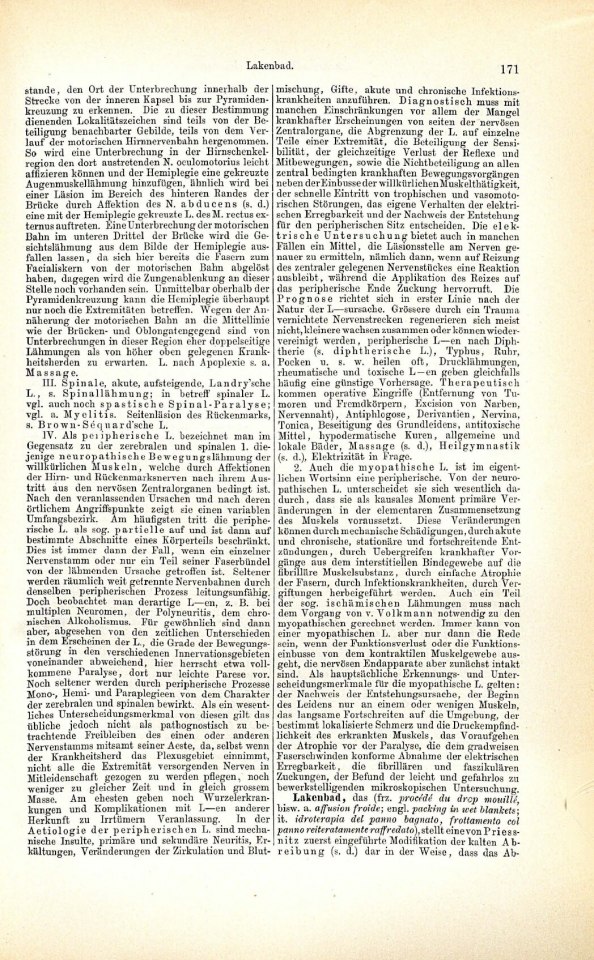S.
L ä h m u n g, die L., paralyse $f$ motrice; engl.
paralysis; it. paralisi; sp. parálisis $f$ (grec. Λοστωμα der
motorischen Theile), versteht man die Aufhebung des
Vermögens, durch Willensschlüsse eine Bewegung
zu erzeugen; ist dieselbe eine absolute oder noch
gradige, so wird sie als P a r a l y s e, sonst als P a-
r e s e oder m o t o r i s c h e S c h w äc h e bezeichnet. Der ge-
samte Bewegungsapparat gliedert sich in einen c e n-
t r a l e n Theil (Gehirn, Rückenmark), in einen
i n t e r m e d iä r e n (periphere Nerven) und in einen
p e r i p h e r e n (d. i. Theil Muskeln und Gelenke). Jeder
dieser Theile kann der Grund für eine L. abgeben.
Ehe man eine L. auf das Nervensystem zurückführt,
für welche Art von L. dieser Name eigentlich zu
gebrauchen ist, muss man feststellen, dass nicht
etwa eine Veränderung des Muskels und Gelenke
die Aufhebung der Beweglichkeit verschuldet. Eine
Ausschliessung ist nicht immer leicht; die passiven
Theile (die Bewegungsorganen, Muskeln und Ge-
lenken) hängen in ihrem Ernährungszustand von dem
Zustande der zugehörigen Bewegungsapparat ab. Bei
einigen Erkrankungen der Muskeln und oft schwierig
von den sekundären Erkrankungen derselben infolge
der Erkrankungsbeginn zu trennen. Sämmtliche L. die
vom Nervensystem abzuleiten ist, kann von zwei
verschiedenen Arten von Veränderung in demselben
herrühren. E r s t e n s: von einer functionelle Störung
desselben für die Entstehung der Bewegung, also der
Herzstelle, und zweitens von einer durch anatomische
Veräänderung gegebenen Unterbrechung der motori-
schen Leitung. Die Veränderung der ersteren Art wird
erst durch keinerlei anatomische oder pathologische
Untersuchung nachweisen lassen, sie ist eine rein
functionelle; die zweite, welche anatomische Än-
derung muss, als nachweisbar angenommen werden,
ist als anatomische oder durchgreifend zu beurtheilen.
Zum Nachweis verwenden Methoden fällt oder nicht,
Es ist sehr wichtig, wenn man eine L. von der Quelle
in sehr geringem Umfange bekannt. Es ist mög-
lich, dass die Lähmungen an verschiedenen Stellen
des Nervensystem vorgenommen werden; daran liegen
lokale physikalische Ursachen zu Grunde, die erst
nach der Zeit, bei welcher die Functionelle Stöhrung
in der physischen Functionen derselben die Ursache
der L. zur Folge haben. An dieser Stelle und
nur bei allgemeinen Charakters ist die L. er-
wähnung. Die hysterische L. hat gewisse Aehn-
lichkeiten mit der motorischen L. hat gewisse Ähn-
lichkeiten, in der sie als solche zu bezeichnen.
Sie hat sich, wie die durch die ganze eine sin-
nes- Organismus, an dem die anatomische Ver-
hältnisses des Nervensystems Schaden anrichten,
durch die Veränderung der Funktion, wie sie uns
durch die gleiche sinnesorganische Wahrnehmung
und den durch die Veränderung der
Körperteile, die auf ihren motorischen Theil
nicht übergehen), überall auf. Ausserdem soll
(ausser dem motorischen Theile, was die Ursache
einer anatomischen Selbständigkeit besitzen, sondern
vielmehr die Sprache, welche die beständigen Func-
tionen dienen. Die hysterische L. ist in der That
S.
keine L von Körperteilen, sondern eine Aufhebung
von Funktionen, oder sie besteht in einem Abziehen,
Kommen eines ganzen Gliedes für den Willen und
die Vorstellung des Kranken. Von der hysterischen
L ergriffen werden am häufigsten einzelne Extremitä-
ten, gleichnamige Extremitäten, oder beide Ex-
tremitäten einer Seite, und der Sprachapparat, die
Gesichtsmuskulatur, welche die feinsten Anzeichen
bei L. en organischer Natur liefert, leidet nie bei
der Hysterie. Überdies ist für die hysterische L.
charakteristisch, dass die Störungen der Sensibilität
in der Regel die Motilitätsstörung an und in Ex-
tensität überwiegen, was bei organischen Leiden
nun ausnahmsweise vorkommt (s. a. Hysterie III, 5).
Der ist wichtige Schritt in der Diagnose einer
L., die funktionelle von der organischen be-
dingten Bewegungstörung zu scheiden. Hat
man erkannt, dass die L. von einer Läsion letzterer
Art, also von einer anatomischen Unterbrechung im
Nervensystem abhängt, so hat die Diagnose drei
Fragen zu beantworten, welche zum Scheiden der
diagnostischen Klarheit nicht immer auseinander-
gehalten werden: Die erste Frage geht nach dem
Sitz der Unterbrechung (der Lokalisation der
Erkrankung); die zweite nach dem Prozess, der
die Unterbrechung verschuldet, und die
dritte nach dem ätiologischen Moment der
selben. Nur die Frage nach der Lokalisation der
Unterbrechung kann hier ohne Bezugnahme auf die
speziell pathologischen Artikel behandelt werden.
Unsere Kenntnisse über den anatomischen Verlauf
der motorischen Bahn lassen sich kurz dahin zu-
sammenfassen: Es gibt ein verhältnismässig grosses
Gebiet auf der Hirnrinde, von dem die Fasern für
willkürliche Bewegung ausgehen. Dasselbe umfasst
die beiden Zentralwindungen, den Lobus paracen-
tralis an der medialen Gehirnoberfläche, das über
die Sylvi’sche Grube hängende Speculum und das
austossende Stück der dritten Stirnwindung (vgl. Ge-
hirnanatomie). Von diesen Rindengebieten
aus zieht die motorische Faserung immer enger kon-
vergiert durch den Markkern der Hemisphäre in
die grosse Faserstrasse zwischen der Glashöhle
ganzhin, die innere Kapsel (vgl. Corpus stria-
tum). In der inneren Kapsel namentlich verlaufen
zwei Drittel des hinteren Schenkels ein; Die sen-
sible Bahn, welche ebenfalls vom Parietalhirn, ausser-
dem noch von Hinterhaupts- und Schläfelappen
kommt, nimmt in der inneren Kapsel das hinterste
Drittel des hinteren Schenkels in Anspruch. Das
kompakte Verlaufstück der motorischen Bahn setzt
sich nun durch den Hirnschenkel, in dem sie das
mittlere Drittel einnimmt, fort, im Pons wird
tritt als Pyramide aus dem letzteren hervor. Auf
dem Wege durch Pons und Oblongata lösen sich
Bereite die Fasern zu dem motorischen Hirnnerven
von der motorischen Bahn ab. Als Extremitäten-
bahn gelangen die Pyramiden immer noch als kom-
pakte Bündel bis zur oberen Grenze des Rücken-
markes, woselbst sie eine Umlagerung erfahren (Re-
gion der Pyramidenkreuzung). Ein klinisch
konstantem Verhältnis entsprechend, Anteil begibt sich
in den gekreuzten Vortragstrang, ein geringerer An-
teil behält seine Lage mitten als inneres Stück der
Vorderstränge bei (Rücksche Bündel). Im
Rückenmark nehmen beide Teile der Pyramiden
Bahn allmählich nach unten ab, die Vorderstrangs-
bahn erschöpft sich früher als die Seitenstrangsbahn,
beide Teile so scheint durch Ausserabgabe zu den
Vorderhörnern des Rückenmarks, von dem aus
die motorische Bahn sich durch die vorderen Wur-
zeln zur Peripherie fortsetzt. Ausser dieser lange
motorischen Bahn gibt es gewiss noch andere Wege
für die Innervation der Muskeln; es scheint abernicht, dass dieselben bei der willkürlichen Bewe-
gung des Menschen in Anspruch genommen werden
(vgl. Zerebrale Ursprünge). Es ist
nun klar, dass eine Unterbrechung der beschriebenen
motorischen Bahn auf ihrem Verlaufe von der Gross-
hirnrinde bis zur Pyramidenkreuzung stets dasselbe
klinische Bild ergeben muss, nämlich das der **
u n t e r n a h m l i c h e n** Hemiplegie, L. der willkürlichen Mus-
kulatur auf der dem Sitz der Unterbrechung un-
gleichnamigen Körperhälfte. Innerhalb dieses Ver-
laufsstückes wird sich eine Unterscheidung zwischen
der Unterbrechung des mehr kompakten Stückes
vor der inneren Kapsel abwärts und der Unter-
brechung des diffusen, ausgebreiteten Stückes im
Hemisphärenmarke bis zur Rinde machen lassen.
Die Hemiplegie der zweiten Art ist kortikale und
subkortikale Hemiplegie und wird einen um-
vollständigen Charakter haben und sich der mono-
plegischen L. annähern. Es kann so von der Rinde
aus bloss die Innervation der Gesichtsmuskeln
der Zunge, einer oberen und in seltenen Fällen
einer unteren Extremität gestört sein. Doch dürfen
diese kortikalen Monoplegien nicht sehr intensiv
werden, denn die Fasern wenigstens sind unterwegs
auf die anderen Glieder derselben Seite übergreifen
sollen. Sensibilitätsstörung kann die kortikale L.
begleiten, ist aber nicht jedesmal vorhanden, wo-
von dieses Verhalten abhängt, ist unbekannt.
Unterbrechung im Gebiet des kompakten Verlaufs
der motorischen Bahn erzeugt das Bild der
**zerebralen** Hemiplegie (vgl. Gehirnblutung).
Klinisch ist hierbei zu bemerken, dass eine solch
zerebrale Seitenlähmung gesatzmässigerweise nicht
alle Muskeln der gekreuzten Seite befällt; son-
dern nur die Muskeln der Extremitäten und die
Gesichtsmuskeln um Mund und Nase. Die Muskeln
um die Lidspalte (Augenfacialis), sowie die Rumpf-
muskeln entgehen aus einer geringen Schwächung
zur L. der von Gehirnnerven versorgten willkür-
lichen Muskulatur (Kauer, Schlucken, Zungenmuskeln)
ist eine besondere Lokalisation der Unterbrechung
erforderlich. Endlich ist von Augenmuskellähmung
infolge zerebraler Unterbrechung nicht bekannt,
wenn man von der noch nicht sicher bewiesenen
zerebralen Ptosis absieht. Der Grund für dieses
Verhalten wird zumeist in der doppelseitigen Inner-
vation der bei der zerebralen Hemiplegie verschonten
Muskeln gesucht, könnte aber mehr in der Nähe
der Beziehung des Grosshirn zu den genannten
Muskeln überhaupt gelegen sein. Anderseits ist
hervorzuheben, dass auch die Muskeln der gleich-
namigen Seite bei der zerebralen Hemiplegie eine
Kraftabschwächung davontragen. Für die ze-
rebrale L. (mit Einschluss der Kortikalen) ist ferner
charakteristisch: 1. dass die Endglieder der Extre-
mitäten stärker beeinträchtigt sind als die Rumpf-
glieder; 2. dass der Arm in der Regel mehr leidet
als das Bein; 3. dass die gelähmten Muskeln nur
in geringem Maase – infolge der Untätigkeit –
atrophieren und 4. dass die elektrische Erregbar-
keit der Muskeln und Nerven unverändert bleibt.
Ist die zerebrale L. eine brandjährige, so gesellt sich
nach einiger Zeit zu ihr der Symptomenkomplex hinzu,
den man als den Ausdruck einer übersteigenden De-
generation in der motorischen Bahn auffasset: Reflex-
steigerung, spastische Kontraktur, mitunter auch
schlaffe Muskelatrophie (vgl. Gehirnblutung).
Sensibilitätsstörung gehört nicht zum Bilde der zere-
bralen Hemiplegie, dagegen tritt bei Mitverletzung
des hinteren Drittels der inneren Kapsel doch – und
selbständig beobachteter – Symptomenkomplex zur
einseitigen Lähmung hinzu, der als zerebrale
Hemianästhesie bezeichnet wird. In man-
chen Fällen von zerebraler L. ist man überdies im
S.
stande den Ort der Unterbrechung innerhalb der
Strecke von der inneren Kapsel bis zur Pyramiden-
kreuzung zu erkennen. Die zu dieser Bestimmung
dienenden Lokalitätszeichen sind teils von der Be-
teiligung benachbarter Gebilde, teils von dem Ver-
lauf der motorischen Hirnnervenbahn hergenommen.
So wird eine Unterbrechung in der Hirnschenkel-
region den dort austretenden N. oculomotorius leicht
affizieren können und der Hemiplegie eine gekreuzte
Augenmuskellähmung hinzuzufügen. Ähnlich wird bei
einer Läsion im Bereich des hinteren Randes der
Brücke, durch Affektion des N. abducens (s. d.)
eine mit der Hemiplegie gekreuzte, dem M. rectus ex-
ternus auftreteten. Eine Unterbrechung der motorischen
Bahn im unteren Drittel der Brücke wird die Ge-
sichtslähmung aus dem Bilde der Hemiplegie aus-
fallen lassen, da sich hier bereits die Fasern zum
Facialisstamm von der motorischen Bahn abgelöst
haben, dagegen wird die Zungenlähmung an dieser
Stelle noch vorhanden sein. Unmittelbar oberhalb der
Pyramidenkreuzung kann die Hemiplegie überhaupt
nur noch die Extremitäten betreffen. Wegen der An-
näherung der motorischen Bahn an die Mittellinie
wird der Brücken- und Oblongatengegend sind von
Unterbrechungen in dieser Region eher doppelseitige
Lähmungen als von höher oben gelegenen Krank-
heitsherden zu erwarten. L nach **A p o p l e x i e** s. a.
Marasmus.
III. Spinale, akute, aufsteigende, Landry’sche
L, s. Spinallähmung; in betreff spinaler L.
überhaupt noch spastische spinale Paralyse,
vgl. a. Myelitis. Seitenläsion des Rückenmarks
s. B r o w n - S é q u a r d’sche L.
IV. Als periphere L. bezeichnet man im
Gegensatz zu der zerebralen und spinalen L. die-
jenige Neuropathie, welche Lähmung der
willkürlichen Muskeln, welche durch Affektionen
der Hirn- und Rückenmarksnerven nach ihrem Aus-
tritt aus dem zentralen Organ bedingt ist.
Nach den veranlassenden Ursachen und nach deren
örtlichen Angriffspunkte zeigt sie einen variablen
Umfangsbereich. Am häufigsten tritt die periphe-
rische L. als sog. partielle auf und ist dann auf
bestimmte Abschnitte eines Körperteils beschränkt.
Dies ist immer dann der Fall, wenn ein einzelner
Nervenstämm oder nur eine Teil seiner Faserbündel
von der lähmenden Ursache getroffen ist. Seltener
werden räumlich weit getrennte Nervenbahnen durch
denselben peripherischen Prozess leitungunfähig.
Doch beobachtet man derartige L.en, z. B. bei
multiplen Neurömen, der Polyneuritis, dem chro-
nischen Alkoholismus, dem Gewebebleibes, etc.,
aber, abgesehen von den zeitlichen Unterschieden
in dem Erscheinen der L., die Grade der Bewegungs-
störungen und den verschiedenen Innervationsgebieten
voneinander abweichend hier herrscht etwa voll-
kommene Paralyse dort, wo jene L. der
von
noch seltener werden durch peripheirsche Prozesse
Mono-, Hemi- und Paraplegien von dem Charakter
der zerebralen und spinalen bewirkt, als ein wesent-
liches Unterscheidungsmerkmal von diesen gilt das
übliche jedoch nicht als pathognostisch zu be-
zeichnendes Freibleiben des einen oder anderen
Nervenstamms mitsamt seiner Aeste, da selbst wenn
dem Krankheitsherd die Pleurisitis folgt, u. U. nimm
nicht alle die Extremität versorgenden Nerven in
Mitleidenschaft gezogen werden, plogen noch
genügend zu gleicher Zeit und in gleich grossem
Maasse. Am ehesten geben noch Wurzelkranken-
klungen und Komplikationen mit L.en anderer
Herkunft zu **k ü m m e r n d e r** Veranlassung. In der
Aetiologie der peripherischen L. sind mecha-
nische Insulte, primäre und sekundäre Neuritis, Er-
kältungen, Veränderungen der Zirkulation und Blut-
mischung, Gisse und chronische Infektions-
krankheiten anzuführen. Diagnostisch muss mit
mancher Einschränkungen vor allem der Mangel
krankhafter Erscheinungen von seiten der nervösen
Zentralorgane, die Abgrenzung der L. auf einzelne
Teile einer Extremität, die Beteiligung der Sen-
sibilität, der gleichzeitige Verlust der Reflexe und
Mitbewegungen, sowie die Nichtbeteiligung auf allen
Affizierten Körpern und der Hemiplegie eine gekreuzte
Augenmuskellähmung ausschliessen; in den peripheren
L.en fehlt jede Einbusse der willkürlichen Muskeltätigkeit,
der schnelle Eintritt von trophischen und vaso-
motorischen Störungen, das eigene Verhalten der elektri-
schen Erregbarkeit und der Nachweis der Entstehung
für den peripherischen Sitz entscheiden. Die elek-
trische Untersuchung bietet auch in manchen
Fällen zum Mittel, die Läsionsstelle am Nerven ge-
nauer zu eruieren, nämlich dann, wenn am Reizung
des zentraler gelegenen Nervenstückes eine Reaktion
ausbleibt, während die Applikation des Reizes auf
das periphere Ende eine Zuckung hervorruft. Die
Prognose richtet sich in erster Linie nach der
Natur der Ursache. Groösser durch eine Stamm-
vernichtete Nervenstrecken regenerieren sich meist
mehr kleinere, wachsen zusammen oder können wieder-
vereinigt werden (peripherische L.en nach Diph-
therie (s. d i p h t h e r i s ch e L.), Typhus, Ruhr,
Pocken (s. u. h e i t e r P.) droht Lähmungen)
rheumatische und toxische L.en geben gleichfalls
häufig eine günstige Vorhersage. Therapeutisch
kommen operative Eingriffe (Entfernung von Tu-
moren und Fremdkörpern, Excision von Nerven,
Nervenannte) Antiphlogose, Derivantienc, Nerven-
reizung, Beseitigung der Grundleiden, antiphlogistische
Mittel, hypodermatiscche Kuren, allgemeine und
lokale Bäder, Massage (s. d.), Heilgymnastik
(s. d.), Elektrizität in Frage.
5. Auch die myopathische L. ist im eigent-
lichen Wortsinn eine peripherische. Von der neuro-
pathischen L. unterscheidet sie sich wesentlich da-
durch, dass sie als kausales Moment primäre Ver-
änderungen in der elementaren Zusammensetzung
des Muskels voraussetzt. Diesse Veränderungen
können durch mechanische Schädigungen, durch akute
und chronische, eintönige und fortschreitende Ent-
zündungen, durch Uebergreifen krankhafter Vor-
gänge aus dem interstitiellen Bindegewebe auf die
fibrilläre Muskelsubstanz, durch einfache Atrophie
der Fasern, durch Infektionskrankheiten, durch Ver-
giftungen herbeigeführt werden. Ueber ein Teil
der sog. ischämischen Lähmungen muss nach
dem Vorgang von Volkmann notwendig zu den
myopathischen gerechnet werden. Trotzdem kann von
einer myopathischen L. aber nur dann die Rede
sein, wenn der Funktionsverlust oder die Reaktions-
einbusse von dem kontrahtilen Muskelgewebe aus-
geht, die nervösen Endapparate aber zunächst intakt
sind. Als hauptsächlichste Erkennungs- und Unter-
scheidungsmerkmale für die myopathische L. gelten:
der Nachweis der Entstehungsursache, der Beginn
des Leidens nur an einem oder wenigen Muskeln,
das langsame Fortschreiten auf die Umgebung, der
bestimmt lokalisierte Schmerz und die Druckempfind-
lichkeit des erkrankten Muskels, das Vorausgehen
der Atrophie vor der Paralyse, die dem gradweisen
Faseruntergang konforme Abnahme der elektrischen
Erregbarkeit, die fibrillären und faszikulären
Zuckungen, der Befund des leicht und gefahrlos zu
gewinnenden mikroskopischen Untersuchung.
L a k e n b a d. (frz. **procédé du drap mouillé**,
besser **wetton ofoold ongt. packing in wet blanket**;
it. **idroterapia col panno imantato, frotatamto col
panno unteramerato affreddato**) stellt eine von P r i e s s -
n i t z zuerst einverleibte Modifikation der kalten Ab-
reibung (s. d.) dar in der Weise, dass um das Ab-
Villaret_1888_Handwoerterbuch_II
169
–171