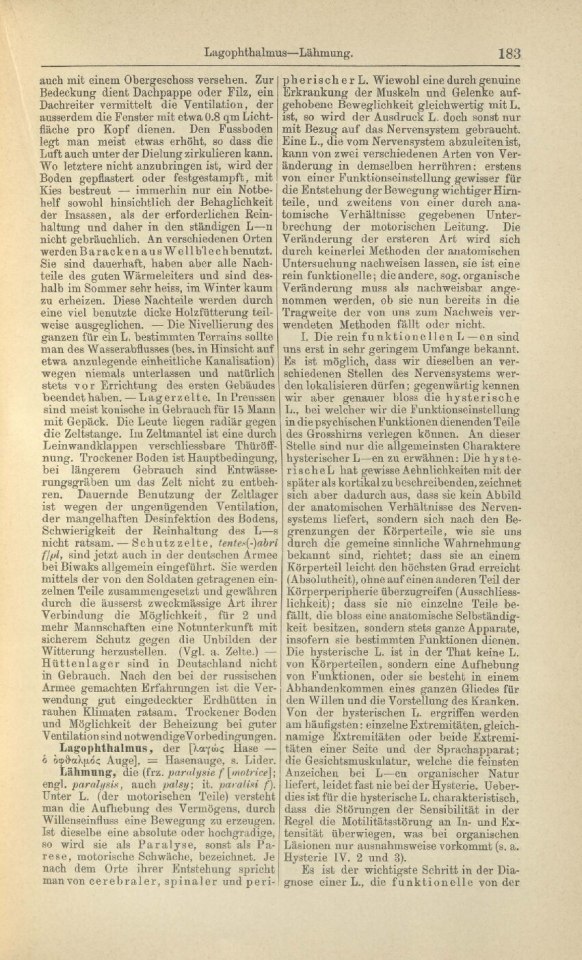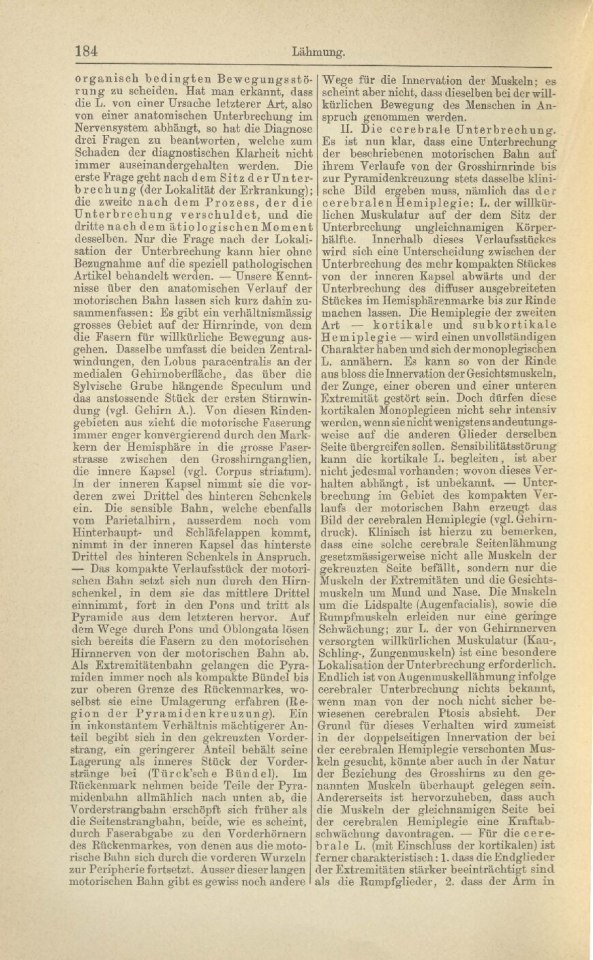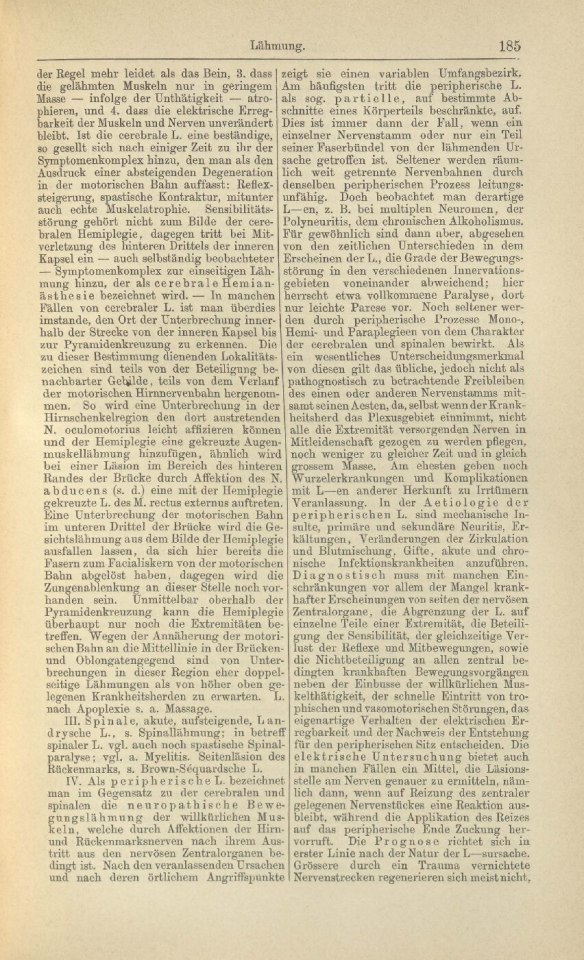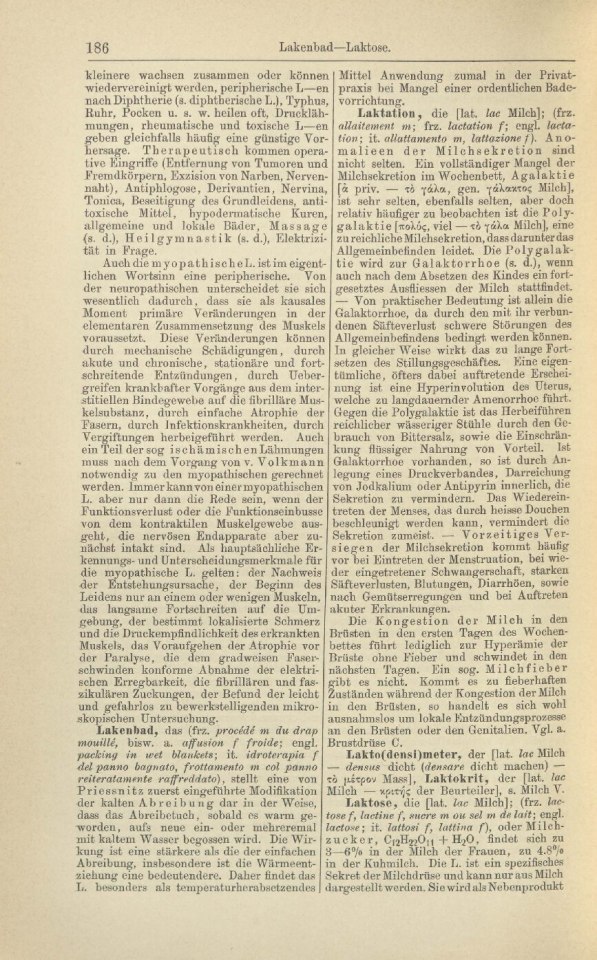S.
Lähmung, die (frz. paralysie f [motrice];
engl. paralysis, auch palsy; it. paralisi f).
Unter L. (der motorischen Teile) versteht
man die Aufhebung des Vermögens, durch
Willenseinfluss eine Bewegung zu erzeugen.
Ist dieselbe eine absolute oder hochgradige,
so wird sie als Paralyse, sonst als Pa-
rese, motorische Schwäche, bezeichnet. Je
nach dem Orte ihrer Entstehung spricht
man von cerebraler, spinaler und peri-
pherischer L. Wiewohl eine durch genuine
Erkrankung der Muskeln und Gelenke auf-
gehobene Beweglichkeit gleichzeitig mit L.
also wird die Ausdrücke L. doch sehr nur
mit Bezug auf das Nervensystem gebraucht.
Eine L. vom Nervensystem abzuleiten ist,
kann von zwei verschiedenen Arten von Ver-
änderung in demselben herrühren: erstens
von einer Funktionseinstellung gewisser für
die Entstehung der Bewegung wichtiger Hirn-
teile, und zweitens von einer durch ana-
tomische Verhältnisse gegebenen Unter-
brechung der motorischen Leitung. Die
Veränderung der ersteren Art wird sich
durch keinerlei Methoden der anatomischen
Untersuchung nachweisen lassen, sie ist eine
rein funktionelle; die andere, sog. organische
Veränderung muss als nachweisbar ange-
nommen werden, ob sie nun bereits in die
Tragweite der von uns zum Nachweis ver-
wendeten Methoden fällt oder nicht.
I. Die rein funktionellen L. en sind
uns erst in sehr geringem Umfange bekannt.
Es ist möglich, dass wir dieselben an ver-
schiedenen Stellen des Nervensystems wer-
den lokalisieren dürfen; gegenwärtig kennen
wir aber genauer blos die **hysterische**
L., bei welcher wir die Funktionseinstellung
in die psychischen Funktionen dienenden Teile
des Grosshirns verlegen können. Aus dieser
Stelle sind nur die allgemeinsten Charaktere
hysterischer L. en zu erwähnen: Die hyste-
rische L. hat gewisse Aehnlichkeiten mit der
später als kortikal beschrieben, zeichnet
sich aber dadurch aus, dass sie kein Abbild
der anatomischen Verhältnisse des Nerven-
systems liefert, sondern sich nach den Be-
grenzungen der Körperteile, wie sie uns
durch die gemeine sinnliche Wahrnehmung
bekannt sind, richtet, dass sie auf einen
Körperteil leicht den höchsten Grad erreicht
(Absolutheit), ohne auf einen anderen Teil der
Körperperipherie überzugreifen (Ausschliess-
lichkeit), dass sie nie einzelne Teile be-
fällt, die bloss eine anatomische Selbständig-
keit besitzen, sondern stets ganze Apparate,
insofern sie bestimmten Funktionen dienen.
Die hysterische L. ist in der That keine L.
vom Körperlichen, sondern eine Aufhebung
von Funktionen, oder sie besteht in einem
Abhandenkommen eines ganzen Gliedes für
die Willen und die Vorstellung des Kranken.
Von der hysterischen L. ergriffen werden
am häufigsten: einzelne Extremitäten, gleich-
namige Extremitäten oder beide Extremi-
täten einer Seite und der Sprachapparat,
die Gesichtsmuskulatur, welche die feinsten
Anzeichen bei L. en organischer Natur
liefert, leidet fast nie bei der Hysterie. Ueber-
dies ist für die hysterische L. charakteristisch,
dass die Störungen der Sensibilität in der
Regel die Motilitätsstörung an In- und Ex-
tensität überwiegen, was bei organischen
Läsionen nur ausnahmsweise vorkommt (s. a.
Hysterie IV, 2 und 3).
Es ist der wichtigste Schritt in der Dia-
gnose einer L., die funktionelle von der
S.
organisch bedingten Bewegungsstö-
rung zu scheiden. Hat man erkannt,
dass die L. von einer Art, die L. von einer
anatomischen Unterbrechung im
Nervensystem abhängt, so hat die Diagnose
drei Fragen zu beantworten, welche zum
Schaden der diagnostischen Klarheit nicht
immer auseinandergehalten werden. Die
erste Frage geht nach dem Sitz der Unter-
brechung (der Lokalität der Erkrankung);
die zweite nach dem Prozess, der die
Unterbrechung verschuldet, und die
dritte nach dem ätiologischen Moment
desselben. Nur die Frage nach der Lokali-
sation der Unterbrechung kann hier ohne
Bezugnahme auf die speziell pathologischen
Artikel behandelt werden. Unsere Kennt-
nisse über den anatomischen Verlauf der
motorischen Bahn lassen sich kurz dahin zu-
sammenfassen: Es gibt ein verhältnismässig
grosses Gebiet auf der Hirnrinde, von dem
die Fasern für willkürliche Bewegung aus-
gehen. Dasselbe umfasst die beiden Zentral-
windungen, den **Lobus paracentralis** an der
medianen Gehirnoberfläche, das über die
**Sylvische Grube** hängende **Speculum** und
das anstossende Stück der ersten Stirnwin-
dung (vgl. Gehirn A.). Von diesen Rinden-
gebieten aus zieht die motorische Faserung
immer enger konvergierend durch den Mark-
kern der Hemisphäre in die grosse Faser-
strasse zwischen den Grosshirnganglien,
die **innere Kapsel** (vgl. **Corpus striatum**).
In der inneren Kapsel nimmt sie die vor-
deren zwei Drittel des hinteren Schenkels
ein. Die sensible Bahn, welche eben-
falls vom **Parietalhirn**, ausserdem noch vom
Hinterhaupt- und Schläfenlappen kommt,
nimmt in der inneren Kapsel das hintere
Drittel des hinteren Schenkels in Anspruch.
Der kompakte Verlaufstück der motori-
schen Bahn setzt sich nun durch den Hirn-
schenkel in dem sie das mittlere Drittel
einnimmt, fort in den **Pons** und tritt als
Pyramide aus dem letzteren hervor. Auf
dem Wege durch Pons und Oblongata lösen
sich bereits die Fasern zu den motorischen
Hirnnerven von der motorischen Bahn ab.
Als Extremitätenbahn gelangen die Pyra-
miden immer noch als kompaktes Bündel bis
zur oberen Grenze des Rückenmarks, wo-
selbst sie eine Umlagerung erfahren (Re-
gion der **Pyramidenkreuzung**). Ein
in inkonstantem Verhältnis mächtigerer An-
teil begibt sich in den gekreuzten Vorder-
strang, ein geringerer Anteil behält seine
Lagerung als inneres Stück des Vorder-
stränges bei (Türk’sches Bündel). Im
Rückenmark nehmen beide Teile der Pyra-
midenbahn allmählich nach unten ab, die
Vorderstrangbahn erschöpft sich früher als
die Seitenstrangbahn, beide, wie es scheint,
durch Faserabgabe zu den Vorderhörnern
des Rückenmarks, von denen aus die moto-
rische Bahn sich durch die vorderen Wurzeln
zur Peripherie fortsetzt. Ausser dieser langen
motorischen Bahn gibt es gewiss noch andere
Wege für die Innervation der Muskeln; es
scheint aber nicht, dass dieselben bei der will-
kürlichen Bewegung des Menschen in An-
spruch genommen werden.
II. Die **cerebrale Unterbrechung**.
Es ist nun klar, dass eine Unterbrechung
der beschriebenen motorischen Bahn auf
ihrem Verlaufe von der Grosshirnrinde bis
zur Pyramidenkreuzung stets dasselbe klini-
sche Bild ergeben muss, nämlich das der
**cerebralen Hemiplegie**: L. der willkür-
lichen Muskulatur auf dem Sitz der
Unterbrechung ungleichnamigen Körper-
hälfte. Innerhalb dieses Verlaufstückes
wird sich eine Unterscheidung zwischen der
Unterbrechung des mehr kompakten Stückes
von der inneren Kapsel abwärts und der
Unterbrechung des diffuser ausgebreiteten
Stückes im Hemisphärenmarke bis zur Rinde
machen lassen. Die Hemiplegie der zweiten
Art — kortikale und subkortikale
Hemiplegie — wird einen unvollständigen
Charakter haben und sich der monoplegischen
L. annähern. Es kann so von der Rinde
aus bloss die Innervation der Gesichtsmuskeln,
der Zunge, einer oberen und einer unteren
Extremität gestört sein. Doch dürfen diese
kortikalen Monoplegien nicht sehr intensiv
werden, wenn nicht wenigstens Andeutungs-
weise auf die anderen Glieder derselben
Seite übergreifen sollen. Sensibilitätsstörung
kann die kortikale L. begleiten, ist aber
nicht jedesmal vorhanden, wovon dieses Ver-
halten abhängt, ist unbekannt. Unter-
brechung im Gebiet des kompakten Ver-
laufs der motorischen Bahn erzeugt das
Bild der **cerebralen Hemiplegie** (vgl. Gehirn-
druck). Klinisch ist hierzu zu bemerken,
dass eine solche cerebrale Seitenlähmung
gesetzmässigerweise nicht alle Muskeln der
gekreuzten Seite befällt, sondern nur die
Muskeln der Extremitäten und die Gesichts-
muskeln um Mund und Nase. Die Muskeln
um die Lidspalte (Augenfacialis), sowie die
Rumpfmuskeln erleiden nur eine geringe
Schwächung, zur L. der von Gehirnnerven
versorgten willkürlichen Muskulatur (Kau-
Schling-, Zungenmuskeln) ist eine besondere
Lokulisation der Unterbrechung erforderlich.
Endlich ist von Augenmuskellähmung infolge
cerebraler Unterbrechung nichts bekannt,
wenn man von der noch nicht sicher be-
wiesenen **cerebralen Ptosis** absieht. Der
Grund für dieses Verhalten wird zumeist
in der doppelseitigen Innervation der bei der
cerebralen Hemiplegie verschonten Mus-
keln gesucht, könnte aber auch in der Natur
der Beziehung des Grosshirns zu den ge-
nannten Muskeln überhaupt gelegen sein.
Andererseits ist hervorzuheben, dass auch
die Muskeln der gleichnamigen Seite bei
der cerebralen Hemiplegie eine Kraftab-
schwächung davontragen. Für die **cere-
brale L.** (mit Einschluss der kortikalen) ist
ferner charakteristisch: 1. dass die Endglieder
der Extremitäten stärker beeinträchtigt sind
als die Rumpfglieder, 2. dass der Arm in
S.
der Regel mehr leidet als das Bein, 3. dass
die gelähmten Muskeln nur in geringem
Masse infolge der Unthätigkeit atro-
phieren, und 4. dass die elektrische Erreg-
barkeit der Muskeln und Nerven unverändert
bleibt. Ist die cerebrale L. eine beständige,
so gesellt sich nach einiger Zeit zu ihr der
Symptomenkomplex hinzu, der als den
Ausdruck einer absteigenden Degeneration
in der motorischen Bahn auffasst: Reflex-
steigerung, spastische Kontraktur, mitunter
auch echte Muskelatrophie. Sensibilitäts-
störung gehört nicht zum Bilde der zere-
bralen Hemiplegie, dagegen tritt bei Mit-
verletztung des hinteren Drittels der inneren
Kapsel ein — auch selbständig beobachteter
Symptomenkomplex zur einseitigen Lähmung
hinzu, der als zerebrale Hemiästhesie
bezeichnet wird. In manchen Fällen von
cerebraler L. ist man überdies imstande,
den Ort der Unterbrechung innerhalb der
Strecke von der inneren Kapsel bis zur
Pyramidenkreuzung zu erkennen. Die zu
dieser Bestimmung dienenden Lokalisations-
zeichen sind teils von der Beteiligung be-
nachbarter Gebilde, teils von dem Verlauf
der motorischen Hirnnervenbahn hergenommen.
So wird eine Unterbrechung in der Hirnschenkel-
region den dort austretenden **N. oculomotorius**
leicht affizieren können und der Hemiplegie
eine gekreuzte Augenmuskellähmung hinzufügen;
ähnlich wird bei einer Läsion im Bereich des
hinteren Randes der Brücke durch Affektion
des **N. abducens** (s. d.) eine mit der Hemiplegie
gekreuzte des **M. rectus externus** auftreten.
Eine Unterbrechung der motorischen Bahn
im unteren Drittel der Brücke wird die Ge-
sichtslähmung aus dem Bilde der Hemiplegie
ausfallen lassen, da sich hier bereits die
Fasern zum Facialiskern von der motorischen
Bahn abgelöst haben, dagegen wird die
Zungenablenkung an dieser Stelle noch vor-
handen sein. Unmittelbar oberhalb der
Pyramidenkreuzung kann die Hemiplegie
überhaupt nur noch die Extremitäten be-
treffen. Wegen der Annäherung der motorischen
Bahn an die Mittellinie in der Brücken-
und Oblongatengegend sind von Unter-
brechungen in dieser Region eher doppel-
seitige Lähmungen als von höher oben ge-
legenen Krankheitsherden zu erwarten.
L. nach **Apoplexie** s. a. **Massage**.
III. **Spinale, akute, aufsteigende, Landry’sche L.**
s. **Spinallähmung**; in betreff spinaler L.
vgl. auch noch **spastische Spinal-Paralyse**;
vgl. a. **Myelitis**, **Seitenläsion des Rückenmarks**.
IV. **Peripherische L.** bezeichnet
man im Gegensatz zu der zerebralen und
spinalen die neuropathetische Bewegungs-
lähmung der willkürlichen Muskeln, welche
durch Affektionen der Hirn- und Rücken-
marksnerven nach ihrem Austritt aus den
nervösen Zentralorganen bedingt ist. Nach
den veranlassenden Ursachen und nach
deren örtlichem Angriffspunkte
zeigt sie einen variablen Umfangbezirk.
Am häufigsten tritt die periphere L.
als sog. Partialie, auf bestimmte Ab-
schnitte eines Körperteiles beschränkte, auf.
Dies ist immer dann der Fall, wenn ein
einzelner Nervenstamm oder nur ein Teil
seiner Faserbündel von der lähmenden Ur-
sache getroffen ist. Seltener werden Raum-
lich weit getrennte Nervenbahnen durch
denselben peripherischen Prozess leitungs-
unfähig. Doch beobachtet man derartige
L-
z. B. bei multiplen Neuromen, der
Polyarteriitis, dem chronischen Alkoholismus.
Für gewöhnlich sind dann aber abgesehen
von den zeitlichen Unterschieden in dem
Erscheinen der L., die Grade der Bewegungs-
störung in den verschiedenen Innervations-
gebieten voneinander abweichend, hier
herrscht etwa vollkommene Paralyse, dort
nur leichte Parese vor. Noch seltener wer-
den durch peripherische Prozesse Mon-,
Hemi- und Paraplegieen von dem Charakter
der cerebralen und spinalen bewirkt. Als
ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal
von diesen gilt das übliche, jedoch nicht als
pathognostisch zu betrachtende Freibleiben
des einen oder anderen Nervenstammes mit
samt seinen Ästen da, selbst wenn der Krank-
heitsherd das Plexusgebiet einnimmt, nicht
alle die Extremität versorgenden Nerven in
Mitleidenschaft gezogen, zu werden pflegen,
noch weniger zu gleicher Zeit und in gleich
grosser Masse. Am ehesten gehen noch
Wurzel
erkrankungen und Komplikationen
mit an anderer Herkunft zu irrtümlichen
Veranlassung. In der Ätiologie der
peripherischen L. sind mechanische In-
sulte, primäre und sekundäre Neuritis, Er-
kältungen, Veränderungen der Zirkulation
und Blutmischung, Gifte, akute und chro-
nische Infektionskrankheiten anzuführen.
Diagnostisch muss mit manchen Ein-
schränkungen vor allem der Mangel kraft-
haften Erscheinungen von seiten der nervösen
Centralorgane, die Abgrenzung der L. auf
einzelne Teile einer Extremität, die Beteili-
gung der Sensibilität, der gleichzeitige Ver-
lust der Reflexe und Mitbewegungen, sowie
die Nichtbeteiligung an allen central be-
dingten Krankhaften Bewegungsvorgängen
neben den
Em
der willkürlichen Mus-
keltätigkeit, der schnelle Eintritt von Tro-
phischen und vasomotorischen Störungen, das
eigenartige Verhalten der elektrischen Er-
regbarkeit und der Nachweis der Entartung
für den peripherischen Sitz entscheiden. Die
elektrische Untersuchung bietet auch
in manchen Fällen ein Mittel, die Läsions-
stelle am Nerven genauer zu ermitteln, näm-
lich dann, wenn auf Reizung des zentraler
gelegenen Nervenstückes eine Reaktion aus-
bleibt, während die Applikation des Reizes
auf das peripherische Ende Zuckung her-
vorruft. Die Prognose richtet sich in
erster Linie nach der Natur der Läsionsur-
sache.
Grössere durch ein Trauma vernichtete
Nerv
en
strecken regenerieren sich meist nicht,
S.
kleinere wachsen zusammen oder können
wiedervereint werden, peripherische L-
nach Diphtherie (s. diphtherische L.), Typhus,
Ruhr, Pocken u. s. w. heilen oft, Druckläh-
mungen, rheumatische und toxische L-en
geben gleichfalls häufig eine günstige Vor-
hersage. Therapeutisch kommen opera-
tive Eingriffe (Entfernung von Tumoren und
Fremdkörpern, Exzision von Narben, Nerven-
naht), Antiphlogose, Derivantien, Nervina,
Tonica, Beseitigung des Grundleidens, anti-
toxische Mittel, hypodermatische Kuren,
allgemeine und lokale Bäder, Massage
(s. d.), Heilgymnastik (s. d.), Elektrizi-
tät in Frage.
Auch die myopathische L. ist im eigent-
lichen Wortsinn eine peripherische. Von
der neuropathischen unterscheidet sie sich
wesentlich dadurch, dass sie als kausales
Moment, primäre Veränderungen in der
elementaren Zusammensetzung des Muskels
voraussetzt. Diese Veränderungen können
durch mechanische Schädigungen, durch
akute und chronische, stationäre und fort-
schreitende Entzündungen, durch Ueber-
greifen krankhafter Vorgänge aus dem inter-
stitiellen Bindegewebe auf die fibrilläre Mus-
kelsubstanz, durch einfache Atrophie der
Fasern, durch Infektionskrankheiten, durch
Vergiftungen herbeigeführt werden. Auch
ein Teil der sog. ischämischen Lähmungs-
miss nach dem Vorgang von Volkmann
notwendig zu den myopathischen gerechnet
werden. Immer kann von einer myopathischen
L. aber nur dann die Rede sein, wenn der
Funktionsverlust oder die Funktionseinbusse
von dem kontraktilen Muskelgewebe aus-
geht, die nervösen Endapparate aber zu-
nächst intakt sind. Als hauptsächliche Er-
kennungs- und Unterscheidungsmerkmale für
die myopathische L. gelten: der Nachweis
der Entstehungsursache, der Beginn des
Leidens nur an einem oder wenigen Muskeln,
das langsame Fortschreiten auf die Um-
gebung, der bestimmt lokalisierte Schmerz
und die Druckempfindlichkeit des erkrankten
Muskels, das vorausgehende Atrophie vor
der Paralyse, die dem gradweisen Faser-
schwinden konforme Abnahme der elektri-
schen Erregbarkeit, die fibrillären und fas-
zikulären Zuckungen, der Befund der leicht
und gefahrlos zu bewerkstelligenden mikro-
skopischen Untersuchung.
183
–186