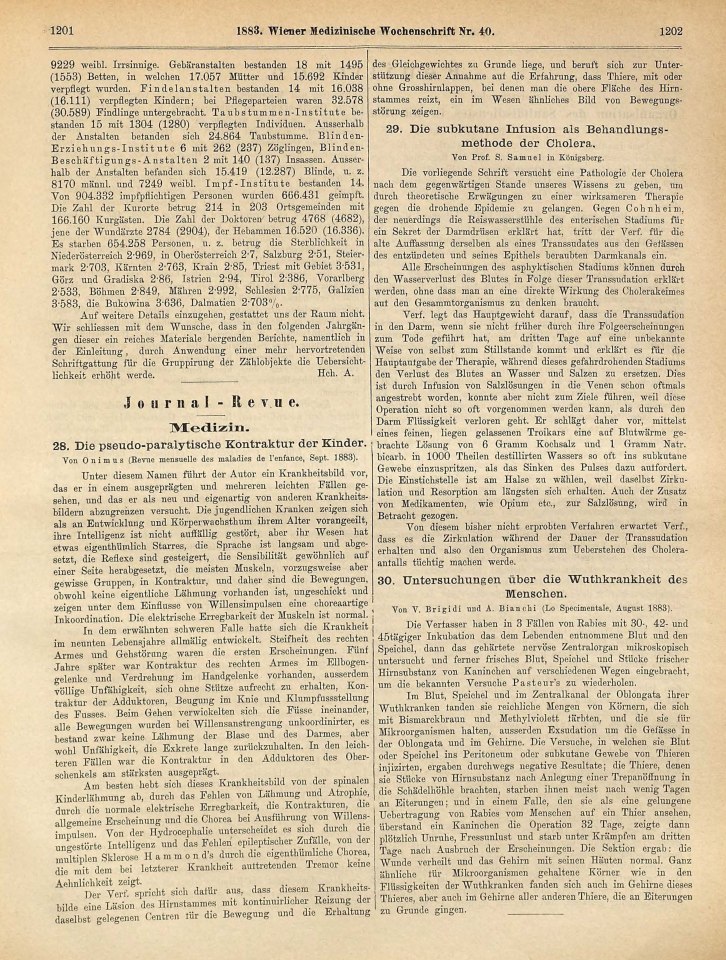S.
Medizin.
28. Die pseudo-paralytische Kontraktur der Kinder.
Von O n i m u s (Revue mensuelle des maladies de l’enfance, Sept. 1883).
Unter diesem Namen führt der Autor ein Krankheitsbild vor, das er in einem
ausgeprägten und mehreren leichten Fällen gesehen, und das er als neu
und eigenartig von anderen Krankheitsbildern abzugrenzen versucht. Die
jugendlichen Kranken zeigen sich als an Entwicklung und Körperwachsthum
ihrem Alter vorangeeilt, ihre Intelligenz ist nicht auffällig gestört, aber ihr
Wesen hat etwas eigenthümlich Starres, die Sprache ist langsam und abgesetzt,
die Reflexe sind gesteigert, die Sensibilität gewöhnlich auf einer Seite
herabgesetzt, die meisten Muskeln, vorzugsweise aber gewisse Gruppen, in
Kontraktur, und daher sind die Bewegungen, obwohl keine eigentliche Lähmung
vorhanden ist, ungeschickt und zeigen unter dem Einflusse von Willensimpulsen
eine choreaartige Inkoordination. Die elektrische Erregbarkeit
der Muskeln ist normal.
In dem erwähnten schweren Falle hatte sich die Krankheit im neunten Lebensjahre
allmälig entwickelt. Steifheit des rechten Armes und Gehstörung
waren die ersten Erscheinungen. Fünf Jahre später war Kontraktur des rechten Armes im Ellbogengelenke und Verdrehung im Handgelenke vorhanden,
ausserdem völlige Unfähigkeit, sich ohne Stütze aufrecht zu erhalten,
Kontraktur der Adduktoren, Beugung im Knie und Klumpfussstellung des
Fusses. Beim Gehen verwickelten sich die Füsse ineinander, alle Bewegungen
wurden bei Willensanstrengung unkoordinirter, es bestand zwar keine
Lähmung der Blase und des Darmes, aber wohl Unfähigkeit, die Exkrete
lange zurückzuhalten. In den leichteren Fällen war die Kontraktur in den
Adduktoren des Oberschenkels am stärksten ausgeprägt.
Am besten hebt sich dieses Krankheitsbild von der spinalen Kinderlähmung
ab, durch das Fehlen von Lähmung und Atrophie, durch die normale
elektrische Erregbarkeit, die Kontrakturen, die allgemeine Erscheinung und
die Chorea bei Ausführung von Willensimpulsen. Von der Hydrocephalie
unterscheidet es sich durch die ungestörte Intelligenz und das Fehlen epileptischer
Zufälle, von der multiplen Sklerose H a m m o n d ’ s durch die
eigenthümliche Chorea, die mit dem bei letzterer Krankheit auftretenden
Tremor keine Aehnlichkeit zeigt.
Der Verf. spricht sich dafür aus, dass diesem Krankheitsbilde eine Läsion
des Hirnstammes mit kontinuirlicher Reizung der daselbst gelegenen
Centren für die Bewegung und die Erhaltung des Gleichgewichtes
zu Grunde liege, und beruft sich zur Unterstützung dieser Annahme auf
die Erfahrung, dass Thiere, mit oder ohne Grosshirnlappen, bei denen man
die obere Fläche des Hirnstammes reizt, ein im Wesen ähnliches Bild von
Bewegungsstörung zeigen.
1201
–1202