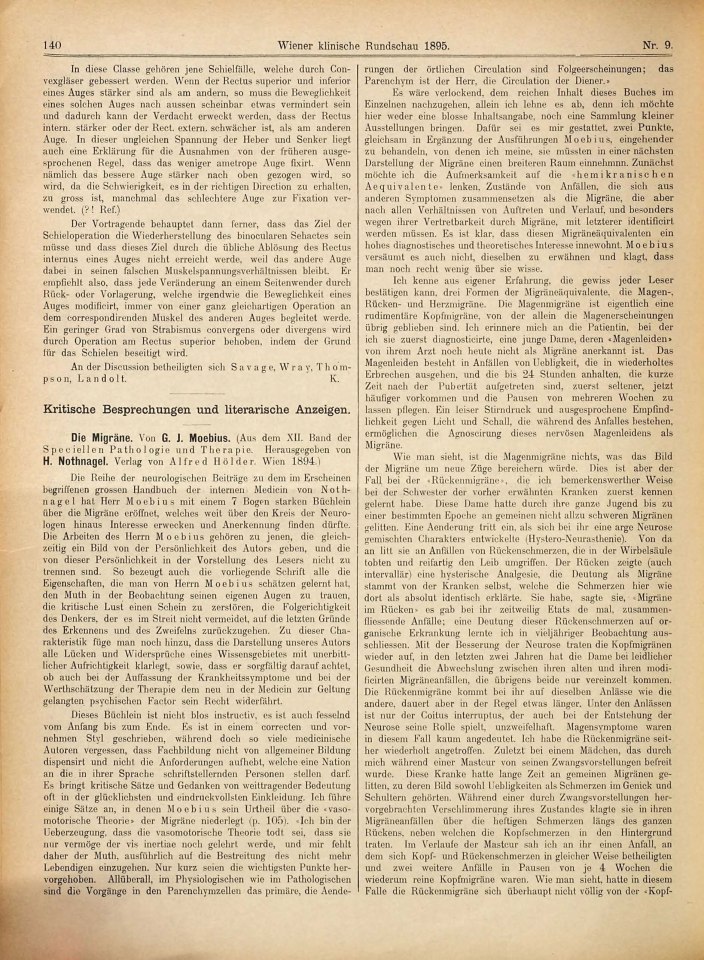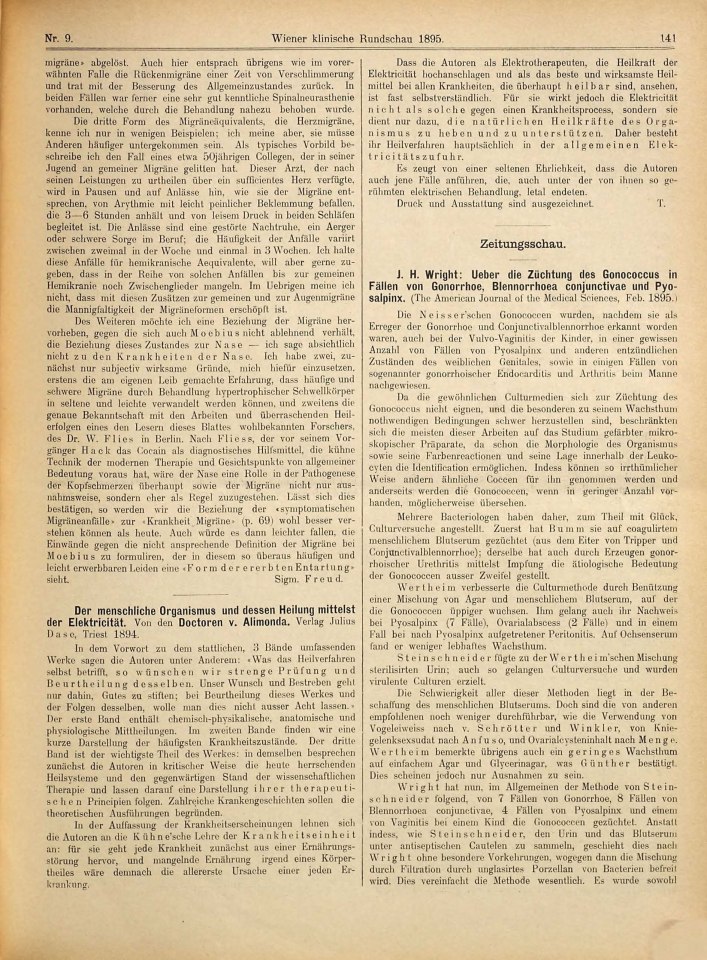S.
Kritische Besprechungen und literarische Anzeigen.
Die Migräne. Von G. J. Moebius. (Aus dem XII. Band der
Speciellen Pathologie und Therapie. Herausgegeben von
H. Nothnagel. Verlag von Alfred Hölder. Wien 1894.)Die Reihe der neurologischen Beiträge, die zu dem im Erscheinen
begriffenen grossen Handbuch der inneren Medicin von Noth-
nagel hat Herr Moebius mit einem 7 Bogen starken Büchlein
über die Migräne eröffnet, welches weit über den Kreis der Neuro-
logen hinaus Interesse erwecken und Anerkennung finden dürfte.
Die Arbeiten des Herrn Moebius gehören zu jenen, die gleich-
zeitig ein Bild von der Persönlichkeit des Autors geben, und die
von dieser Persönlichkeit in der Vorstellung des Lesers nicht zu
trennen sind. So bezeugt auch die vorliegende Schrift alle die
Eigenschaften, die man von Herrn Moebius schätzen gelernt hat,
den Muth in der Beobachtung seinen eigenen Augen zu trauen,
die kritische Lust einen Schein zu zerstören, die Folgerichtigkeit
des Denkens, der es im Streit nicht vermeidet, auf die letzten Gründe
des Erkennens und des Zweifelns zurückzugehen. Zu dieser Cha-
rakteristik füge man noch hinzu, dass die Darstellung unseres Autors
alle Lücken und Widersprüche eines Wissensgebietes mit unerbit-
tlicher Aufrichtigkeit klarlegt, sowie, dass er sorgfältig darauf achtet,
ob auch bei der Auffassung der Krankheitssymptome und bei der
Werthschätzung der Therapie dem neu in der Medicin zur Geltung
gelangten psychischen Factor sein Recht widerfährt.
Dieses Büchlein ist nicht blos instructiv, es ist auch fesselnd
vom Anfang bis zum Ende. Es ist in einem correcten und vor-
nehmen Styl geschrieben, während doch so viele medicinische
Autoren vergessen, dass Fachbildung nicht von allgemeiner Bildung
dispensirt und nicht die Anforderungen aufhebt, welche eine Nation
an die in ihrer Sprache schriftstellernden Personen stellen darf.
Es bringt kritische Sätze und Gedanken von weittragender Bedeutung
oft in der glücklichsten und eindrucksvollsten Einkleidung. Ich führe
einige Sätze an, in denen Moebius sein Urtheil über die «vaso-
motorische Theorie» der Migräne niederlegt (p. 105). «Ich bin der
Ueberzeugung, dass die vasomotorische Theorie todt sei, dass sie
nur vermöge der **vis inertiae** noch gelehrt werde, und mir fehlt
daher der Muth, ausführlich auf die Bestreitung des nicht mehr
Lebendigen einzugehen. Nur kurz seien die wichtigsten Punkte her-
vorgehoben. Allüberall, im physiologischen wie im Pathologischen
sind die Vorgänge in den Parenchymzellen das primäre, die Aende-rungen der örtlichen Circulation sind Folgeerscheinungen; das
Parenchym ist der Herr, die Circulation der Diener.»
Es wäre verlockend, dem reichen Inhalt dieses Buches im
Einzelnen nachzugehen, allein ich lehne es ab, denn ich möchte
hier weder eine blosse Inhaltsangabe, noch eine Sammlung kleiner
Ausstellungen bringen. Dafür sei es mir gestattet, zwei Punkte,
gleichsam in Ergänzung der Ausführungen **Moebius'** einzulegen,
zu behandeln, von denen ich meine, sie müssten in einer nächsten
Darstellung der Migräne einen breiteren Raum einnehmen. Zunächst möchte ich die Aufmerksamkeit auf die «hemikranischen
Aequivalente» lenken, Zustände von Anfällen, die sich aus
anderen Symptomen zusammensetzen als der Migräne, die aber
nach allen Verhältnissen von Auftreten und Verlauf, und besonders
wegen ihrer Vertretbarkeit durch Migräne, mit letzterer identisch
werden müssen. Es ist klar, dass dieser Migräne-Aequivalenten ein
hohes diagnostisches und theoretisches Interesse innewohnt. **Moebius**
versäumt es auch nicht, dieselben zu erwähnen und klagt, dass
man noch recht wenig über sie wisse.
Ich kenne aus eigener Erfahrung, die gewiss jeder Leser
bestätigen kann, drei Formen der Migräne-Aequivalente, die Magen-,
Rücken- und Herzmigräne. Die Magenmigräne ist eine allbekannte,
rudimentäre Kopfmigräne, von der allein die Magenerscheinungen
übrig geblieben sind. Ich erinnere mich an die Patientin, bei der
ich sie zuerst diagnostizirte, eine junge Dame, deren Magenleiden
von ihrem Arzt noch heute nicht als Migräne anerkannt ist. Das
Magenleiden besteht in Anfällen von Unwohlsein, die in wiederholte
Erbrechen ausziehen, und die bis 24 Stunden anhalten, die kurze
Zeit nach der Pubertät aufgetreten sind, zuerst seltener, jetzt
häufiger vorkommen und die Pausen von mehreren Wochen an
lassen pflegen. Ein leiser Stirndruck und ausgesprochene Empfind-
lichkeit gegen Licht und Schall, die während des Anfalles bestehen,
ermöglichen die **Agnoscirung** dieses «nervösen Magenleidens» als
Migräne.
Wie man sieht ist die Magenmigräne nichts, was das Bild
der Migräne um einen **Zufuss** bereichern würde. Dies ist aber der
Fall bei der «Rückenmigräne», die ich bemerkenswerther Weise
bei der Schwester der vorher erwähnten Kranken zuerst kennen
gelernt habe. Diese Dame hatte durch ihre ganze Jugend bis zu
einer bestimmten Epoche an gemeinen nicht allzu schweren Migränen
gelitten. Reine **Aequivalente** traten als sich bei ihr eine an **Neurosen-**
**genese** entwickelte (Hystero-Neurasthenie). Von da
an litt sie an Anfällen von Rückenschmerzen, die in der Wirbelsäule
lebten und anfangs den Leib umgriffen. Der Rücken zeigte (auch
interanfällig) eine hysterische Anästhesie. Die Deutung als Migräne
stammt von der Kranken selbst, welche die Schmerzen für wie
doch als absolut identisch erklärte, die sie hatte, sagte sie, Migräne
im Rücken; es gab bei ihr zeitweilig eine, die sich mit **Moebius**
flosse: als **Aequivalent** deutete, diese Rückenschmerzen auf or-
ganische Erkrankung lernte, ich in vieljähriger Beobachtung aus-
schliessen. Mit der Besserung der Neurose traten die Kopfmigränen
wieder auf in den letzten zwei Jahren hat die Dame bei leidlicher
Gesundheit die Abwechslung zwischen ihren alten und ihren modi-
fizirten Migräneanfällen, die übrigens beide nur vereinzelt kommen.
Die Rückenmigräne kommt bei ihr auf dieselben Anlässe wie die
anderen, dauernd über der Regel, etwa 2 Tage. Unter den Anlässen
ist nur der **Coitus interruptus**, der auch bei der Entstehung der
Neurose seine Rolle gespielt, unzweifelhaft. Magen-Symptome waren
in diesem Fall kaum anzudeuten. Ich habe die Rückenmigräne seit-
her wiederholt angetroffen. Zuletzt bei einem Mädchen, das durch
nicht während einer Misur von sonstigen Zwangsvorstellungen geheilt
wurde. Diese Kranke hatte lange Zeit an gemeinen Migränen ge-
litten, zu deren Bild sowohl Uebelkeiten als Schmerzen im Genick und
Schultern gehören. Während einer durch Zwangsvorstellungen her-
vorgebrochenen Verschlimmerung ihres Zustandes klagte sie in ihren
Migräneanfällen über die heftigen Schmerzen längs des ganzen
Rückens, neben welchen die Kopfschmerzen in den Hintergrund
traten. Im Verlauf der **Misur** sah ich an ihr einen Anfall, an
dem sich Kopf- und Rückenschmerzen in gleicher Weise betheiligten
und zwei weitere Anfälle, in Pausen von je 4 Wochen, die
wiederum reine Kopfmigräne waren. Wie man sieht, hatte in diesem
Falle die Rückenmigräne sich überhaupt nicht völlig von der «Kopf-S.
migräne» abgelöst. Auch hier entsprach übrigens wie im vorer-
wähnten Falle die Rückenmigräne einer Zeit von Verschlimmerung
und trat mit der Besserung des Allgemeinzustandes zurück. In
beiden Fällen war ferner eine sehr gut kenntliche Spinalneurasthenie
vorhanden, welche durch die Behandlung nahezu behoben wurde.
Die dritte Form des Migräneäquivalents, die Herzmigräne,
kenne ich nur in wenigen Beispielen; ich meine aber, sie müsse
anderen häufiger untergekommen sein. Als typisches Vorbild be-
schreibe ich den Fall eines etwa 50jährigen Collegen, der in seiner
Jugend an gemeiner Migräne gelitten hat. Dieser Arzt, der nach
seinen Leistungen zu urtheilen über ein sufficientes Herz verfügte,
wird in Pausen und auf Anlässe hin, wie sie der Migräne ent-
sprechen, von Arrhythmie mit leicht peinlicher Beklemmung befallen,
die 3–6 Stunden anhält und von leisem Druck in beiden Schläfen
begleitet ist. Die Anlässe sind eine gestörte Nachtruhe, ein Aerger
oder schwere Sorge im Beruf; die Häufigkeit der Anfälle variirt
zwischen zweimal in der Woche und einmal in 3 Wochen. Ich halte
diese Anfälle für hemikranische Aequivalente, will aber gerne zu-
geben, dass in der Reihe von solchen Anfällen bis zur gemeinen
Hemikranie noch Zwischenglieder mangeln. Im Uebrigen meine ich
nicht, dass mit diesen Zusätzen zur gemeinen und zur Augenmigräne
die Mannigfaltigkeit der Migräneformen erschöpft ist.
Des Weiteren möchte ich eine Beziehung der Migräne her-
vorheben, gegen die sich auch **Moebius** nicht ablehnend verhält,
die Beziehung dieses Zustandes zur **Nase**. Ich habe absichtlich
nicht zu den Krankheiten der Nase – ich habe zwei, zu-
nächst nun subjectiv wirksame Gründe, mich hierfür einzusetzen:
erstens, die am eigenen Leib gemachte Erfahrung, dass häufige und
schwere Migräne durch Behandlung hypertrophischer Schwellkörper
in seltene und leichte verwandelt werden können, und zweitens, die
genaue Bekanntschaft mit den Arbeiten und überraschenden Heil-
erfolgen eines den Lesern dieses Blattes wohlbekannten Forschers,
Des Dr. W. Fliess in Berlin. Nach Fliess, der vor seinem Vor-
gänger Hack das Cocain als diagnostisches Hilfsmittel, die kühne
Technik der modernen Therapie und Gesichtspunkte von allgemeiner
Bedeutung voraus hat, wäre der Nase eine Rolle in der Pathogenese
der Kopfschmerzen überhaupt sowie der Migräne nicht nur aus-
nahmsweise, sondern eher als Regel zuzugestehen. Lässt sich dies
bestätigen, so werden wir die Beziehung der «symptomatischen
Migräneanfälle» zur «Krankheit Migräne» (p. 69) wohl besser ver-
stehen können als heute. Auch würde es dann leichter fallen, die
Einwände gegen die nicht ansprechende Definition der Migräne bei
Moebius zu formuliren, der in diesem so überaus häufigen und
leicht erwerbbaren Leiden eine «Form der ererbten Entartung»
sieht.
Sigm. Freud.
bsb11506714
140
–141