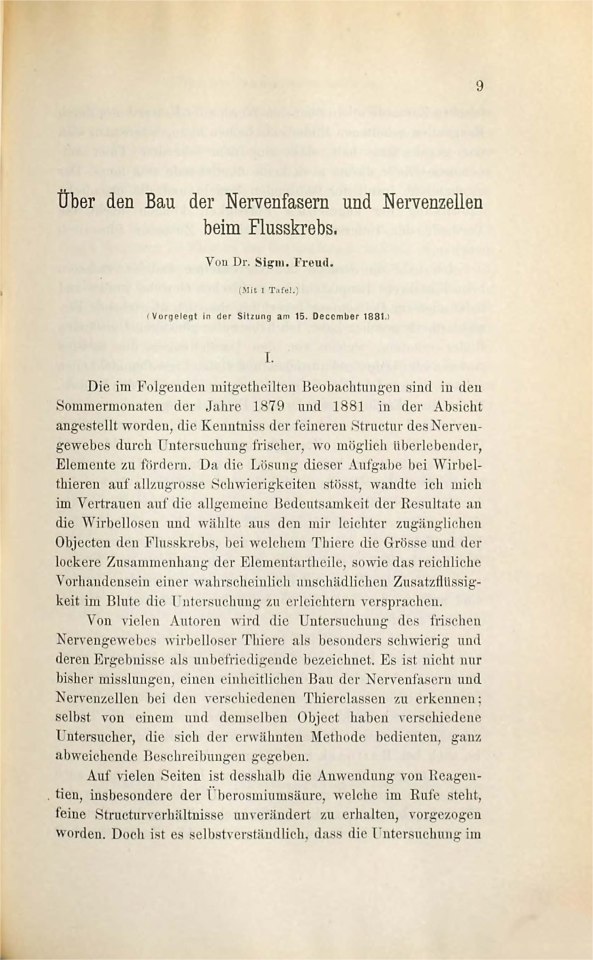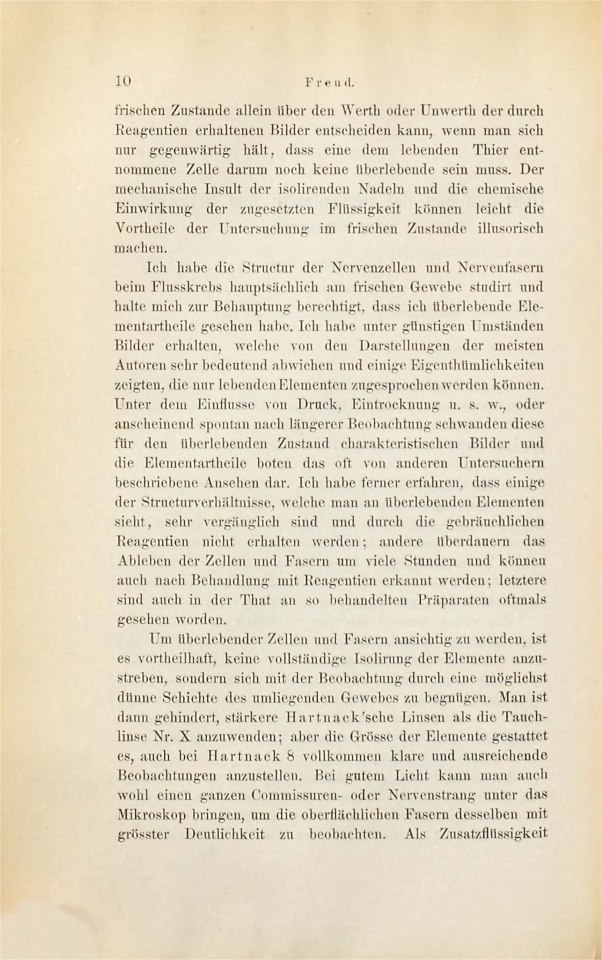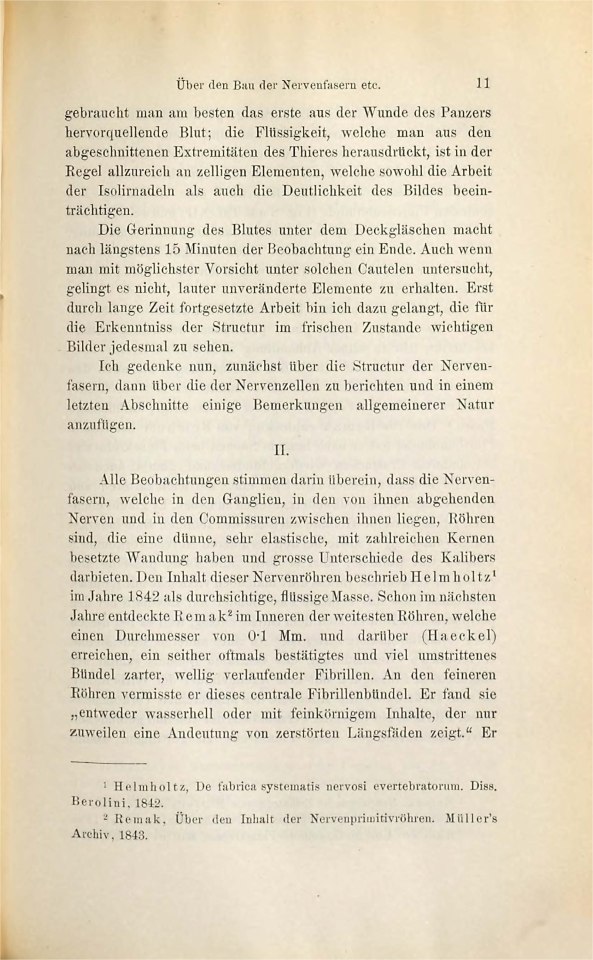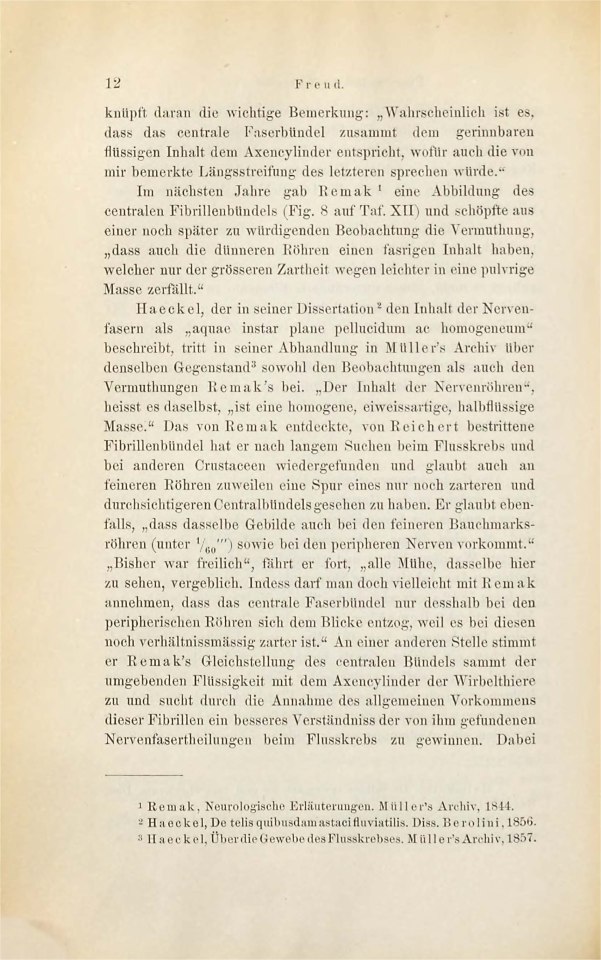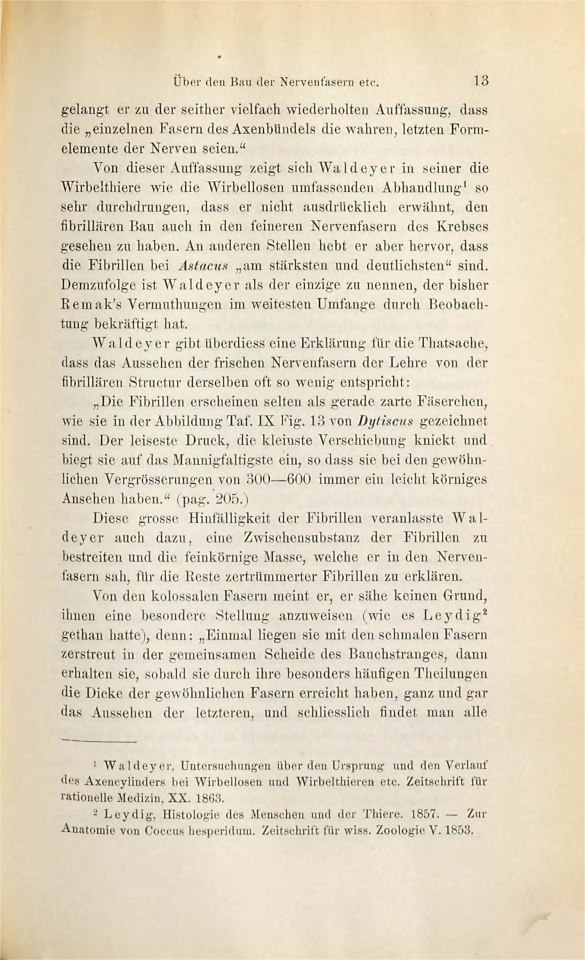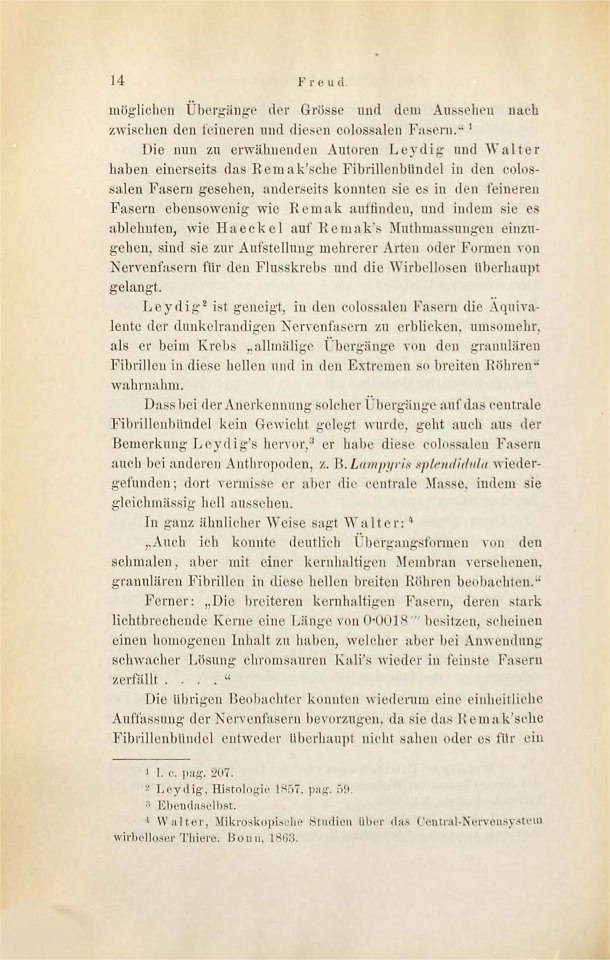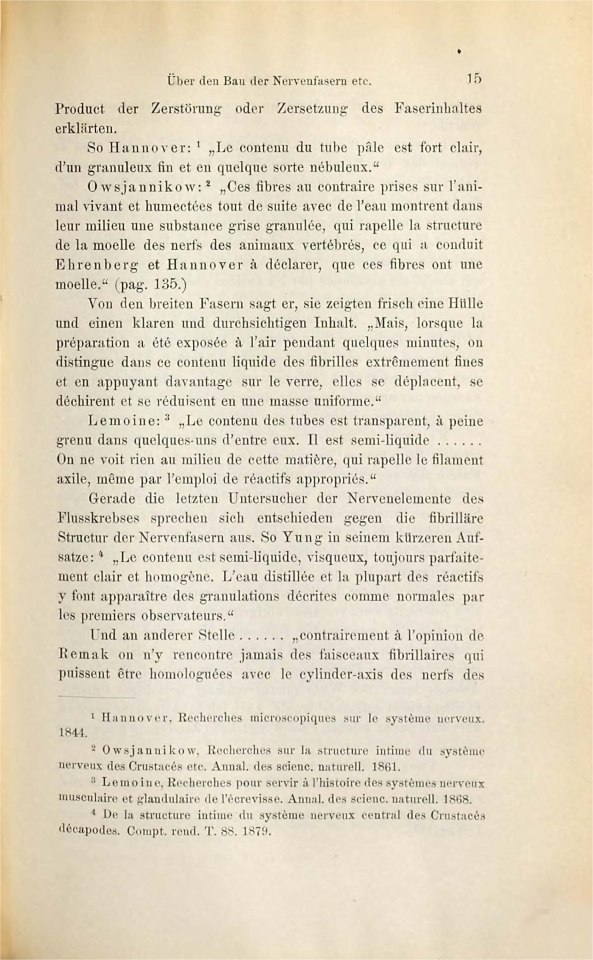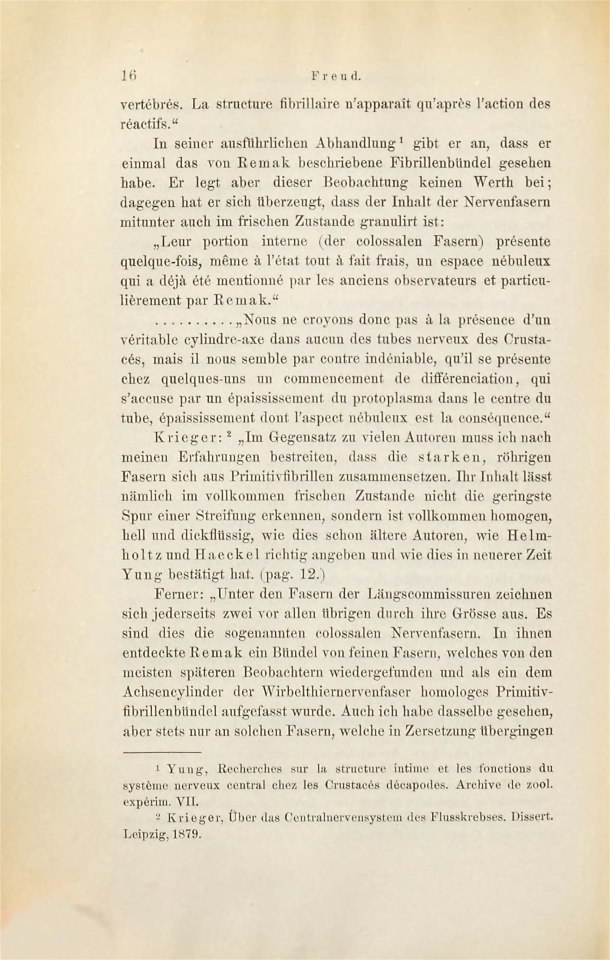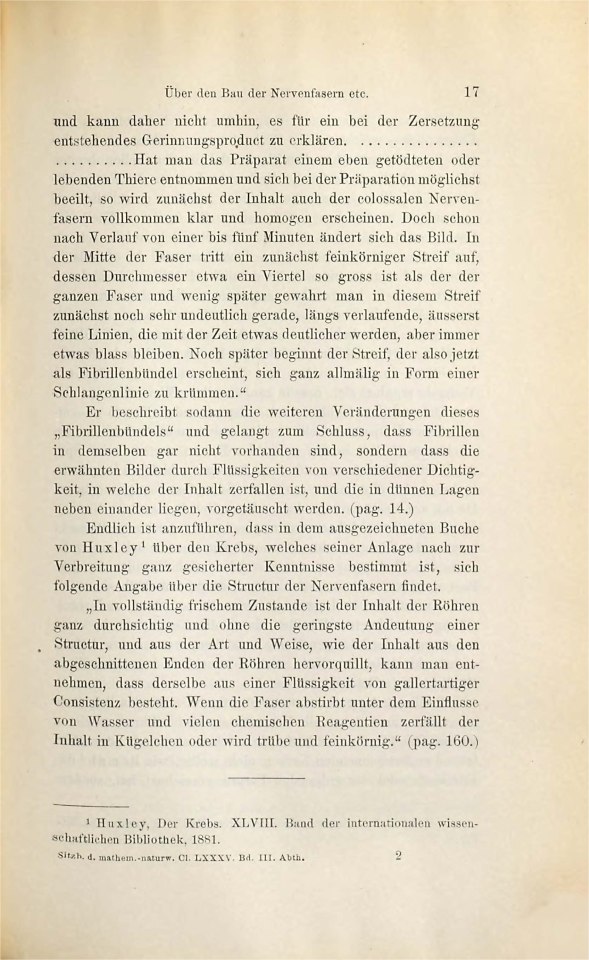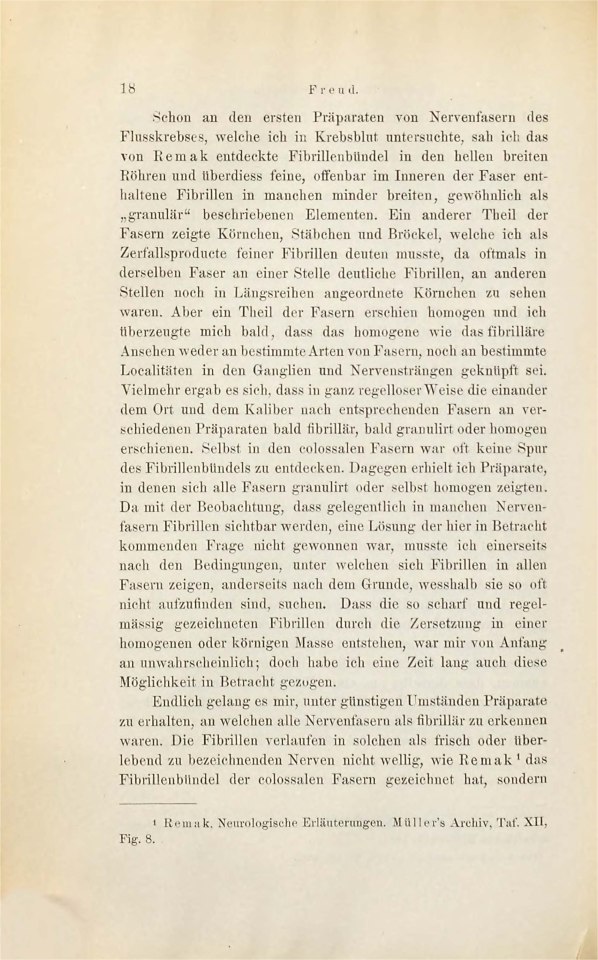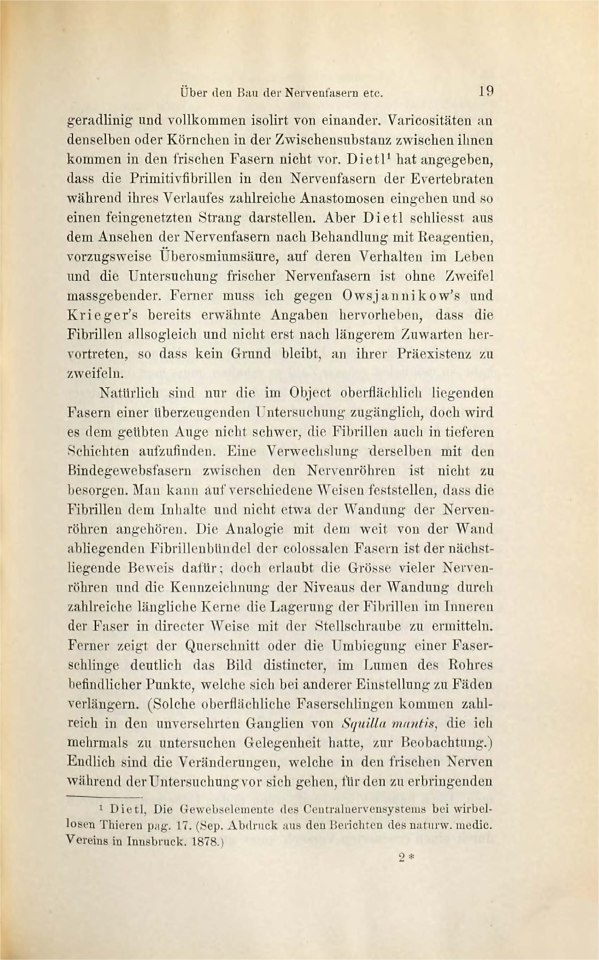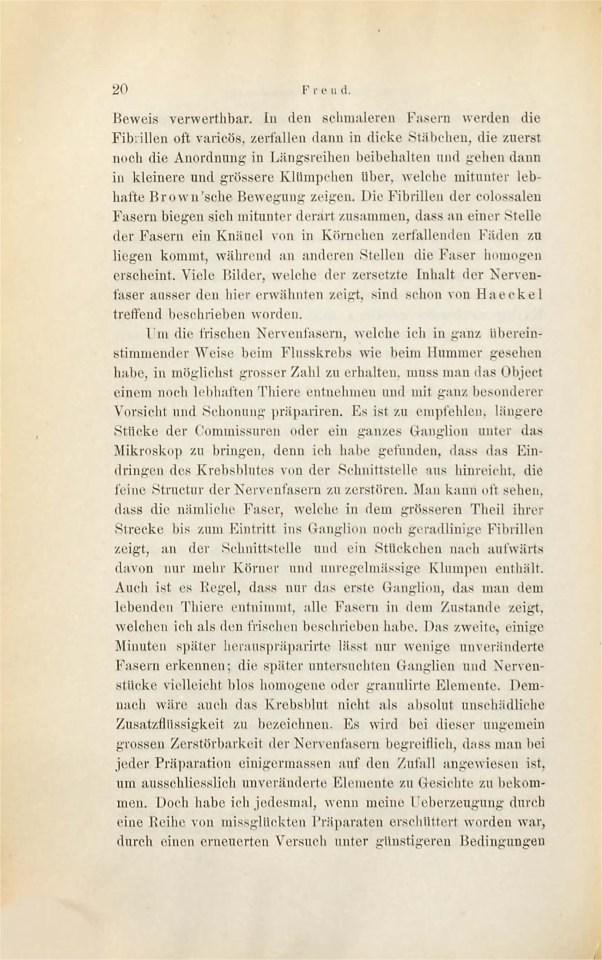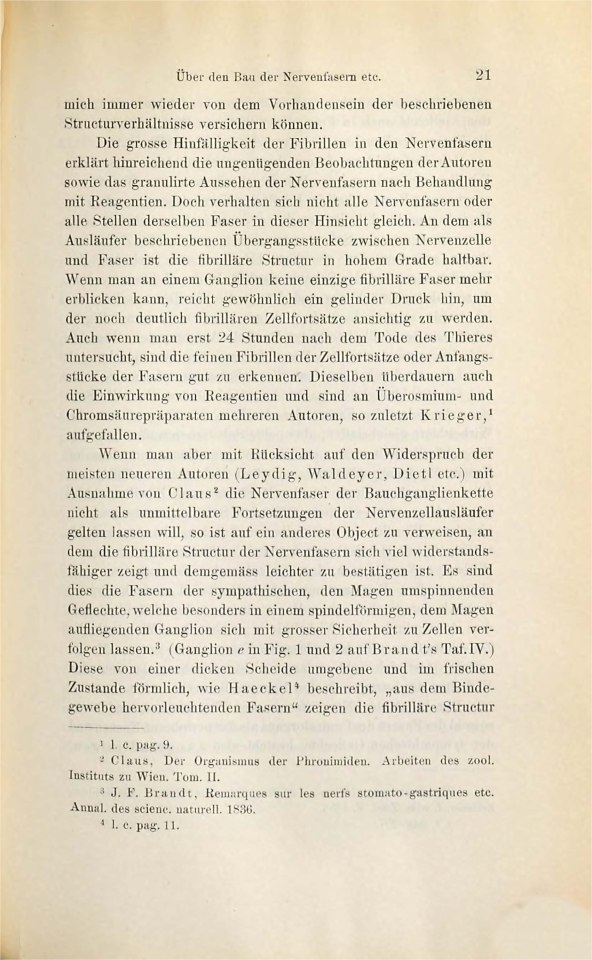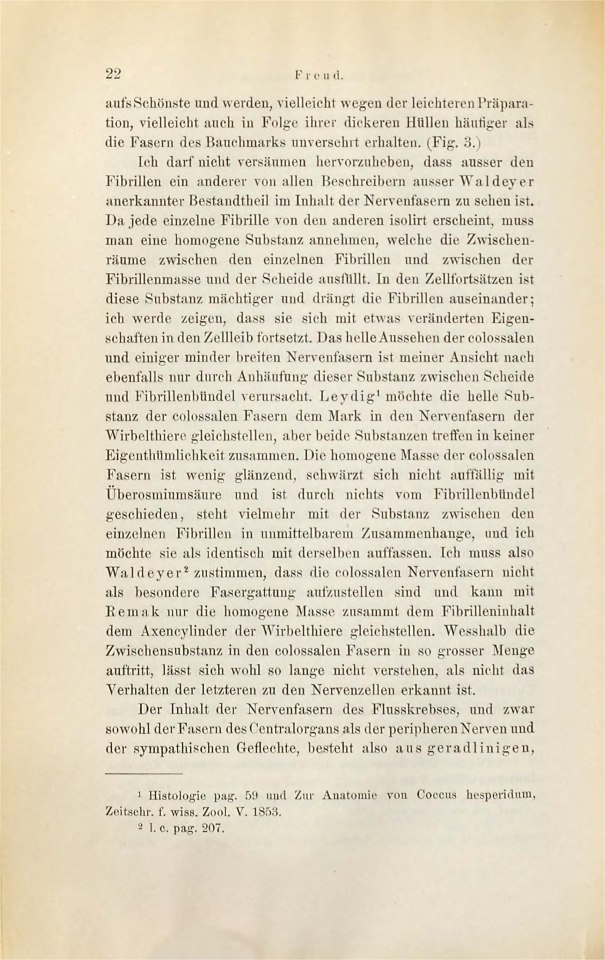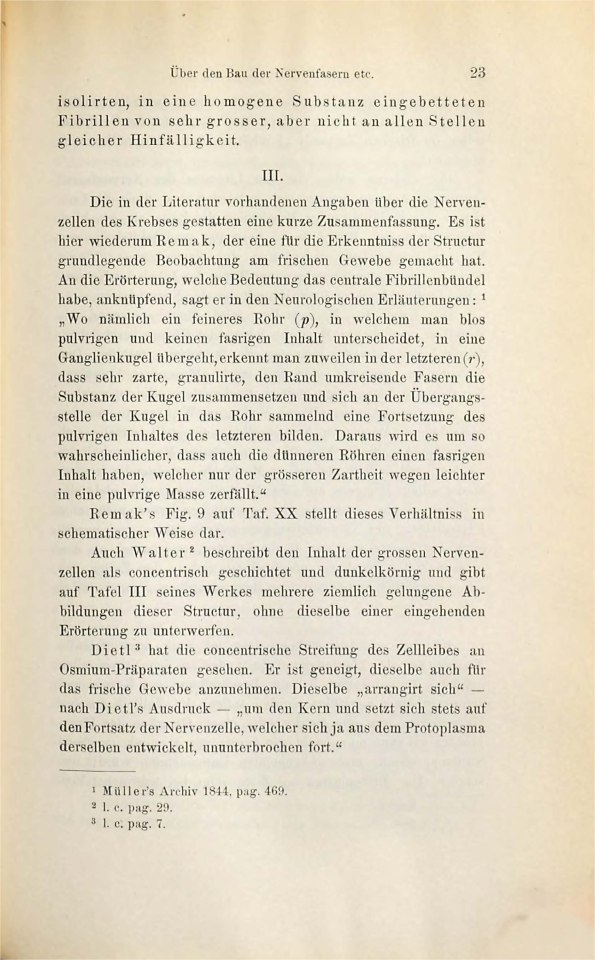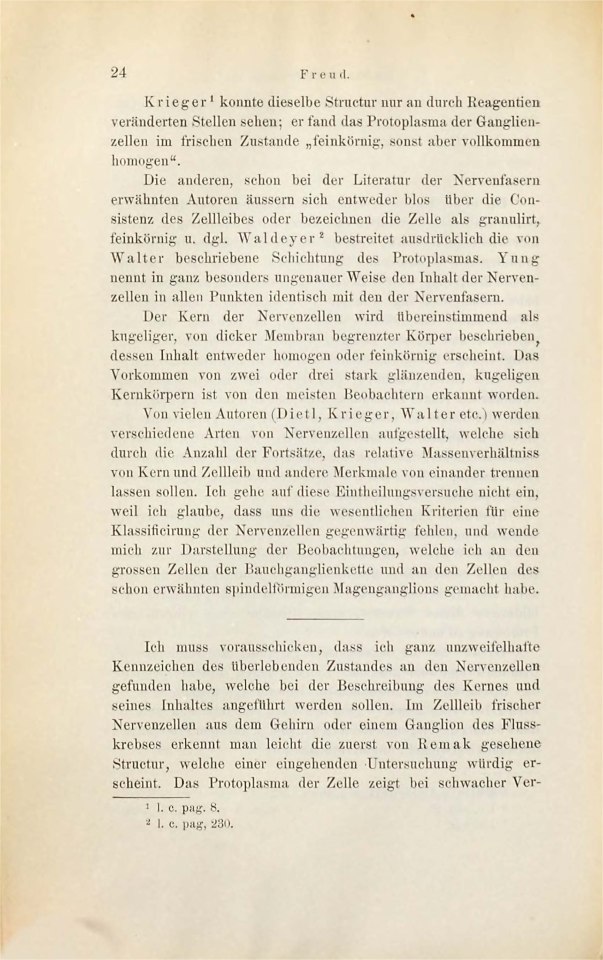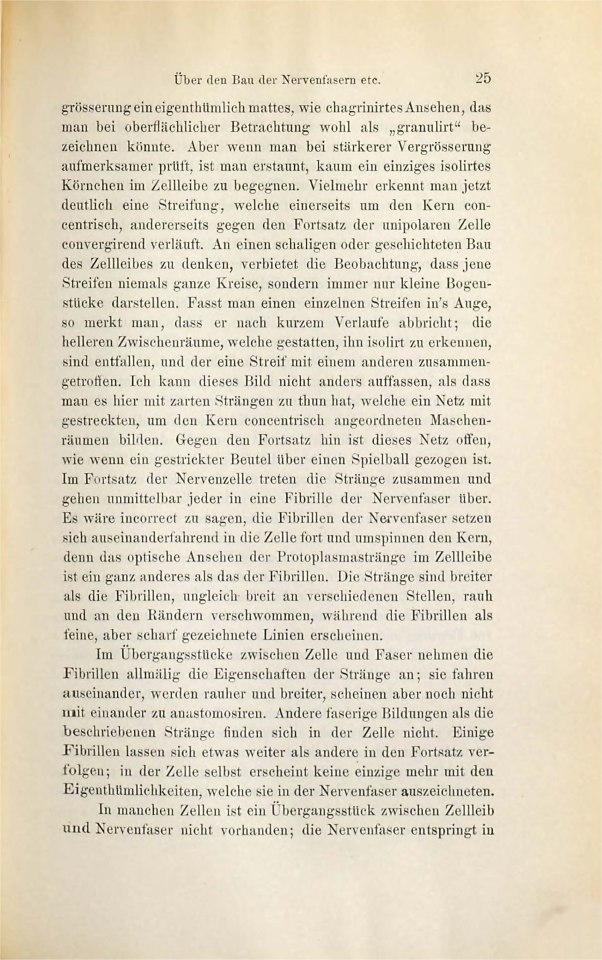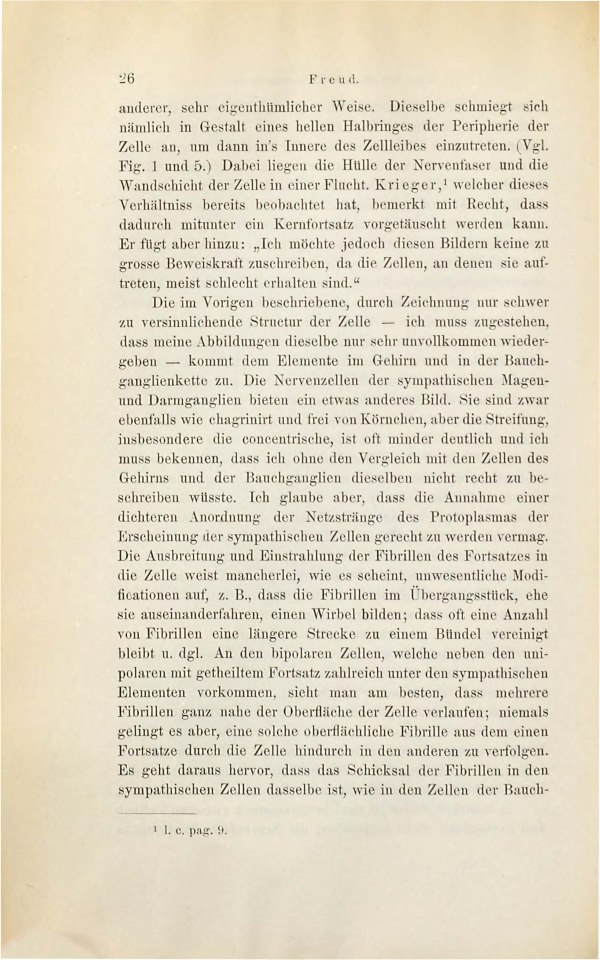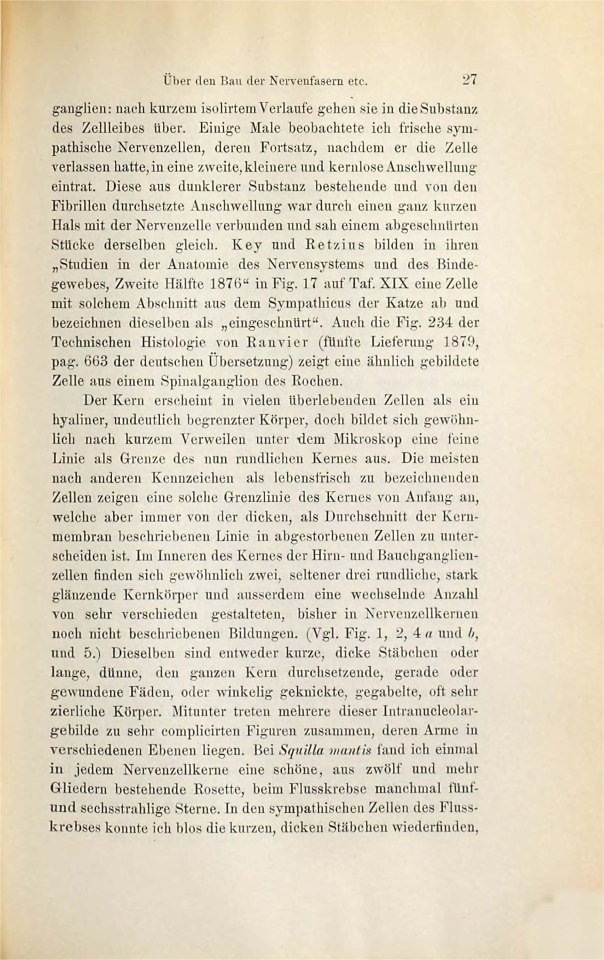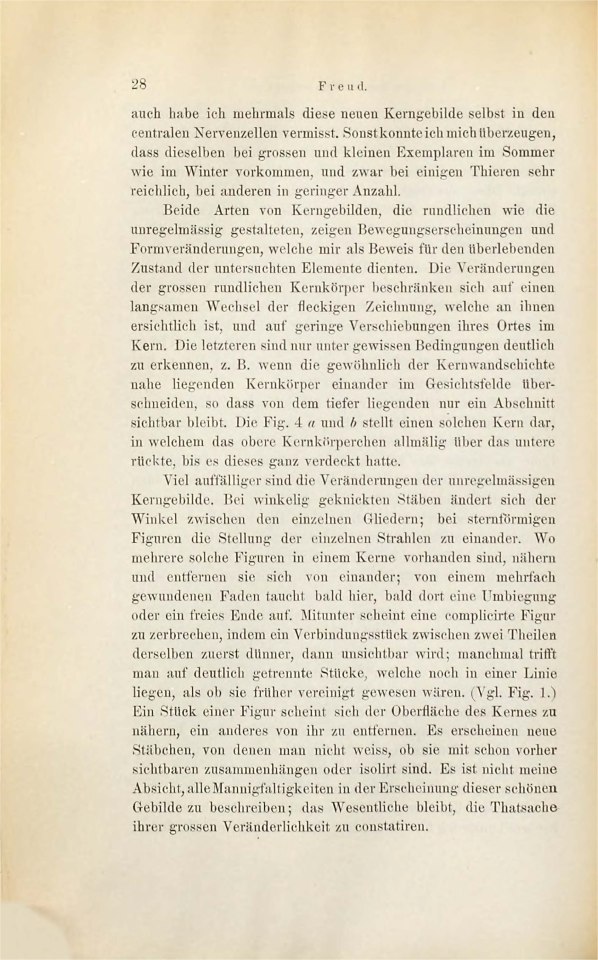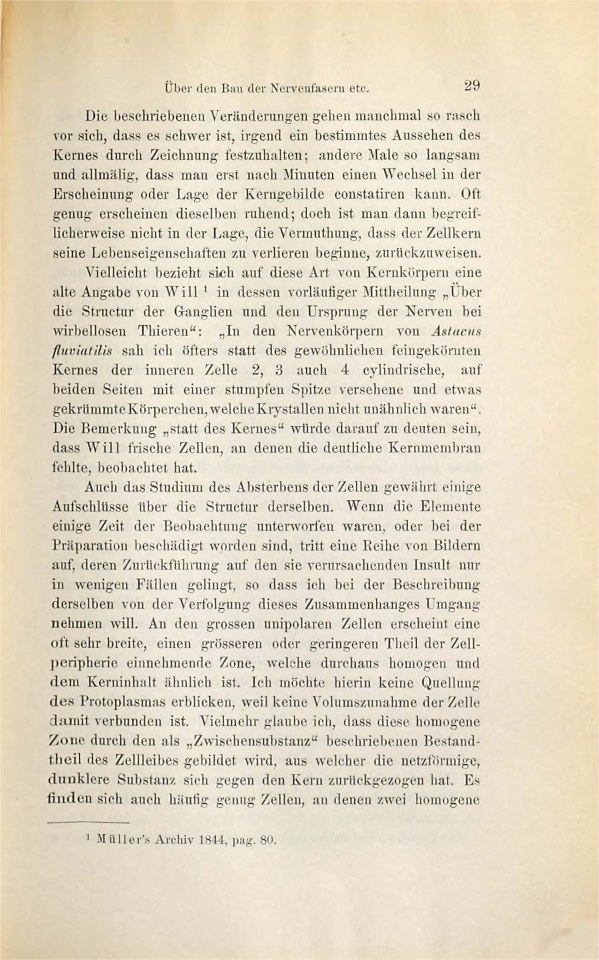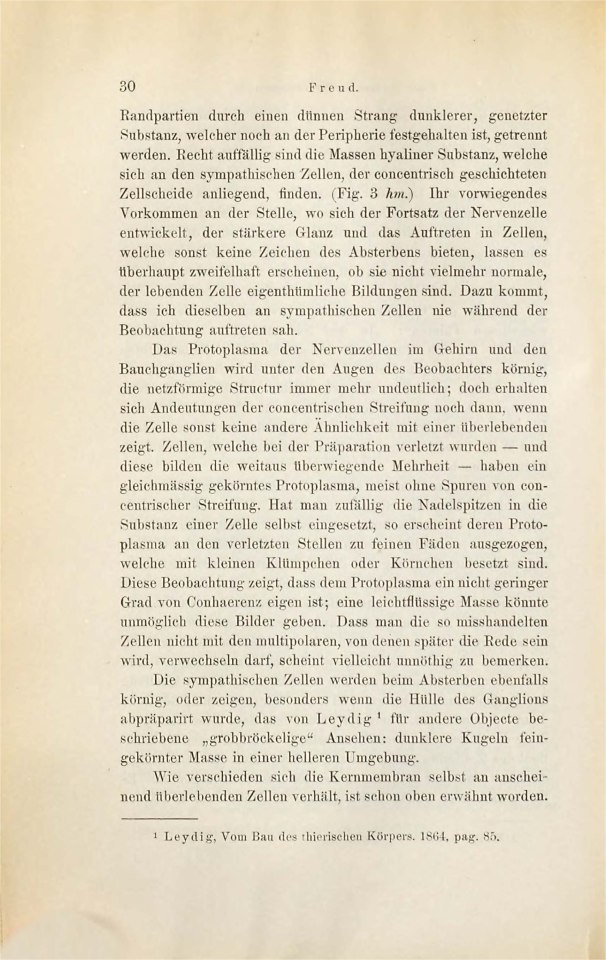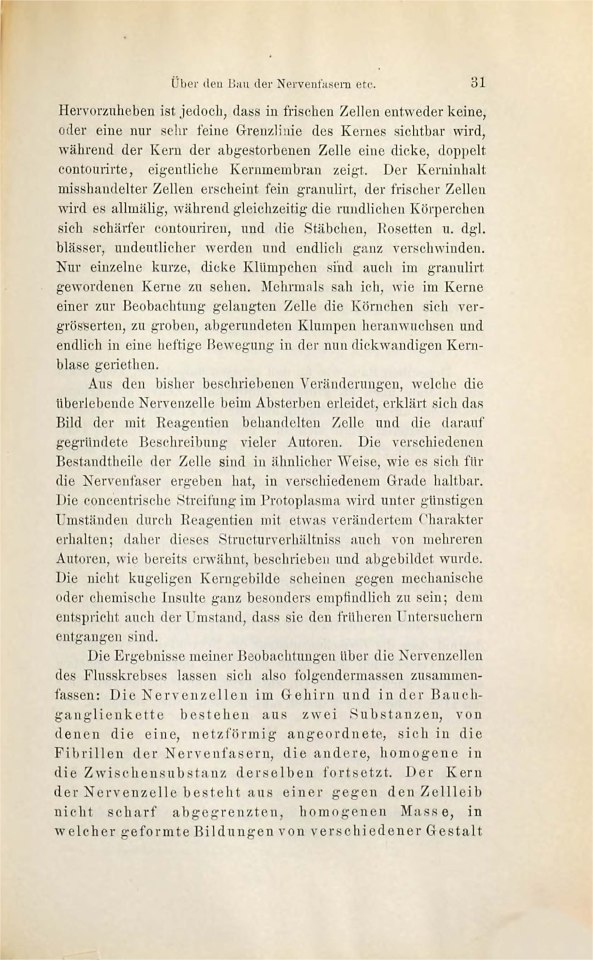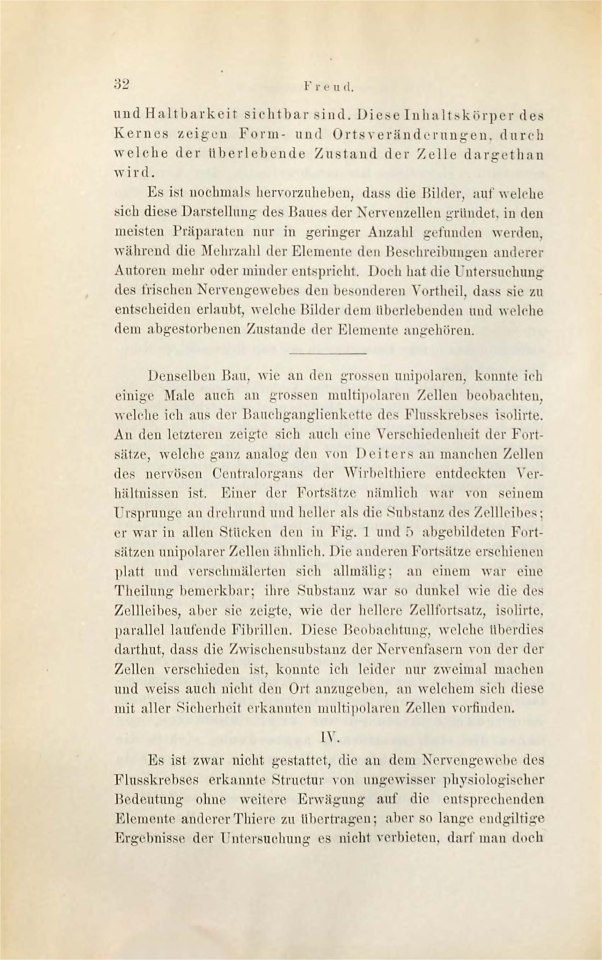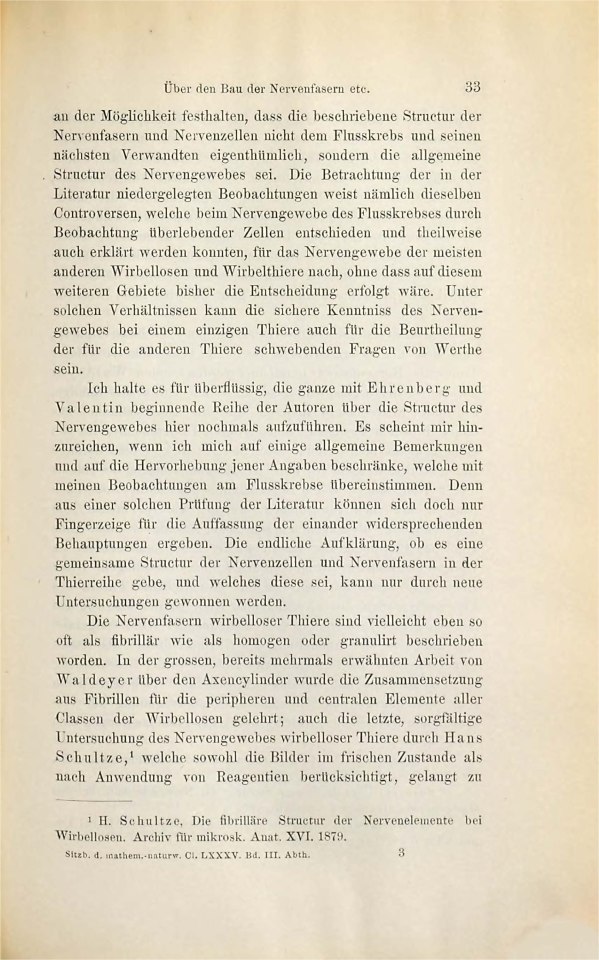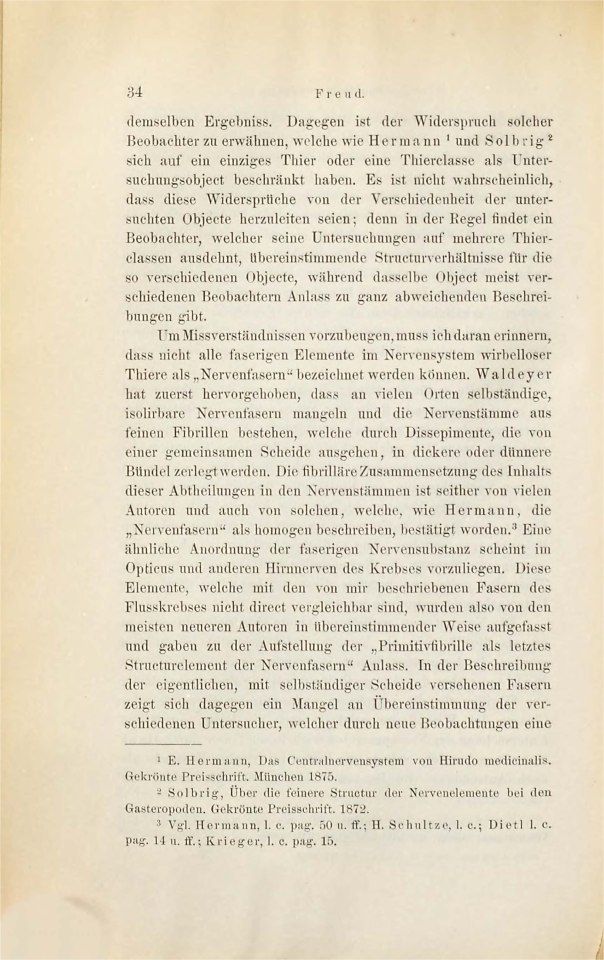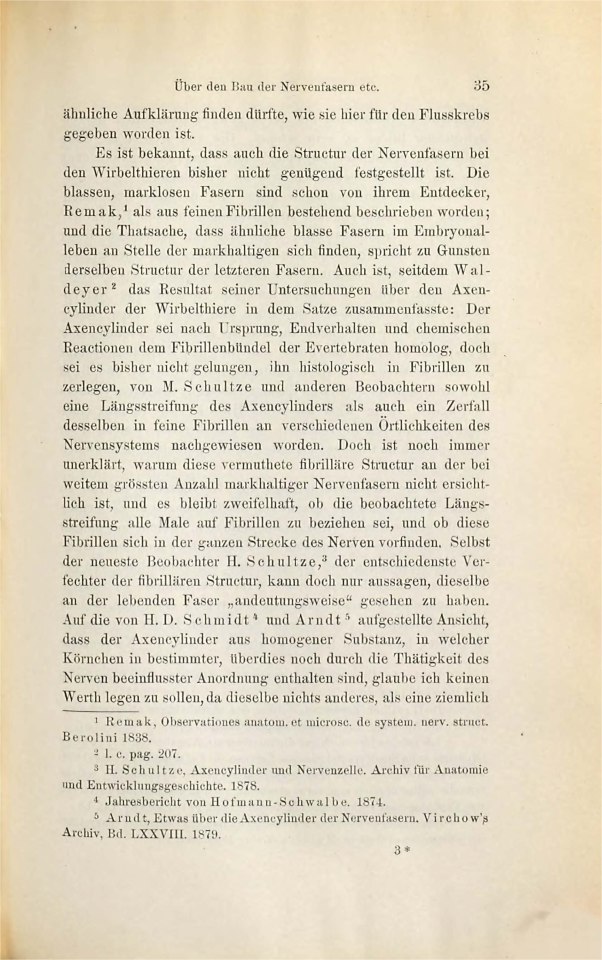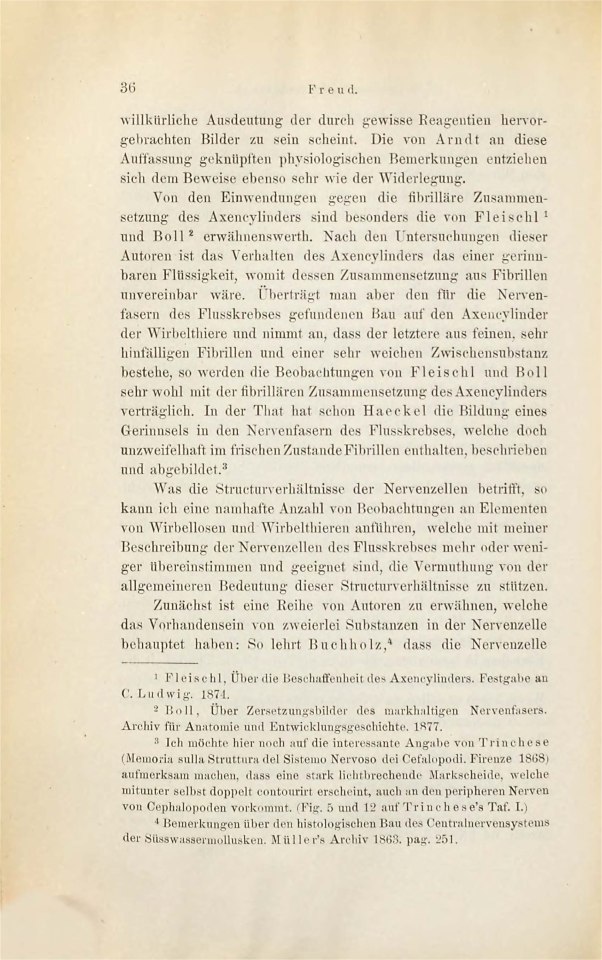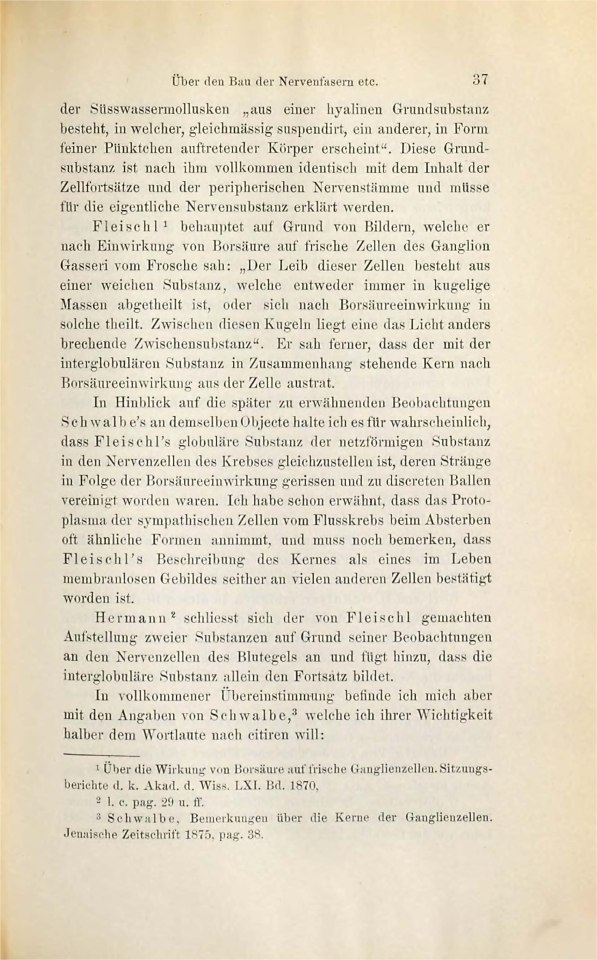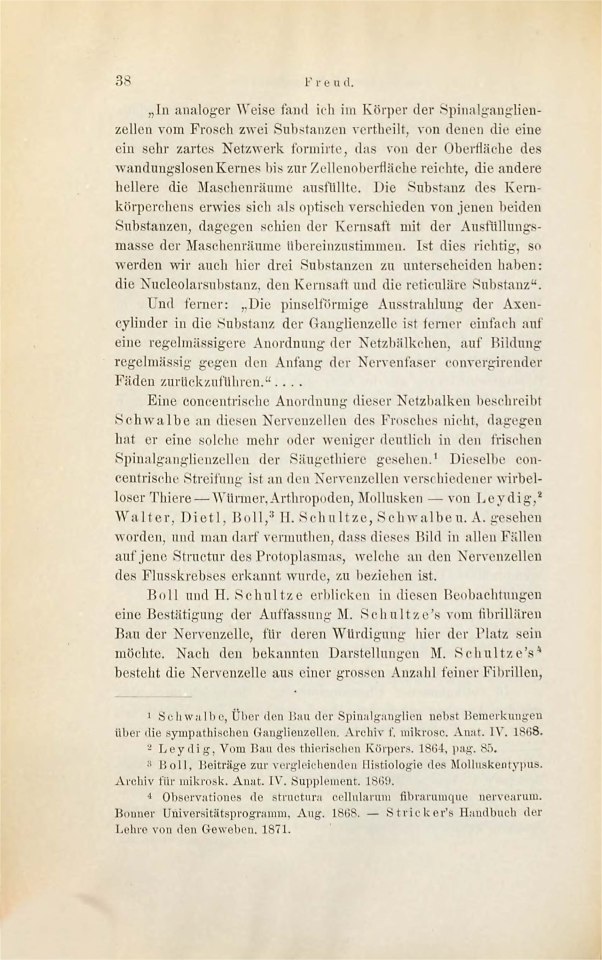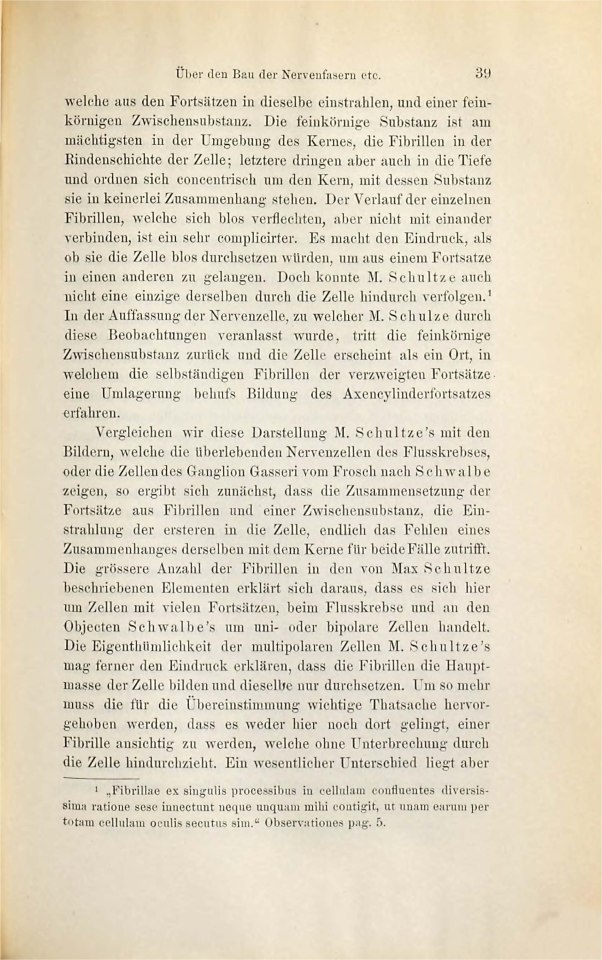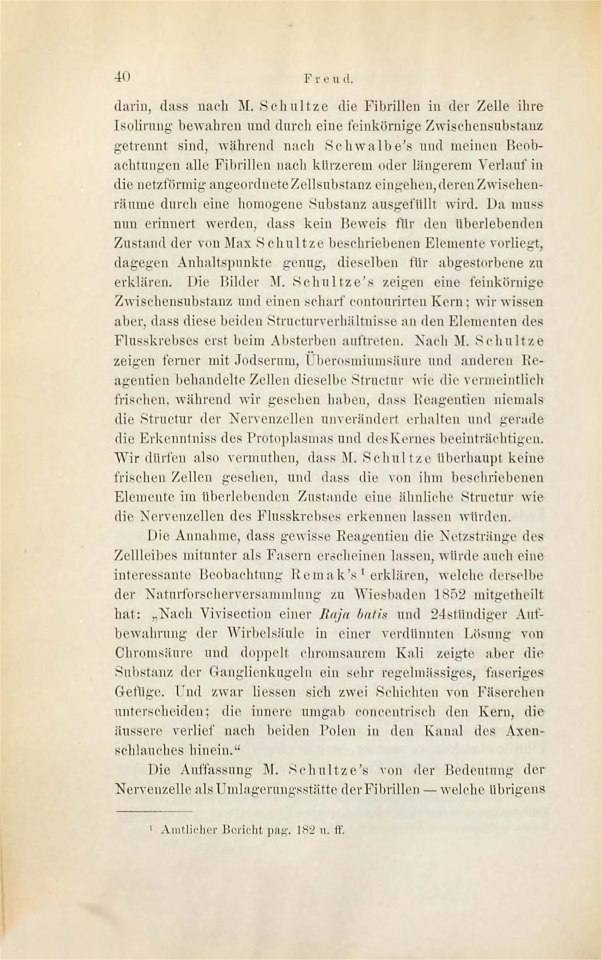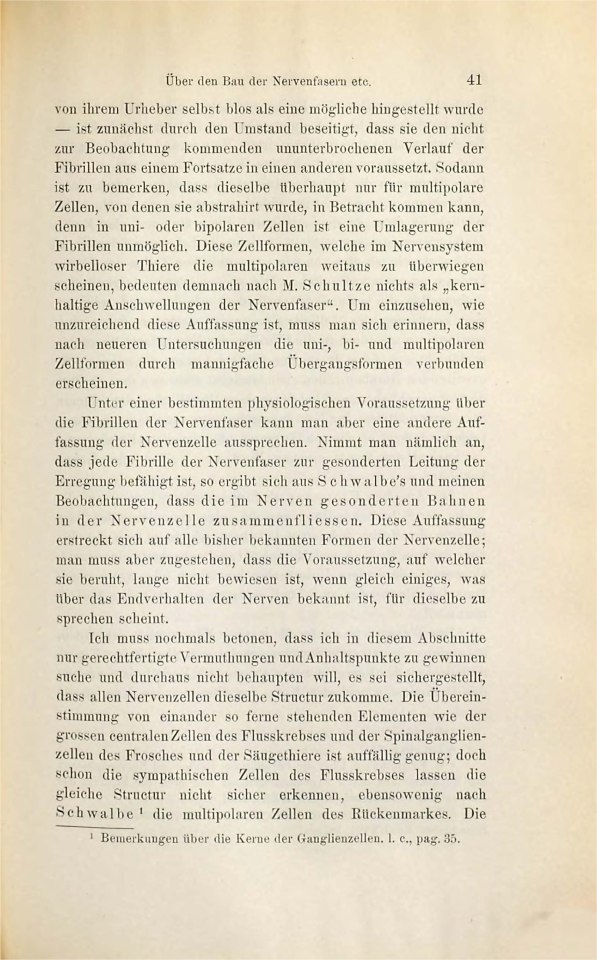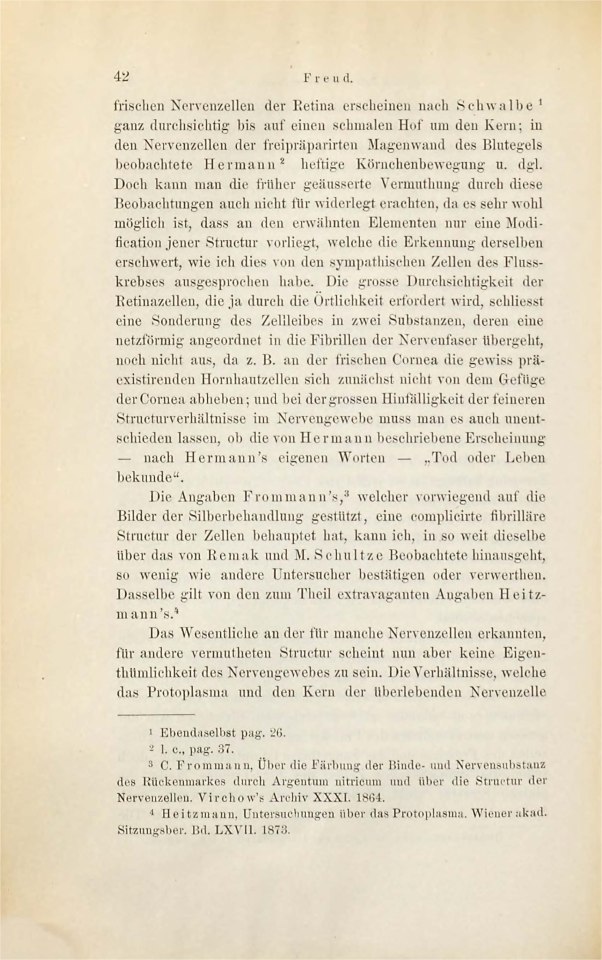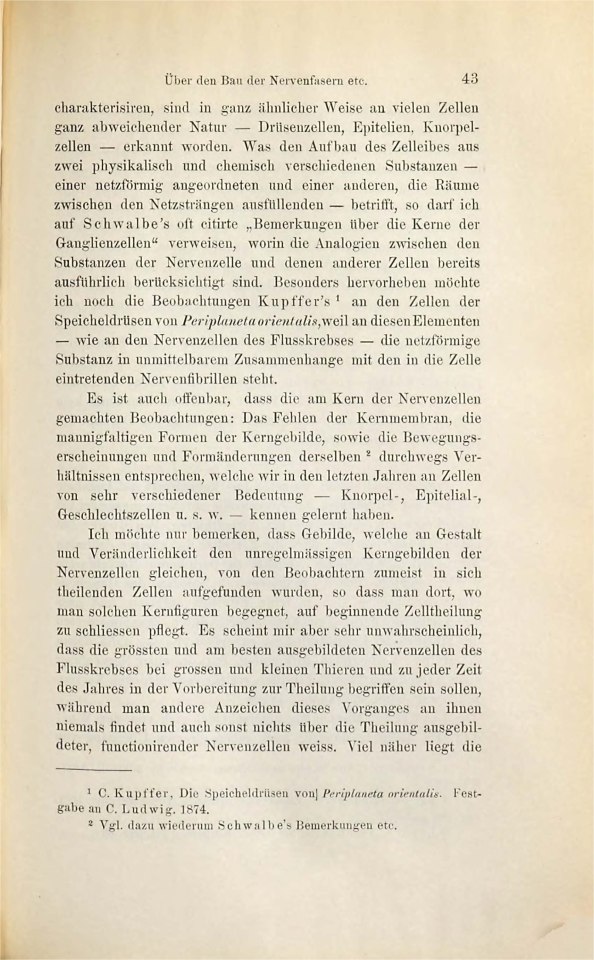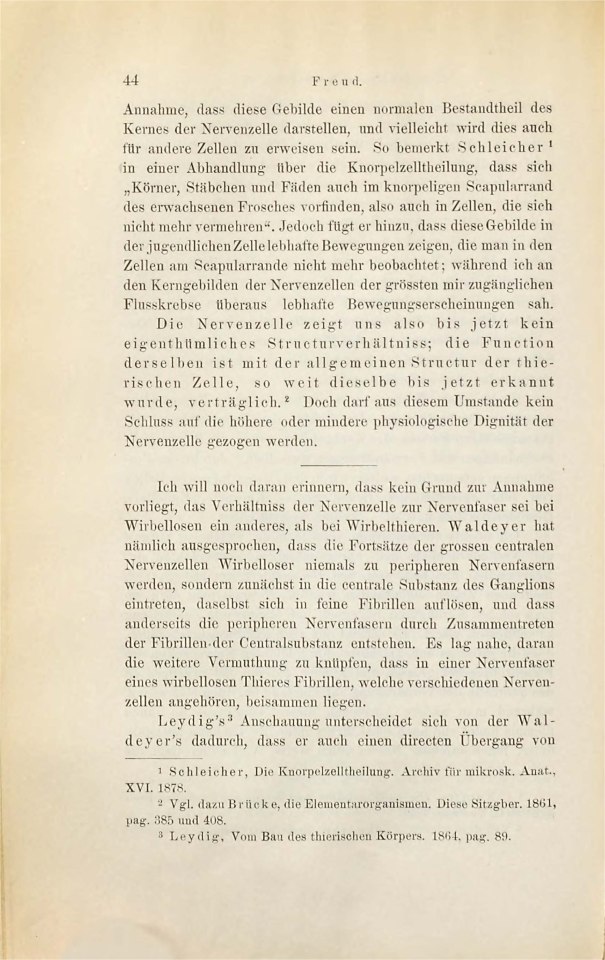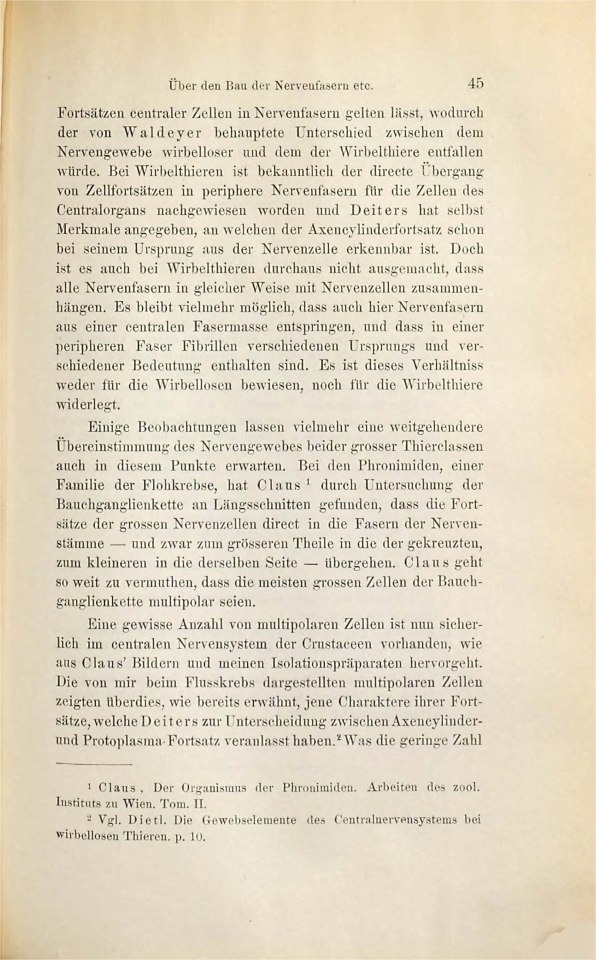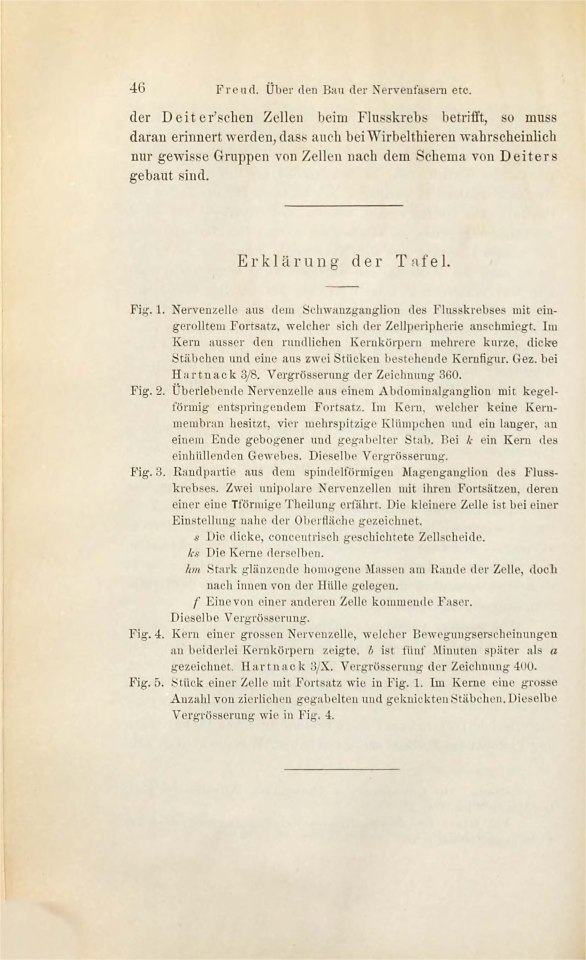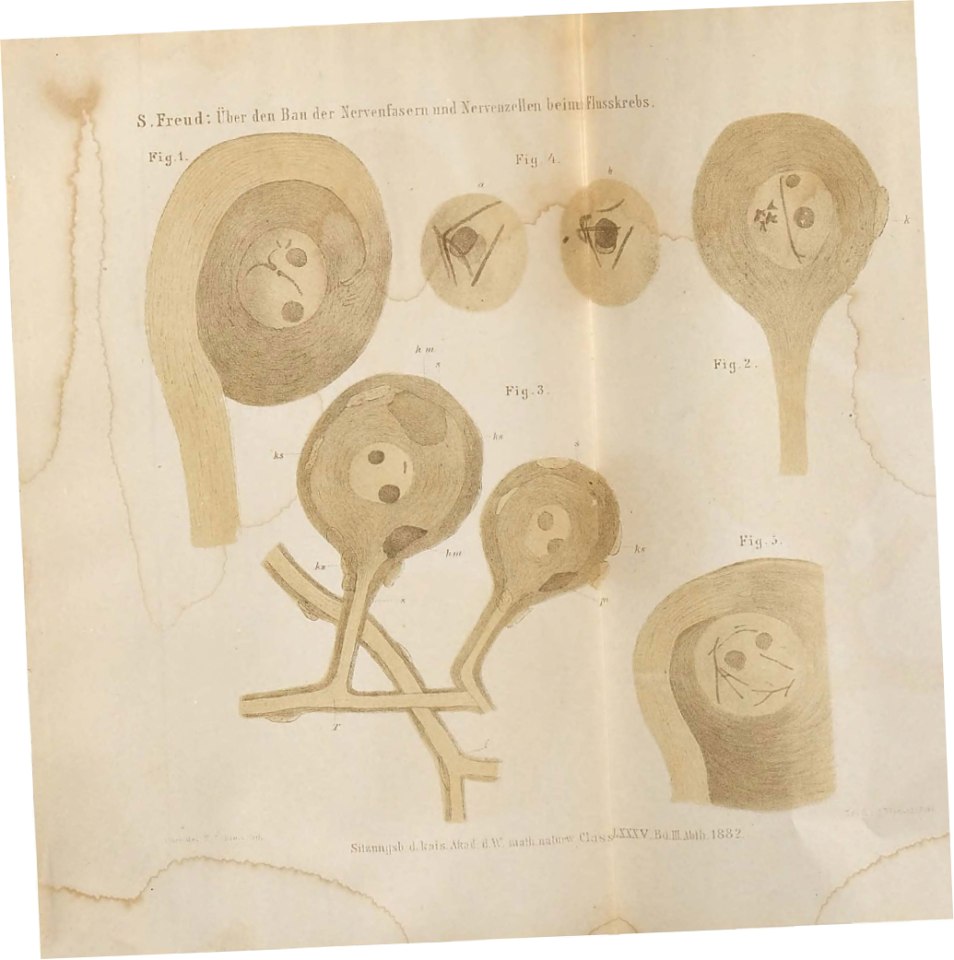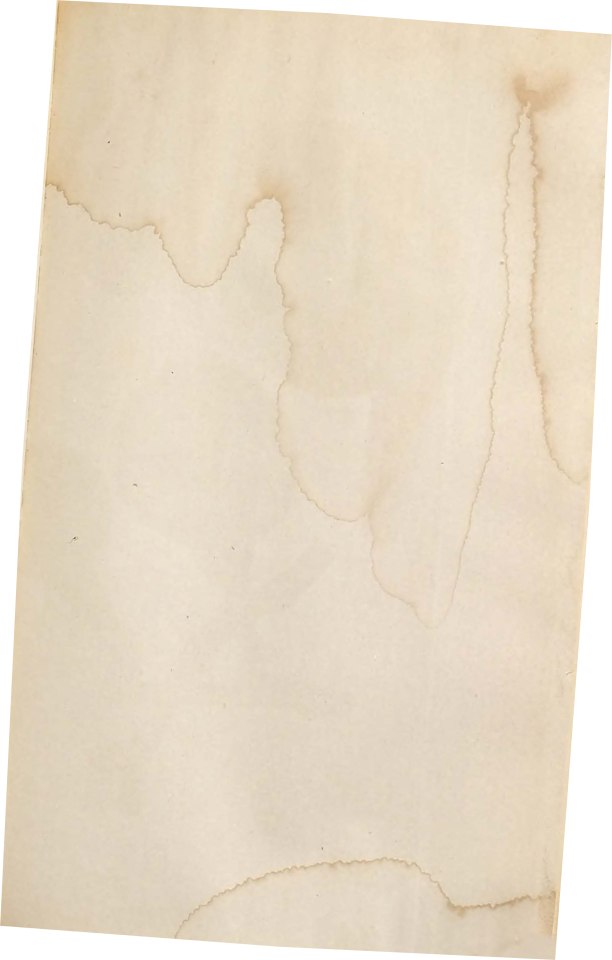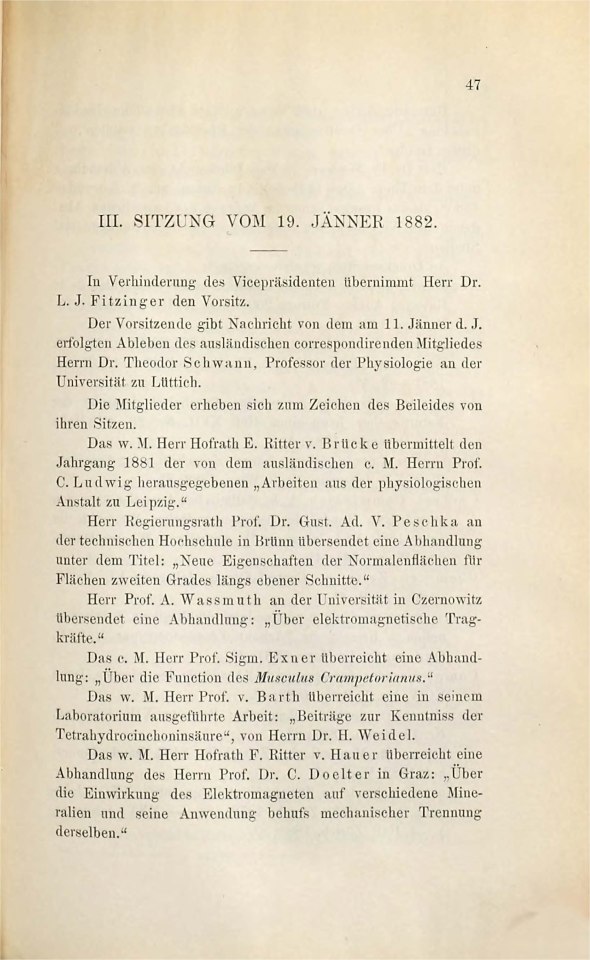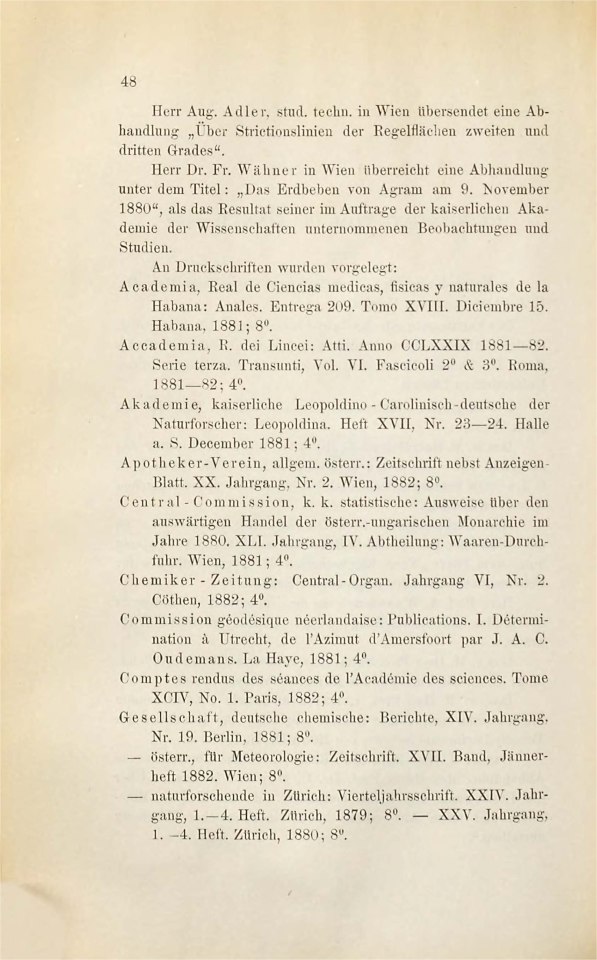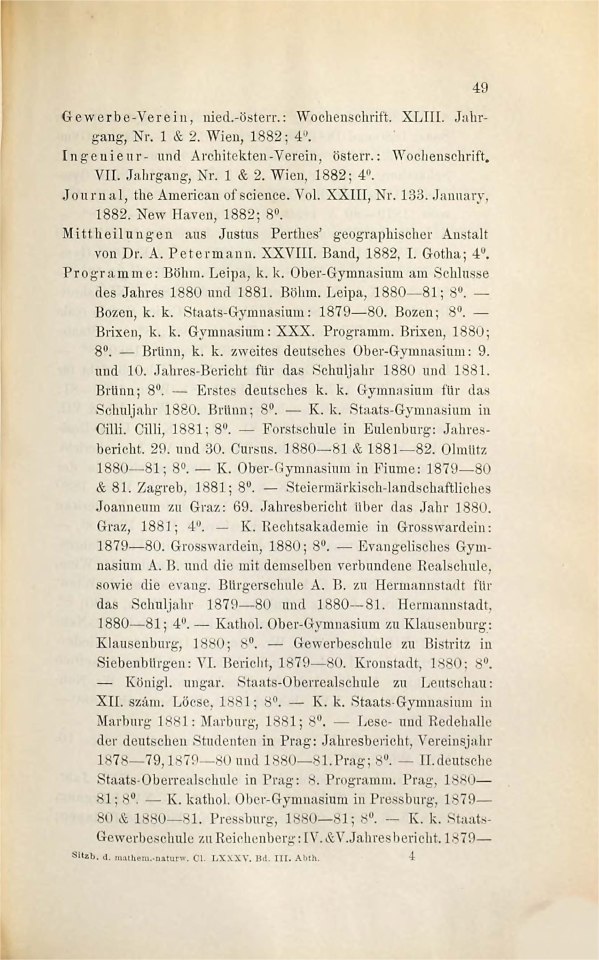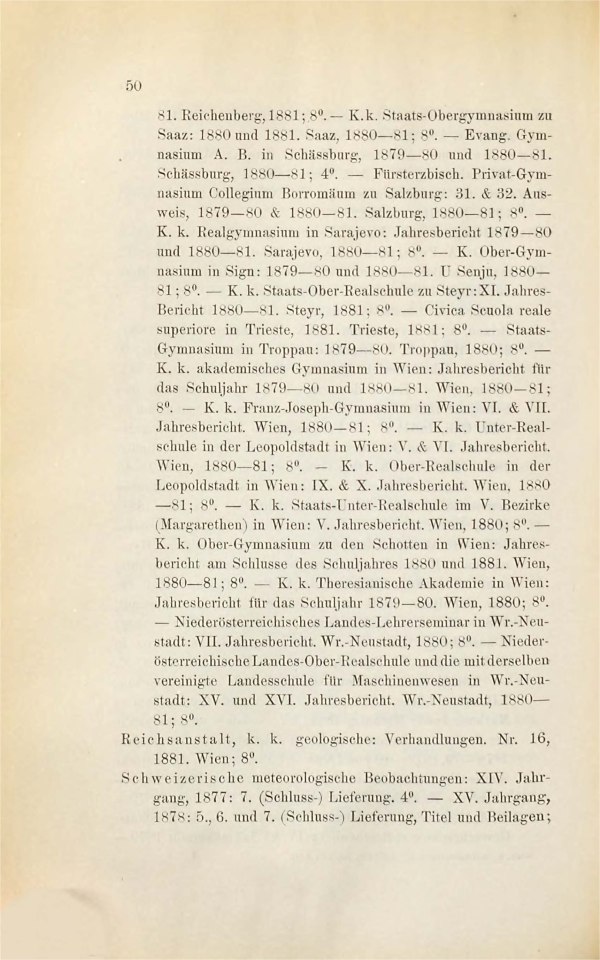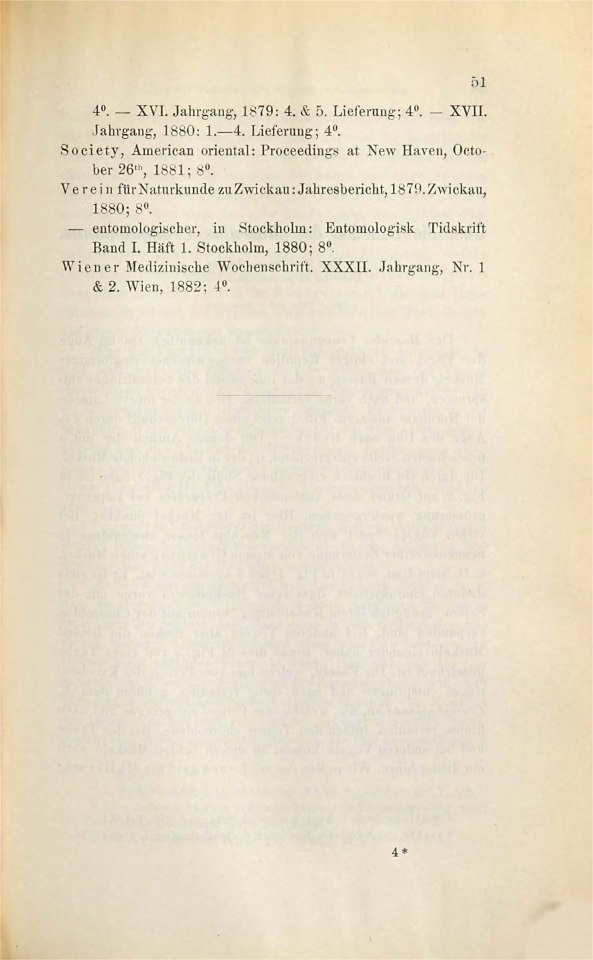S.
9
Über den Bau der Nervenfasern und Nervenzellen
beim Flusskrebs.Von Dr. Sigm. Freud.
(Mit 1 Tafel.)
(Vorgelegt in der Sitzung am 15. December 1881.)
I.
Die im Folgenden mitgetheilten Beobachtungen sind in den
Sommermonaten der Jahre 1879 und 1881 in der Absicht
angestellt worden, die Kenntniss der feineren Structur des Nerven-
gewebes durch Untersuchung frischer, wo möglich überlebender,
Elemente zu fördern. Da die Lösung dieser Aufgabe bei Wirbelt-
hieren auf allzugrosse Schwierigkeiten stösst, wandte ich mich
im Vertrauen auf die allgemeine Bedeutsamkeit der Resultate an
die Wirbellosen und wählte aus den mir leichter zugänglichen
Objecten den Flusskrebs, bei welchem Thiere die Grösse und der
lockere Zusammenhang der Elementartheile, sowie das reichliche
Vorhandensein einer wahrscheinlich unschädlichen Zusatzflüssig-
keit im Blute die Untersuchung zu erleichtern versprachen.Von vielen Autoren wird die Untersuchung des frischen
Nervengewebes wirbelloser Thiere als besonders schwierig und
deren Ergebnisse als unbefriedigende bezeichnet. Es ist nicht nur
bisher misslungen, einen einheitlichen Bau der Nervenfasern und
Nervenzellen bei den verschiedenen Thierclassen zu erkennen;
selbst von einem und demselben Object haben verschiedene
Untersucher, die sich der erwähnten Methode bedienten, ganz
abweichende Beschreibungen gegeben.Auf vielen Seiten ist desshalb die Anwendung von Reagen-
tien, insbesondere der Überosmiumsäure, welche im Rufe steht,
feine Structurverhältnisse unverändert zu erhalten, vorgezogen
worden. Doch ist es selbstverständlich, dass die Untersuchung imS.
10
frischen Zustande allein über den Werth oder Unwerth der durch
Reagentien erhaltenen Bilder entscheiden kann, wenn man sich
nur gegenwärtig hält, dass eine dem lebenden Thier ent-
nommene Zelle darum noch keine überlebende sein muss. Der
mechanische Insult der isolirenden Nadeln und die chemische
Einwirkung der zugesetzten Flüssigkeit können leicht die
Vortheile der Untersuchung im frischen Zustande illusorisch
machen.Ich habe die Structur der Nervenzellen und Nervenfasern
beim Flusskrebs hauptsächlich am frischen Gewebe studirt und
halte mich zur Behauptung berechtigt, dass ich überlebende Ele-
mentartheile gesehen habe. Ich habe unter günstigen Umständen
Bilder erhalten, welche von den Darstellungen der meisten
Autoren sehr bedeutend abwichen und einige Eigenthümlichkeiten
zeigten, die nur lebenden Elementen zugesprochen werden können.
Unter dem Einfluss von Druck, Eintrocknung u. s. w., oder
anscheinend spontan nach längerer Beobachtung schwanden diese
für den überlebenden Zustand charakteristischen Bilder und
die Elementartheile boten das oft von anderen Untersuchern
beschriebene Ansehen dar. Ich habe ferner erfahren, dass einige
der Structurverhältnisse, welche man an überlebenden Elementen
sieht, sehr vergänglich sind und durch die gebräuchlichen
Reagentien nicht erhalten werden; andere überdauern das
Ableben der Zellen und Fasern um viele Stunden und können
auch nach Behandlung mit Reagentien erkannt werden; letztere
sind auch in der That an so behandelten Präparaten oftmals
gesehen worden.Um überlebender Zellen und Fasern ansichtig zu werden, ist
es vortheilhaft, keine vollständige Isolirung der Elemente anzu-
streben, sondern sich mit der Beobachtung durch eine möglichst
dünne Schichte des umliegenden Gewebes zu begnügen. Man ist
dann gehindert, stärkere Hartnack’sche Linsen als die Tauch
linse Nr. X anzuwenden; aber die Grösse der Elemente gestattet
es, auch bei Hartnack 8 vollkommen klare und ausreichende
Beobachtungen anzustellen. Bei gutem Licht kann man auch
wohl einen ganzen Commissuren‑ oder Nervenstrang unter das
Mikroskop bringen, um die oberflächlichen Fasern desselben mit
grösster Deutlichkeit zu beobachten. Als ZusatzflüssigkeitS.
11
gebraucht man am besten das erste aus der Wunde des Panzers
hervorquellende Blut; die Flüssigkeit, welche man aus den
abgeschnittenen Extremitäten des Thieres herausdrückt, ist in der
Regel allzureich an zelligen Elementen, welche sowohl die Arbeit
der Isolirnadeln als auch die Deutlichkeit des Bildes beein-
trächtigen.Die Gerinnung des Blutes unter dem Deckgläschen macht
nach längstens 15 Minuten der Beobachtung ein Ende. Auch wenn
man mit möglichster Vorsicht unter solchen Cautelen untersucht,
gelingt es nicht, lauter unveränderte Elemente zu erhalten. Erst
durch lange Zeit fortgesetzte Arbeit bin ich dazu gelangt, die für
die Erkenntniss der Structur im frischen Zustande wichtigen
Bilder jedesmal zu sehen.Ich gedenke nun, zunächst über die Structur der Nerven-
fasern, dann über die der Nervenzellen zu berichten und in einem
letzten Abschnitte einige Bemerkungen allgemeinerer Natur
anzufügen.II.
Alle Beobachtungen stimmen darin überein, dass die Nerven-
fasern, welche in den Ganglien, in den von ihnen abgehenden
Nerven und in den Commissuren zwischen ihnen liegen, Röhren
sind, die eine dünne, sehr elastische, mit zahlreichen Kernen
besetzte Wandung haben und grosse Unterschiede des Kalibers
darbieten. Den Inhalt dieser Nervenröhren beschrieb Helmholtz1
im Jahre 1842 als durchsichtige, flüssige Masse. Schon im nächsten
Jahre entdeckte Remak2 im Inneren der weitesten Röhren, welche
einen Durchmesser von 0.1 Mm. und darüber (Haeckel)
erreichen, ein seither oftmals bestätigtes und viel umstrittenes
Bündel zarter, wellig verlaufender Fibrillen. An den feineren
Röhren vermisste er dieses centrale Fibrillenbündel. Er fand sie
„entweder wasserhell oder mit feinkörnigem Inhalte, der nur
zuweilen eine Andeutung von zerstörten Längsfäden zeigt.“ Er1Helmholt, De fabrica systematis nervosi evertebratorum. Diss.
Berolini, 1842.2Remak, Über den Inhalt der Nervenprimitivröhren. Müller’s
Archiv, 1843.S.
12
knüpft daran die wichtige Bemerkung: „Wahrscheinlich ist es,
dass das centrale Faserbündel zusammt dem gerinnbaren
flüssigen Inhalt dem Axencylinder entspricht, wofür auch die von
mir bemerkte Längsstreifung des letzteren sprechen würde.“Im nächsten Jahre gab Remak1 eine Abbildung des
centralen Fibrillenbündels (Fig. 8 auf Taf. XII) und schöpfte aus
einer noch später zu würdigenden Beobachtung die Vermuthung,
„dass auch die dünneren Röhren einen fasrigen Inhalt haben,
welcher nur der grösseren Zartheit wegen leichter in eine pulvrige
Masse zerfällt.“Haeckel , der in seiner Dissertation2 den Inhalt der Nerven-
fasern als „aquae instar plane pellucidum ac homogeneum“
beschreibt, tritt in seiner Abhandlung in Müller’s Archiv über
denselben Gegenstand3 sowohl den Beobachtungen als auch den
Vermuthungen Remak’s bei. „Der Inhalt der Nervenröhren“,
heisst es daselbst, „ist eine homogene, eiweissartige, halbflüssige
Masse.“ Das von Remak entdeckte, von Reichert bestrittene
Fibrillenbündel hat er nach langem Suchen beim Flusskrebs und
bei anderen Crustaceen wiedergefunden und glaubt auch an
feineren Röhren zuweilen eine Spur eines nur noch zarteren und
durchsichtigeren Centralbündels gesehen zu haben. Er glaubt eben-
falls, „dass dasselbe Gebilde auch bei den feineren Bauchmarks-
röhren (unter 1/60”’) sowie bei den peripheren Nerven vorkommt.“
„Bisher war freilich“, fährt er fort, „alle Mühe, dasselbe hier
zu sehen, vergeblich. Indess darf man doch vielleicht mit Remak
annehmen, dass das centrale Faserbündel nur desshalb bei den
peripherischen Röhren sich dem Blicke entzog, weil es bei diesen
noch verhältnissmässig zarter ist.“ An einer anderen Stelle stimmt
er Remak’s Gleichstellung des centralen Bündels sammt der
umgebenden Flüssigkeit mit dem Axencylinder der Wirbelthiere
zu und sucht durch die Annahme des allgemeinen Vorkommens
dieser Fibrillen ein besseres Verständniss der von ihm gefundenen
Nervenfasertheilungen beim Flusskrebs zu gewinnen. Dabei1Remak, Neurologische Erläuterungen. Müller’s Archiv, 1844.
2Haeckel, De telis quibusdam astaci fluviatilis. Diss. Berolini, 1856.
3Haeckel, Über die Gewebe des Flusskrebses. Müller’s Archiv, 1857.
S.
13
gelangt er zu der seither vielfach wiederholten Auffassung, dass
die „einzelnen Fasern des Axenbündels die wahren, letzten Form-
elemente der Nerven seien.“Von dieser Auffassung zeigt sich Waldeyer in seiner
die Wirbelthiere wie die Wirbellosen umfassenden Abhandlung1 so
sehr durchdrungen, dass er nicht ausdrücklich erwähnt, den
fibrillären Bau auch in den feineren Nervenfasern des Krebses
gesehen zu haben. An anderen Stellen hebt er aber hervor, dass
die Fibrillen bei Astacus „am stärksten und deutlichsten“ sind.
Demzufolge ist Waldeyer als der einzige zu nennen, der bisher
Remak’s Vermuthungen im weitesten Umfange durch Beobach-
tung bekräftigt hat.Waldeyer gibt überdiess eine Erklärung für die Thatsache,
dass das Aussehen der frischen Nervenfasern der Lehre von der
ibrillären Structur derselben oft so wenig entspricht:„Die Fibrillen erscheinen selten als gerade zarte Fäserchen,
wie sie in der Abbildung Taf. IX Fig. 13 von Dytiscus gezeichnet
sind. Der leiseste Druck, die kleinste Verschiebung knickt und
biegt sie auf das Mannigfaltigste ein, so dass sie bei den gewöhn-
lichen Vergrösserungen von 300–600 immer ein leicht körniges
Ansehen haben.“ (pag. 205.)Diese grosse Hinfälligkeit der Fibrillen veranlasste Waldeyer
auch dazu, eine Zwischensubstanz der Fibrillen zu
bestreiten und die feinkörnige Masse, welche er in den Nerven-
fasern sah, für die Reste zertrümmerter Fibrillen zu erklären.Von den kolossalen Fasern meint er, er sähe keinen Grund,
ihnen eine besondere Stellung anzuweisen (wie es Leydig2
gethan hatte), denn: „Einmal liegen sie mit den schmalen Fasern
zerstreut in der gemeinsamen Scheide des Bauchstranges, dann
erhalten sie, sobald sie durch ihre besonders häufigen Theilungen
die Dicke der gewöhnlichen Fasern erreicht haben, ganz und gar
das Aussehen der letzteren, und schliesslich findet man alle1Waldeyer, Untersuchungen über den Ursprung und den Verlauf
des Axencylinders bei Wirbellosen und Wirbelthieren etc. Zeitschrift für
rationelle Medizin, XX. 1863.7Leydig, Histologie des Menschen und der Thiere. 1857. – Zur
Anatomie von Coccus hesperidum. Zeitschrift für wiss. Zoologie V. 1853.S.
14
möglichen Übergänge der Grösse und dem Aussehen nach
zwischen den feineren und diesen colossalen Fasern.“1Die nun zu erwähnenden Autoren Leydig und Walter
haben einerseits das Remak’sche Fibrillenbündel in den colos-
salen Fasern gesehen, anderseits konnten sie es in den feineren
Fasern ebensowenig wie Remak auffinden, und indem sie es
ablehnten, wie Haeckel auf Remak’s Muthmassungen einzu-
gehen, sind sie zur Aufstellung mehrerer Arten oder Formen von
Nervenfasern für den Flusskrebs und die Wirbellosen überhaupt
gelangt.Leydig2 ist geneigt, in den colossalen Fasern die Äquiva-
lente der dunkelrandigen Nervenfasern zu erblicken, umsomehr,
als er beim Krebs „allmälige Übergänge von den granulären
Fibrillen in diese hellen und in den Extremen so breiten Röhren“
wahrnahm.Dass bei der Anerkennung solcher Übergänge auf das centrale
Fibrillenbündel kein Gewicht gelegt wurde, geht auch aus der
Bemerkung Leydig’s hervor,3 er habe diese colossalen Fasern
auch bei anderen Anthropoden, z. B. Lampyris splendidula wieder-
gefunden; dort vermisse er aber die centrale Masse, indem sie
gleichmässig hell aussehen.In ganz ähnlicher Weise sagt Walter:4
„Auch ich konnte deutlich Übergangsformen von den
schmalen, aber mit einer kernhaltigen Membran versehenen,
granulären Fibrillen in diese hellen breiten Röhren beobachten.“Ferner: „Die breiteren kernhaltigen Fasern, deren stark
lichtbrechende Kerne eine Länge von 0.0018”’ besitzen, scheinen
einen homogenen Inhalt zu haben, welcher aber bei Anwendung
schwacher Lösung chromsauren Kali’s wieder in feinste Fasern
zerfällt …“Die übrigen Beobachter konnten wiederum eine einheitliche
Auffassung der Nervenfasern bevorzugen, da sie das Remak’sche
Fibrillenbündel entweder überhaupt nicht sahen oder es für ein1l. c. pag. 207.
2Leydig, Histologie 1857, pag. 59.
3Ebendaselbst.
4Walter, Mikroskopische Studien über das Central‑Nervensystem
wirbelloser Thiere. Bonn, 1863.S.
15
Product der Zerstörung oder Zersetzung des Faserinhaltes
erklärten.So Hannover:1 „Le contenu du tube pâle est fort clair,
d’un granuleuxvfin et en quelque sorte nébuleux.“Owsjannikow:2 „Ces fibres au contraire prises sur l’ani-
mal vivant et humectées tout de suite avec de l’eau montrent dans
leur milieu une substance grise granulée, qui rapelle la structure
de la moelle des nerfs des animaux vertébrés, ce qui a conduit
Ehrenberg et Hannover à déclarer, que ces fibres ont une
moelle.“ (pag. 135.)Von den breiten Fasern sagt er, sie zeigten frisch eine Hülle
und einen klaren und durchsichtigen Inhalt. „Mais, lorsque la
préparation a été exposée à l’air pendant quelques minutes, on
distingue dans ce contenu liquide des fibrilles extrêmement fines
et en appuyant davantage sur le verre, elles se déplacent, se
déchirent et se réduisent en une masse uniforme.“Lemoine:3 „Le contenu des tubes est transparent, à peine
grenu dans quelques‑uns d’entre eux. Il est semi-liquide …
On ne voit rien au milieu de cette matière, qui rapelle le filament
axile, même par l’emploi de réactifs appropriés.“Gerade die letzten Untersucher der Nervenelemente des
Flusskrebses sprechen sich entschieden gegen die fibrilläre
Structur der Nervenfasern aus. So Yung in seinem kürzeren Auf-
satze:4 „Le contenu est semi-liquide, visqueux, toujours parfaite-
ment clair et homogène. L’eau distillée et la plupart des réactifs
y font apparaître des granulations décrites comme normales par
les premiers observateurs.“Und an anderer Stelle … „contrairement à l’opinion de
Remak on n’y rencontre jamais des faisceaux fibrillaires qui
puissent être homologuées avec le cylinder‑axis des nerfs des1Hannover, Recherches microscopiques sur le système nerveux.
1844.2Owsjannikow, Recherches sur la structure intime du système nerveux
des Crustacés etc. Annal. des scienc. naturell. 1861.3Lemoine, Recherches pour servir à l’histoire des systèmes nerveux
musculaire et glandulaire de l’écrevisse. Annal. des scienc. naturell. 1868.4 De la structure intime du système nerveux central des Crustacés
décapodes. Compt. rend. T. 88. 1879.S.
16
vertébrés. La structure fibrillaire n’apparaît qu’après l’action des
réactifs.“In seiner ausführlichen Abhandlung1 gibt er an, dass er
einmal das von Remak beschriebene Fibrillenbündel gesehen
habe. Er legt aber dieser Beobachtung keinen Werth bei;
dagegen hat er sich überzeugt, dass der Inhalt der Nervenfasern
mitunter auch im frischen Zustande granulirt ist:„Leur portion interne (der colossalen Fasern) présente
quelque‑fois, même à l’état tout à fait frais, un espace nébuleux
qui a déjà été mentionné par les anciens observateurs et particu-
lièrement par Remak. “… „Nous ne croyons donc pas à la présence d’un
véritable cylindre‑axe dans aucun des tubes nerveux des Crusta-
cés, mais il nous semble par contre indéniable, qu’il se présente
chez quelques‑uns un commencement de différenciation, qui
s‑accuse par un épaississement du protoplasma dans le centre du
tube, épaississement dont d’aspect nébuleux est la conséquence.“Krieger:2 „Im Gegensatz zu vielen Autoren muss ich nach
meinen Erfahrungen bestreiten, dass die starken, röhrigen
Fasern sich aus Primitivfibrillen zusammensetzen. Ihr Inhalt lässt
nämlich im vollkommen frischen Zustande nicht die geringste
Spur einer Streifung erkennen, sondern ist vollkommen homogen,
hell und dickflüssig, wie dies schon ältere Autoren, wie Helmholtz
und Haeckel richtig angeben und wie dies in neuerer Zeit
Yung bestätigt hat.“ (pag. 12.)Ferner: „Unter den Fasern der Längscommissuren zeichnen
sich jederseits zwei vor allen übrigen durch ihre Grösse aus. Es
sind dies die sogenannten colossalen Nervenfasern. In ihnen
entdeckte Remak ein Bündel von feinen Fasern, welches von den
meisten späteren Beobachtern wiedergefunden und als ein dem
Achsencylinder der Wirbelthiernervenfaser homologes Primitiv-
fibrillenbündel aufgefasst wurde. Auch ich habe dasselbe gesehen,
aber stets nur an solchen Fasern, welche in Zersetzung übergingen1Yung, Recherches sur la structure intime et les fonctions du
système nerveux central chez les Crustacés décapodes. Archive de zool.
expérim. VII.2Krieger, Über das Centralnervensystem des Flusskrebses. Dissert.
Leipzig, 1879.S.
17
und kann daher nicht umhin, es für ein bei der Zersetzung
entstehendes Gerinnungsproduct zu erklären. ...
… Hat man das Präparat einem eben getödteten oder
lebenden Thiere entnommen und sich bei der Präparation möglichst
beeilt, so wird zunächst der Inhalt auch der colossalen Nerven-
fasern vollkommen klar und homogen erscheinen. Doch schon
nach Verlauf von einer bis fünf Minuten ändert sich das Bild. In
der Mitte der Faser tritt ein zunächst feinkörniger Streif auf,
dessen Durchmesser etwa ein Viertel so gross ist als der der
ganzen Faser und wenig später gewahrt man in diesem Streif
zunächst noch sehr undeutlich gerade, längs verlaufende, äusserst
feine Linien, die mit der Zeit etwas deutlicher werden, aber immer
etwas blass bleiben. Noch später beginnt der Streif, der also jetzt
als Fibrillenbündel erscheint, sich ganz allmälig in Form einer
Schlangenlinie zu krümmen.“Er beschreibt sodann die weiteren Veränderungen dieses
„Fibrillenbündels“ und gelangt zum Schluss, dass Fibrillen
in demselben gar nicht vorhanden sind, sondern dass die
erwähnten Bilder durch Flüssigkeiten von verschiedener Dichtig-
keit, in welche der Inhalt zerfallen ist, und die in dünnen Lagen
neben einander liegen, vorgetäuscht werden. (pag. 14.)Endlich ist anzuführen, dass in dem ausgezeichneten Buche
von Huxley1 über den Krebs, welches seiner Anlage nach zur
Verbreitung ganz gesicherter Kenntnisse bestimmt ist, sich
folgende Angabe über die Structur der Nervenfasern findet.„In vollständig frischem Zustande ist der Inhalt der Röhren
ganz durchsichtig und ohne die geringste Andeutung einer
Structur, und aus der Art und Weise, wie der Inhalt aus den
abgeschnittenen Enden der Röhren hervorquillt, kann man ent-
nehmen, dass derselbe aus einer Flüssigkeit von gallertartiger
Consistenz besteht. Wenn die Faser abstirbt unter dem Einflusse
von Wasser und vielen chemischen Reagentien zerfällt der
Inhalt in Kügelchen oder wird trübe und feinkörnig.“ (pag. 160.)1Huxley, Der Krebs. XLVIII. Band der internationalen wissen-
schaftlichen Bibliothek, 1881.S.
18
Schon an den ersten Präparaten von Nervenfasern des
Flusskrebses, welche ich in Krebsblut untersuchte, sah ich das
von Remak entdeckte Fibrillenbündel in den hellen breiten
Röhren und überdiess feine, offenbar im Inneren der Faser ent-
haltene Fibrillen in manchen minder breiten, gewöhnlich als
„granulär“ beschriebenen Elementen. Ein anderer Theil der
Fasern zeigte Körnchen, Stäbchen und Bröckel, welche ich als
Zerfallsproducte feiner Fibrillen deuten musste, da oftmals in
derselben Faser an einer Stelle deutliche Fibrillen, an anderen
Stellen noch in Längsreihen angeordnete Körnchen zu sehen
waren. Aber ein Theil der Fasern erschien homogen und ich
überzeugte mich bald, dass das homogene wie das fibrilläre
Ansehen weder an bestimmte Arten von Fasern, noch an bestimmte
Localitäten in den Ganglien und Nervensträngen geknüpft sei.
Vielmehr ergab es sich, dass in ganz regelloser Weise die einander
dem Ort und dem Kaliber nach entsprechenden Fasern an ver-
schiedenen Präparaten bald fibrillär, bald granulirt oder homogen
erschienen. Selbst in den colossalen Fasern war oft keine Spur
des Fibrillenbündels zu entdecken. Dagegen erhielt ich Präparate,
in denen sich alle Fasern granulirt oder selbst homogen zeigten.
Da mit der Beobachtung, dass gelegentlich in manchen Nerven-
fasern Fibrillen sichtbar werden, eine Lösung der hier in Betracht
kommenden Frage nicht gewonnen war, musste ich einerseits
nach den Bedingungen, unter welchen sich Fibrillen in allen
Fasern zeigen, anderseits nach dem Grunde, wesshalb sie so oft
nicht aufzufinden sind, suchen. Dass die so scharf und regel-
mässig gezeichneten Fibrillen durch die Zersetzung in einer
homogenen oder körnigen Masse entstehen, war mir von Anfang
an unwahrscheinlich; doch habe ich eine Zeit lang auch diese
Möglichkeit in Betracht gezogen.Endlich gelang es mir, unter günstigen Umständen Präparate
zu erhalten, an welchen alle Nervenfasern als fibrillär zu erkennen
waren. Die Fibrillen verlaufen in solchen als frisch oder über-
lebend zu bezeichnenden Nerven nicht wellig, wie Remak1
das Fibrillenbündel der colossalen Faserngezeichnet hat, sondern1Remak, Neurologische Erläuterungen. Müller’s Archiv, Taf. XII, Fig. 8.
S.
19
geradlinig und vollkommen isolirt von einander. Varicositäten an
denselben oder Körnchen in der Zwischensubstanz zwischen ihnen
kommen in den frischen Fasern nicht vor. Dietl1 hat angegeben,
dass die Primitivfibrillen in den Nervenfasern der Evertebraten
während ihres Verlaufes zahlreiche Anastomosen eingehen und so
einen feingenetzten Strang darstellen. Aber Dietl schliesst aus
dem Ansehen der Nervenfasern nach Behandlung mit Reagentien,
vorzugsweise Überosmiumsäure, auf deren Verhalten im Leben
und die Untersuchung frischer Nervenfasern ist ohne Zweifel
massgebender. Ferner muss ich gegen Owsjannikow’s und
Krieger’s bereits erwähnte Angaben hervorheben, dass die
Fibrillen allsogleich und nicht erst nach längerem Zuwarten her-
vortreten, so dass kein Grund bleibt, an ihrer Präexistenz zu
zweifeln.Natürlich sind nur die im Object oberflächlich liegenden
Fasern einer überzeugenden Untersuchung zugänglich, doch wird
es dem geübten Auge nicht schwer, die Fibrillen auch in tieferen
Schichten aufzufinden. Eine Verwechslung derselben mit den
Bindegewebsfasern zwischen den Nervenröhren ist nicht zu
besorgen. Man kann auf verschiedene Weisen feststellen, dass die
Fibrillen dem Inhalte und nicht etwa der Wandung der Nerven-
röhren angehören.Die Analogie mit dem weit von der Wand
abliegenden Fibrillenbündel der colossalen Fasern ist der nächst-
liegende Beweis dafür; doch erlaubt die Grösse vieler Nerven-
röhren und die Kennzeichnung der Niveaus der Wandung durch
zahlreiche längliche Kerne die Lagerung der Fibrillen im Inneren
der Faser in directer Weise mit der Stellschraube zu ermitteln.
Ferner zeigt der Querschnitt oder die Umbiegung einer Faser-
schlinge deutlich das Bild distincter, im Lumen des Rohres
befindlicher Punkte, welche sich bei anderer Einstellung zu Fäden
verlängern. (Solche oberflächliche Faserschlingen kommen zahl-
reich in den unversehrten Ganglien von Squilla mantis, die ich
mehrmals zu untersuchen Gelegenheit hatte, zur Beobachtung.)
Endlich sind die Veränderungen, welche in den frischen Nerven
während der Untersuchung vor sich gehen, für den zu erbringenden1Dietl, Die Gewebselemente des Centralnervensystems bei wirbel-
losen Thieren pag. 17. (Sep. Abdruck aus den Berichten des naturw. medic.
Vereins in Innsbruck. 1878.)S.
20
Beweis verwerthbar. In den schmaleren Fasern werden die
Fibrillen oft varicös, zerfallen dann in dicke Stäbchen, die zuerst
noch die Anordnung in Längsreihen beibehalten und gehen dann
in kleinere und grössere Klümpchen über, welche mitunter leb-
hafte Brown’sche Bewegung zeigen. Die Fibrillen der colossalen
Fasern biegen sich mitunter derart zusammen, dass an einer Stelle
der Fasern ein Knäuel von in Körnchen zerfallenden Fäden zu
liegen kommt, während an anderen Stellen die Faser homogen
erscheint. Viele Bilder, welche derzersetzte Inhalt der Nerven-
faser ausser den hier erwähnten zeigt, sind schon von Haeckel
treffend beschrieben worden.Um die frischen Nervenfasern, welche ich in ganz überein-
stimmender Weise beim Flusskrebs wie beim Hummer gesehen
habe, in möglichst grosser Zahl zu erhalten, muss man das Object
einem noch lebhaften Thiere entnehmen und mit ganz besonderer
Vorsicht und Schonung präpariren. Es ist zu empfehlen, längere
Stücke der Commissuren oder ein ganzes Ganglion unter das
Mikroskop zu bringen, denn ich habe gefunden, dass das Ein-
dringen des Krebsblutes von der Schnittstelle aus hinreicht, die
feine Structur der Nervenfasern zu zerstören. Man kann oft sehen,
dass die nämliche Faser, welche in dem grösseren Theil ihrer
Strecke bis zum Eintritt ins Ganglion noch geradlinige Fibrillen
zeigt, an der Schnittstelle und ein Stückchen nach aufwärts
davon nur mehr Körner und unregelmässige Klumpen enthält.
Auch ist es Regel, dass nur das erste Ganglion, das man dem
lebenden Thiere entnimmt, alle Fasern in dem Zustande zeigt,
welchen ich als den frischen beschrieben habe. Das zweite, einige
Minuten später herauspräparirte lässt nur wenige unveränderte
Fasern erkennen; die später untersuchten Ganglien und Nerven-
stücke vielleicht blos homogene oder granulirte Elemente. Dem-
nach wäre auch das Krebsblut nicht als absolut unschädliche
Zusatzflüssigkeit zu bezeichnen. Es wird bei dieser ungemein
grossen Zerstörbarkeit der Nervenfasern begreiflich, dass man bei
jeder Präparation einigermassen auf den Zufall angewiesen ist,
um ausschliesslich unveränderte Elemente zu Gesichte zu bekom-
men. Doch habe ich jedesmal, wenn meine Ueberzeugung durch
eine Reihe von missglückten Präparaten erschüttert worden war,
durch einen erneuerten Versuch unter günstigeren BedingungenS.
21
mich immer wieder von dem Vorhandensein der beschriebenen
Structurverhältnisse versichern können.Die grosse Hinfälligkeit der Fibrillen in den Nervenfasern
erklärt hinreichend die ungenügenden Beobachtungen der Autoren
sowie das granulirte Aussehen der Nervenfasern nach Behandlung
mit Reagentien. Doch verhalten sich nicht alle Nervenfasern oder
alle Stellen derselben Faser in dieser Hinsicht gleich. An dem als
Ausläufer beschriebenen Übergangsstücke zwischen Nervenzelle
und Faser ist die fibrilläre Structur in hohem Grade haltbar.
Wenn man an einem Ganglion keine einzige fibrilläre Faser mehr
erblicken kann, reicht gewöhnlich ein gelinder Druck hin, um
der noch deutlich fibrillären Zellfortsätze ansichtig zu werden.
Auch wenn man erst 24 Stunden nach dem Tode des Thieres
untersucht, sind die feinen Fibrillen der Zellfortsätze oder Anfangs-
stücke der Fasern gut zu erkennen. Dieselben überdauern auch
die Einwirkung von Reagentien und sind an Überosmium‑ und
Chromsäurepräparaten mehreren Autoren, so zuletzt Krieger,1
aufgefallen.Wenn man aber mit Rücksicht auf den Widerspruch der
meisten neueren Autoren (Leydig, Waldeyer, Dietl etc.) mit
Ausnahme von Claus2 die Nervenfaser der Bauchganglienkette
nicht als unmittelbare Fortsetzungen der Nervenzellausläufer
gelten lassen will, so ist auf ein anderes Object zu verweisen, an
dem die fibrilläre Structur der Nervenfasern sich viel widerstands-
fähiger zeigt und demgemäss leichter zu bestätigen ist. Es sind
dies die Fasern der sympathischen, den Magen umspinnenden
Geflechte, welche besonders in einem spindelförmigen, dem Magen
aufliegenden Ganglion sich mit grosser Sicherheit zu Zellen ver-
folgen lassen.3 (Ganglion e in Fig. 1 und 2 auf Brandt’s Taf. IV.)
Diese von einer dicken Scheide umgebene und im frischen
Zustande förmlich, wie Haeckel4 beschreibt, „aus dem Binde-
gewebe hervorleuchtenden Fasern“ zeigen die fibrilläre Structur1l. c. pag. 9.
2Claus, Der Organismus der Phronimiden. Arbeiten des zool.
Instituts zu Wien. Tom. II.3J. F. Brandt, Remarques sur les nerfs stomato‑gastriques etc.
Annal. des scienc. naturell. 1836.4l. c. pag. 11.
S.
22
aufs Schönste und werden, vielleicht wegen der leichteren Präpa-
ration, vielleicht auch in Folge ihrer dickeren Hüllen häufiger als
die Fasern des Bauchmarks unversehrt erhalten. (Fig. 3.)Ich darf nicht versäumen hervorzuheben, dass ausser den
Fibrillen ein anderer von allen Beschreibern ausser Waldeyer
anerkannter Bestandtheil im Inhalt der Nervenfasern zu sehen ist.
Da jede einzelne Fibrille von den anderen isolirt erscheint, muss
man eine homogene Substanz annehmen, welche die Zwischen-
räume zwischen den einzelnen Fibrillen und zwischen der
Fibrillenmasse und der Scheide ausfüllt. In den Zellfortsätzen ist
diese Substanz mächtiger und drängt die Fibrillen auseinander;
ich werde zeigen, dass sie sich mit etwas veränderten Eigen-
schaften in den Zellleib fortsetzt. Das helle Aussehen der colossalen
und einiger minder breiten Nervenfasern ist meiner Ansicht nach
ebenfalls nur durch Anhäufung dieser Substanz zwischen Scheide
und Fibrillenbündel verursacht. Leydig1 möchte die helle Sub-
stanz der colossalen Fasern dem Mark in den Nervenfasern der
Wirbelthiere gleichstellen, aber beide Substanzen treffen in keiner
Eigenthümlichkeit zusammen. Die homogene Masse der colossalen
Fasern ist wenig glänzend, schwärzt sich nicht auffällig mit
Überosmiumsäure und ist durch nichts vom Fibrillenbündel
geschieden, steht vielmehr mit der Substanz zwischen den
einzelnen Fibrillen in unmittelbarem Zusammenhange, und ich
möchte sie als identisch mit derselben auffassen. Ich muss also
Waldeyer2 zustimmen, dass die colossalen Nervenfasern nicht
als besondere Fasergattung aufzustellen sind und kann mit
Remak nur die homogene Masse zusammt dem Fibrilleninhalt
dem Axencylinder der Wirbelthiere gleichstellen. Wesshalb die
Zwischensubstanz in den colossalen Fasern in so grosser Menge
auftritt, lässt sich wohl so lange nicht verstehen, als nicht das
Verhalten der letzteren zu den Nervenzellen erkannt ist.Der Inhalt der Nervenfasern des Flusskrebses, und zwar
sowohl der Fasern des Centralorgans als der peripheren Nerven und
der sympathischen Geflechte, besteht also aus geradlinigen,1Histologie pag. 59 und Zur Anatomie von Coccus hesperidum,
Zeitschr. f. wiss. Zool. V. 1853.2l. c. pag. 207.
S.
23
isolirten, in eine homogene Substanz eingebetteten
Fibrillen von sehr grosser, aber nicht an allen Stellen
gleicher Hinfälligkeit.III.
Die in der Literatur vorhandenen Angaben über die Nerven-
zellen des Krebses
gestatten eine kurze Zusammenfassung. Es ist hier wiederum Remak,
der eine für die Erkenntniss der Structur grundlegende Beobachtung am
frischen Gewebe gemacht hat. An die Erörterung, welche Bedeutung das
centrale Fibrillenbündel habe, anknüpfend, sagt er in den Neurologischen
Erläuterungen:1 „Wo nämlich ein feineres Rohr (p), in welchem man blos
pulvrigen und keinen fasrigen Inhalt unterscheidet, in eine Ganglienkugel
übergeht, erkennt man zuweilen in der letzteren (r), dass sehr zarte, granulirte,
den Rand umkreisende Fasern die Substanz der Kugel zusammensetzen
und sich an der Übergangsstelle der Kugel in das Rohr sammelnd eine
Fortsetzung des pulvrigen Inhaltes des letzteren bilden. Daraus wird es um
so wahrscheinlicher, dass auch die dünneren Röhren einen fasrigen Inhalt
haben, welcher nur der grösseren Zartheit wegen leichter in eine pulvrige
Masse zerfällt.“Remak’s Fig. 9 auf Taf. XX stellt dieses Verhältniss in
schematischer Weise dar.Auch Walter2 beschreibt den Inhalt der grossen Nervenzellen als
concentrisch geschichtet und dunkelkörnig und gibt auf Tafel III seines Werkes
mehrere ziemlich gelungene Abbildungen dieser Structur, ohne dieselbe
einer eingehenden Erörterung zu unterwerfen.Dietl3 hat die concentrische Streifung des Zellleibes an Osmium‑
Präparaten gesehen. Er ist geneigt, dieselbe auch für
das frische Gewebe anzunehmen. Dieselbe „arrangirt sich“ –
nach Dietl’s Ausdruck – „um den Kern und setzt sich stets auf
den Fortsatz der Nervenzelle, welcher sich ja aus dem Protoplasma
derselben entwickelt, ununterbrochen fort.“1Müller’s Archiv 1844, pag. 469.
2l. c. pag. 29.
3l. c. pag. 7.
S.
24
Krieger1 konnte dieselbe Structur nur an durch Reagentien
veränderten Stellen sehen; er fand das Protoplasma der Ganglien-
zellen im frischen Zustande „feinkörnig, sonst aber vollkommen
homogen“.Die anderen, schon bei der Literatur der Nervenfasern
erwähnten Autoren äussern sich entweder blos über die Con-
sistenz des Zellleibes oder bezeichnen die Zelle als granulirt,
feinkörnig u. dgl. Waldeyer2 bestreitet ausdrücklich die von
Walter beschriebene Schichtung des Protoplasmas. Yung
nennt in ganz besonders ungenauer Weise den Inhalt der Nerven-
zellen in allen Punkten identisch mit den der Nervenfasern.Der Kern der Nervenzellen wird übereinstimmend als
kugeliger, von dicker Membran begrenzter Körper beschrieben,
dessen Inhalt entweder homogen oder feinkörnig erscheint. Das
Vorkommen von zwei oder drei stark glänzenden, kugeligen
Kernkörpern ist von den meisten Beobachtern erkannt worden.Von vielen Autoren (Dietl, Krieger, Walter etc.) werden
verschiedene Arten von Nervenzellen aufgestellt, welche sich
durch die Anzahl der Fortsätze, das relative Massenverhältniss
von Kern und Zellleib und andere Merkmale von einander trennen
lassen sollen. Ich gehe auf diese Eintheilungsversuche nicht ein,
weil ich glaube, dass uns die wesentlichen Kriterien für eine
Klassificirung der Nervenzellen gegenwärtig fehlen, und wende
mich zur Darstellung der Beobachtungen, welche ich an den
grossen Zellen der Bauchganglienkette und an den Zellen des
schon erwähnten spindelförmigen Magenganglions gemacht habe.Ich muss vorausschicken, dass ich ganz unzweifelhafte
Kennzeichen des überlebenden Zustandes an den Nervenzellen
gefunden habe, welche bei der Beschreibung des Kernes und
seines Inhaltes angeführt werden sollen. Im Zellleib frischer
Nervenzellen aus dem Gehirn oder einem Ganglion des Fluss-
krebses erkennt man leicht die zuerst von Remak gesehene
Structur, welche einer eingehenden Untersuchung würdig er-
scheint. Das Protoplasma der Zelle zeigt bei schwacher1l. c. pag. 8.
2l. c. pag, 230.
S.
25
Vergrösserung ein eigenthümlich mattes, wie chagrinirtes Ansehen, das
man bei oberflächlicher Betrachtung wohl als „granulirt“ be-
zeichnen könnte. Aber wenn man bei stärkerer Vergrösserung
aufmerksamer prüft, ist man erstaunt, kaum ein einziges isolirtes
Körnchen im Zellleibe zu begegnen. Vielmehr erkennt man jetzt
deutlich eine Streifung, welche einerseits um den Kern con-
centrisch, andererseits gegen den Fortsatz der unipolaren Zelle
convergirend verläuft. An einen schaligen oder geschichteten Bau
des Zellleibes zu denken, verbietet die Beobachtung, dass jene
Streifen niemals ganze Kreise, sondern immer nur kleine Bogen-
stücke darstellen. Fasst man einen einzelnen Streifen in’s Auge,
so merkt man, dass er nach kurzem Verlaufe abbricht; die
helleren Zwischenräume, welche gestatten, ihn isolirt zu erkennen,
sind entfallen, und der eine Streif mit einem anderen zusammen-
getroffen. Ich kann dieses Bild nicht anders auffassen, als dass
man es hier mit zarten Strängen zu thun hat, welche ein Netz mit
gestreckten, um den Kern concentrisch angeordneten Maschen-
räumen bilden. Gegen den Fortsatz hin ist dieses Netz offen,
wie wenn ein gestrickter Beutel über einen Spielball gezogen ist.
Im Fortsatz der Nervenzelle treten die Stränge zusammen und
gehen unmittelbar jeder in eine Fibrille der Nervenfaser über.
Es wäre incorrect zu sagen, die Fibrillen der Nervenfaser setzen
sich auseinanderfahrend in die Zelle fort und umspinnen den Kern,
denn das optische Ansehen der Protoplasmastränge im Zellleibe
ist ein ganz anderes als das der Fibrillen. Die Stränge sind breiter
als die Fibrillen, ungleich breit an verschiedenen Stellen, rauh
und an den Rändern verschwommen, während die Fibrillen als
feine, aber scharf gezeichnete Linien erscheinen.Im Übergangsstücke zwischen Zelle und Faser nehmen die
Fibrillen allmälig die Eigenschaften der Stränge an; sie fahren
auseinander, werden rauher und breiter, scheinen aber noch nicht
mit einander zu anastomosiren. Andere faserige Bildungen als die
beschriebenen Stränge finden sich in der Zelle nicht. Einige
Fibrillen lassen sich etwas weiter als andere in den Fortsatz ver-
folgen; in der Zelle selbst erscheint keine einzige mehr mit den
Eigenthümlichkeiten, welche sie in der Nervenfaser auszeichneten.In manchen Zellen ist ein Übergangsstück zwischen Zellleib
und Nervenfaser nicht vorhanden; die Nervenfaser entspringt inS.
26
anderer, sehr eigenthümlicher Weise. Dieselbe schmiegt sich
nämlich in Gestalt eines hellen Halbringes der Peripherie der
Zelle an, um dann in’s Innere des Zellleibes einzutreten. (Vgl.
Fig. 1 und 5.) Dabei liegen die Hülle der Nervenfaser und die
Wandschicht der Zelle in einer Flucht. Krieger,1 welcher dieses
Verhältniss bereits beobachtet hat, bemerkt mit Recht, dass
dadurch mitunter ein Kernfortsatz vorgetäuscht werden kann.
Er fügt aber hinzu: „Ich möchte jedoch diesen Bildern keine zu
grosse Beweiskraft zuschreiben, da die Zellen, an denen sie auf-
treten, meist schlecht erhalten sind.“Die im Vorigen beschriebene, durch Zeichnung nur schwer
zu versinnlichende Structur der Zelle – ich muss zugestehen,
dass meine Abbildungen dieselbe nur sehr unvollkommen wieder-
geben – kommt dem Elemente im Gehirn und in der Bauch-
ganglienkette zu. Die Nervenzellen der sympathischen Magen‑
und Darmganglien bieten ein etwas anderes Bild. Sie sind zwar
ebenfalls wie chagrinirt und frei von Körnchen, aber die Streifung,
insbesondere die concentrische, ist oft minder deutlich und ich
muss bekennen, dass ich ohne den Vergleich mit den Zellen des
Gehirns und der Bauchganglien dieselben nicht recht zu be-
schreiben wüsste. Ich glaube aber, dass die Annahme einer
dichteren Anordnung der Netzstränge des Protoplasmas der
Erscheinung der sympathischen Zellen gerecht zu werden vermag.
Die Ausbreitung und Einstrahlung der Fibrillen des Fortsatzes in
die Zelle weist mancherlei, wie es scheint, unwesentliche Modi-
ficationen auf, z. B., dass die Fibrillen im Übergangsstück, ehe
sie auseinanderfahren, einen Wirbel bilden; dass oft eine Anzahl
von Fibrillen eine längere Strecke zu einem Bündel vereinigt
bleibt u. dgl. An den bipolaren Zellen, welche neben den uni-
polaren mit getheiltem Fortsatz zahlreich unter den sympathischen
Elementen vorkommen, sieht man am besten, dass mehrere
Fibrillen ganz nahe der Oberfläche der Zelle verlaufen; niemals
gelingt es aber, eine solche oberflächliche Fibrille aus dem einen
Fortsatze durch die Zelle hindurch in den anderen zu verfolgen.
Es geht daraus hervor, dass das Schicksal der Fibrillen in den
sympathischen Zellen dasselbe ist, wie in den Zellen der Bauchganglien:1l. c. pag. 9.
S.
27
nach kurzem isolirtem Verlaufe gehen sie in die Substanz
des Zellleibes über. Einige Male beobachtete ich frische sym-
pathische Nervenzellen, deren Fortsatz, nachdem er die Zelle
verlassen hatte, in eine zweite, kleinere und kernlose Anschwellung
eintrat. Diese aus dunklerer Substanz bestehende und von den
Fibrillen durchsetzte Anschwellung war durch einen ganz kurzen
Hals mit der Nervenzelle verbunden und sah einem abgeschnürten
Stücke derselben gleich. Key und Retzius bilden in ihren
„Studien in der Anatomie des Nervensystems und des Binde-
gewebes, Zweite Hälfte 1876“ in Fig. 17 auf Taf. XIX eine Zelle
mit solchem Abschnitt aus dem Sympathicus der Katze ab und
bezeichnen dieselben als „eingeschnürt“. Auch die Fig. 234 der
Technischen Histologie von Ranvier (fünfte Lieferung 1879,
pag. 663 der deutschen Übersetzung) zeigt eine ähnlich gebildete
Zelle aus einem Spinalganglion des Rochen.Der Kern erscheint in vielen überlebenden Zellen als ein
hyaliner, undeutlich begrenzter Körper, doch bildet sich gewöhn-
lich nach kurzem Verweilen unter dem Mikroskop eine feine
Linie als Grenze des nun rundlichen Kernes aus. Die meisten
nach anderen Kennzeichen als lebensfrisch zu bezeichnenden
Zellen zeigen eine solche Grenzlinie des Kernes von Anfang an,
welche aber immer von der dicken, als Durchschnitt der Kern-
membran beschriebenen Linie in abgestorbenen Zellen zu unter-
scheiden ist. Im Inneren des Kernes der Hirn‑ und Bauchganglien-
zellen finden sich gewöhnlich zwei, seltener drei rundliche, stark
glänzende Kernkörper und ausserdem eine wechselnde Anzahl
von sehr verschieden gestalteten, bisher in Nervenzellkernen
noch nicht beschriebenen Bildungen. (Vgl. Fig. 1, 2, 4a und b,
und 5.) Dieselben sind entweder kurze, dicke Stäbchen oder
lange, dünne, den ganzen Kern durchsetzende, gerade oder
gewundene Fäden, oder winkelig geknickte, gegabelte, oft sehr
zierliche Körper. Mitunter treten mehrere dieser Intranucleolar-
gebilde zu sehr complicirten Figuren zusammen, deren Arme in
verschiedenen Ebenen liegen. Bei Squilla mantis fand ich einmal
in jedem Nervenzellkerne eine schöne, aus zwölf und mehr
Gliedern bestehende Rosette, beim Flusskrebse manchmal fünf‑
und sechsstrahlige Sterne. In den sympathischen Zellen des Fluss-
krebses konnte ich blos die kurzen, dicken Stäbchen wiederfinden,S.
28
auch habe ich mehrmals diese neuen Kerngebilde selbst in den
centralen Nervenzellen vermisst. Sonst konnte ich mich überzeugen,
dass dieselben bei grossen und kleinen Exemplaren im Sommer
wie im Winter vorkommen, und zwar bei einigen Thieren sehr
reichlich, bei anderen in geringer Anzahl.Beide Arten von Kerngebilden, die rundlichen wie die
unregelmässig gestalteten, zeigen Bewegungserscheinungen und
Formveränderungen, welche mir als Beweis für den überlebenden
Zustand der untersuchten Elemente dienten. Die Veränderungen
der grossen rundlichen Kernkörper beschränken sich auf einen
langsamen Wechsel der fleckigen Zeichnung, welche an ihnen
ersichtlich ist, und auf geringe Verschiebungen ihres Ortes im
Kern. Die letzteren sind nur unter gewissen Bedingungen deutlich
zu erkennen, z. B. wenn die gewöhnlich der Kernwandschichte
nahe liegenden Kernkörper einander im Gesichtsfelde über-
schneiden, so dass von dem tiefer liegenden nur ein Abschnitt
sichtbar bleibt. Die Fig. 4 a und b stellt einen solchen Kern dar,
in welchem das obere Kernkörperchen allmälig über das untere
rückte, bis es dieses ganz verdeckt hatte.Viel auffälliger sind die Veränderungen der unregelmässigen
Kerngebilde. Bei winkelig geknickten Stäben ändert sich der
Winkel zwischen den einzelnen Gliedern; bei sternförmigen
Figuren die Stellung der einzelnen Strahlen zu einander. Wo
mehrere solche Figuren in einem Kerne vorhanden sind, nähern
und entfernen sie sich von einander; von einem mehrfach
gewundenen Faden taucht bald hier, bald dort eine Umbiegung
oder ein freies Ende auf. Mitunter scheint eine complicirte Figur
zu zerbrechen, indem ein Verbindungsstück zwischen zwei Theilen
derselben zuerst dünner, dann unsichtbar wird; manchmal trifft
man auf deutlich getrennte Stücke, welche noch in einer Linie
liegen, als ob sie früher vereinigt gewesen wären. (Vgl. Fig. 1.)
Ein Stück einer Figur scheint sich der Oberfläche des Kernes zu
nähern, ein anderes von ihr zu entfernen. Es erscheinen neue
Stäbchen, von denen man nicht weiss, ob sie mit schon vorher
sichtbaren zusammenhängen oder isolirt sind. Es ist nicht meine
Absicht, alle Mannigfaltigkeiten in der Erscheinung dieser schönen
Gebilde zu beschreiben; das Wesentliche bleibt, die Thatsache
ihrer grossen Veränderlichkeit zu constatiren.S.
29
Die beschriebenen Veränderungen gehen manchmal so rasch
vor sich, dass es schwer ist, irgend ein bestimmtes Aussehen des
Kernes durch Zeichnung festzuhalten; andere Male so langsam
und allmälig, dass man erst nach Minuten einen Wechsel in der
Erscheinung oder Lage der Kerngebilde constatiren kann. Oft
genug erscheinen dieselben ruhend; doch ist man dann begreif-
licherweise nicht in der Lage, die Vermuthung, dass der Zellkern
seine Lebenseigenschaften zu verlieren beginne, zurückzuweisen.Vielleicht bezieht sich auf diese Art von Kernkörpern eine
alte Angabe von Will1 in dessen vorläufiger Mittheilung „Über
die Structur der Ganglien und den Ursprung der Nerven bei
wirbellosen Thieren“: „In den Nervenkörpern von Astacus
fluviatilis sah ich öfters statt des gewöhnlichen feingekörnten
Kernes der inneren Zelle 2, 3 auch 4 cylindrische, auf
beiden Seiten mit einer stumpfen Spitze versehene und etwas
gekrümmte Körperchen, welche Krystallen nicht unähnlich waren“.
Die Bemerkung „statt des Kernes“ würde darauf zu deuten sein,
dass Will frische Zellen, an denen die deutliche Kernmembran
fehlte, beobachtet hat.Auch das Studium des Absterbens der Zellen gewährt einige
Aufschlüsse über die Structur derselben. Wenn die Elemente
einige Zeit der Beobachtung unterworfen waren, oder bei der
Präparation beschädigt worden sind, tritt eine Reihe von Bildern
auf, deren Zurückführung auf den sie verursachenden Insult nur
in wenigen Fällen gelingt, so dass ich bei der Beschreibung
derselben von der Verfolgung dieses Zusammenhanges Umgang
nehmen will. An den grossen unipolaren Zellen erscheint eine
oft sehr breite, einen grösseren oder geringeren Theil der Zell-
peripherie einnehmende Zone, welche durchaus homogen und
dem Kerninhalt ähnlich ist. Ich möchte hierin keine Quellung
des Protoplasmas erblicken, weil keine Volumszunahme der Zelle
damit verbunden ist. Vielmehr glaube ich, dass diese homogene
Zone durch den als „Zwischensubstanz“ beschriebenen Bestand-
theil des Zellleibes gebildet wird, aus welcher die netzförmige,
dunklere Substanz sich gegen den Kern zurückgezogen hat. Es
finden sich auch häufig genug Zellen, an denen zwei homogene1Müller’s Archiv 1844, pag. 80.
S.
30
Randpartien durch einen dünnen Strang dunklerer, genetzter
Substanz, welcher noch an der Peripherie festgehalten ist, getrennt
werden. Recht auffällig sind die Massen hyaliner Substanz, welche
sich an den sympathischen Zellen, der concentrisch geschichteten
Zellscheide anliegend, finden. (Fig. 3 hm.) Ihr vorwiegendes
Vorkommen an der Stelle, wo sich der Fortsatz der Nervenzelle
entwickelt, der stärkere Glanz und das Auftreten in Zellen,
welche sonst keine Zeichen des Absterbens bieten, lassen es
überhaupt zweifelhaft erscheinen, ob sie nicht vielmehr normale,
der lebenden Zelle eigenthümliche Bildungen sind. Dazu kommt,
dass ich dieselben an sympathischen Zellen nie während der
Beobachtung auftreten sah.Das Protoplasma der Nervenzellen im Gehirn und den
Bauchganglien wird unter den Augen des Beobachters körnig,
die netzförmige Structur immer mehr undeutlich; doch erhalten
sich Andeutungen der concentrischen Streifung noch dann, wenn
die Zelle sonst keine andere Ähnlichkeit mit einer überlebenden
zeigt. Zellen, welche bei der Präparation verletzt wurden – und
diese bilden die weitaus überwiegende Mehrheit – haben ein
gleichmässig gekörntes Protoplasma, meist ohne Spuren von con-
centrischer Streifung. Hat man zufällig die Nadelspitzen in die
Substanz einer Zelle selbst eingesetzt, so erscheint deren Proto-
plasma an den verletzten Stellen zu feinen Fäden ausgezogen,
welche mit kleinen Klümpchen oder Körnchen besetzt sind.
Diese Beobachtung zeigt, dass dem Protoplasma ein nicht geringer
Grad von Conhaerenz eigen ist; eine leichtflüssige Masse könnte
unmöglich diese Bilder geben. Dass man die so misshandelten
Zellen nicht mit den multipolaren, von denen später die Rede sein
wird, verwechseln darf, scheint vielleicht unnöthig zu bemerken.Die sympathischen Zellen werden beim Absterben ebenfalls
körnig, oder zeigen, besonders wenn die Hülle des Ganglions
abpräparirt wurde, das von Leydig1 für andere Objecte be-
schriebene „grobbröckelige“ Ansehen: dunklere Kugeln fein-
gekörnter Masse in einer helleren Umgebung.Wie verschieden sich die Kernmembran selbst an anschei-
nend überlebenden Zellen verhält, ist schon oben erwähnt worden.1Leydig, Vom Bau des thierischen Körpers. 1864. pag. 85.
S.
31
Hervorzuheben ist jedoch, dass in frischen Zellen entweder keine,
oder eine nur sehr feine Grenzlinie des Kernes sichtbar wird,
während der Kern der abgestorbenen Zelle eine dicke, doppelt
contourirte, eigentliche Kernmembran zeigt. Der Kerninhalt
misshandelter Zellen erscheint fein granulirt, der frischer Zellen
wird es allmälig, während gleichzeitig die rundlichen Körperchen
sich schärfer contouriren, und die Stäbchen, Rosetten u. dgl.
blässer, undeutlicher werden und endlich ganz verschwinden.
Nur einzelne kurze, dicke Klümpchen sind auch im granulirt
gewordenen Kerne zu sehen. Mehrmals sah ich, wie im Kerne
einer zur Beobachtung gelangten Zelle die Körnchen sich ver-
grösserten, zu groben, abgerundeten Klumpen heranwuchsen und
endlich in eine heftige Bewegung in der nun dickwandigen Kern-
blase geriethen.Aus den bisher beschriebenen Veränderungen, welche die
überlebende Nervenzelle beim Absterben erleidet, erklärt sich das
Bild der mit Reagentien behandelten Zelle und die darauf
gegründete Beschreibung vieler Autoren. Die verschiedenen
Bestandtheile der Zelle sind in ähnlicher Weise, wie es sich für
die Nervenfaser ergeben hat, in verschiedenem Grade haltbar.
Die concentrische Streifung im Protoplasma wird unter günstigen
Umständen durch Reagentien mit etwas verändertem Charakter
erhalten; daher dieses Structurverhältniss auch von mehreren
Autoren, wie bereits erwähnt, beschrieben und abgebildet wurde.
Die nicht kugeligen Kerngebilde scheinen gegen mechanische
oder chemische Insulte ganz besonders empfindlich zu sein; dem
entspricht auch der Umstand, dass sie den früheren Untersuchern
entgangen sind.Die Ergebnisse meiner Beobachtungen über die Nervenzellen
des Flusskrebses lassen sich also folgendermassen zusammen-
fassen: Die Nervenzellen im Gehirn und in der Bauch-
ganglienkette bestehen aus zwei Substanzen, von
denen die eine, netzförmig angeordnete, sich in die
Fibrillen der Nervenfasern, die andere, homogene in
die Zwischensubstanz derselben fortsetzt. Der Kern
der Nervenzelle besteht aus einer gegen den Zellleib
nichtscharf abgegrenzten, homogenen Masse, in
welcher geformte Bildungen von verschiedener GestaltS.
32
und Haltbarkeit sichtbar sind. Diese Inhaltskörper des
Kernes zeigen Form‑ und Ortsveränderungen, durch
welche der überlebende Zustand der Zelle dargethan
wird.Es ist nochmals hervorzuheben, dass die Bilder, auf welche
sich diese Darstellung des Baues der Nervenzellen gründet, in den
meisten Präparaten nur in geringer Anzahl gefunden werden,
während die Mehrzahl der Elemente den Beschreibungen anderer
Autoren mehr oder minder entspricht. Doch hat die Untersuchung
des frischen Nervengewebes den besonderen Vortheil, dass sie zu
entscheiden erlaubt, welche Bilder dem überlebenden und welche
dem abgestorbenen Zustande der Elemente angehören.Denselben Bau, wie an den grossen unipolaren, konnte ich
einige Male auch an grossen multipolaren Zellen beobachten,
welche ich aus der Bauchganglienkette des Flusskrebses isolirte.
An den letzteren zeigte sich auch eine Verschiedenheit der Fort-
sätze, welche ganz analog den von Deiters an manchen Zellen
des nervösen Centralorgans der Wirbelthiere entdeckten Ver-
hältnissen ist. Einer der Fortsätze nämlich war von seinem
Ursprunge an drehrund und heller als die Substanz des Zellleibes;
er war in allen Stücken den in Fig. 1 und 5 abgebildeten Fort-
sätzen unipolarer Zellen ähnlich. Die anderen Fortsätze erschienen
platt und verschmälerten sich allmälig; an einem war eine
Theilung bemerkbar; ihre Substanz war so dunkel wie die des
Zellleibes, aber sie zeigte, wie der hellere Zellfortsatz, isolirte,
parallel laufende Fibrillen. Diese Beobachtung, welche überdies
darthut, dass die Zwischensubstanz der Nervenfasern von der der
Zellen verschieden ist, konnte ich leider nur zweimal machen
und weiss auch nicht den Ort anzugeben, an welchem sich diese
mit aller Sicherheit erkannten multipolaren Zellen vorfinden.IV.
Es ist zwar nicht gestattet, die an dem Nervengewebe des
Flusskrebses erkannte Structur von ungewisser physiologischer
Bedeutung ohne weitere Erwägung auf die entsprechenden
Elemente anderer Thiere zu übertragen; aber so lange endgiltige
Ergebnisse der Untersuchung es nicht verbieten, darf man dochS.
33
an der Möglichkeit festhalten, dass die beschriebene Structur der
Nervenfasern und Nervenzellen nicht dem Flusskrebs und seinen
nächsten Verwandten eigenthümlich, sondern die allgemeine
Structur des Nervengewebes sei. Die Betrachtung der in der
Literatur niedergelegten Beobachtungen weist nämlich dieselben
Controversen, welche beim Nervengewebe des Flusskrebses durch
Beobachtung überlebender Zellen entschieden und theilweise
auch erklärt werden konnten, für das Nervengewebe der meisten
anderen Wirbellosen und Wirbelthiere nach, ohne dass auf diesem
weiteren Gebiete bisher die Entscheidung erfolgt wäre. Unter
solchen Verhältnissen kann die sichere Kenntniss des Nerven-
gewebes bei einem einzigen Thiere auch für die Beurtheilung
der für die anderen Thiere schwebenden Fragen von Werthe
sein.Ich halte es für überflüssig, die ganze mit Ehrenberg und
Valentin beginnende Reihe der Autoren über die Structur des
Nervengewebes hier nochmals aufzuführen. Es scheint mir hin-
zureichen, wenn ich mich auf einige allgemeine Bemerkungen
und auf die Hervorhebung jener Angaben beschränke, welche mit
meinen Beobachtungen am Flusskrebse übereinstimmen. Denn
aus einer solchen Prüfung der Literatur können sich doch nur
Fingerzeige für die Auffassung der einander widersprechenden
Behauptungen ergeben. Die endliche Aufklärung, ob es eine
gemeinsame Structur der Nervenzellen und Nervenfasern in der
Thierreihe gebe, und welches diese sei, kann nur durch neue
Untersuchungen gewonnen werden.Die Nervenfasern wirbelloser Thiere sind vielleicht eben so
oft als fibrillär wie als homogen oder granulirt beschrieben
worden. In der grossen, bereits mehrmals erwähnten Arbeit von
Waldeyer über den Axencylinder wurde die Zusammensetzung
aus Fibrillen für die peripheren und centralen Elemente aller
Classen der Wirbellosen gelehrt; auch die letzte, sorgfältige
Untersuchung des Nervengewebes wirbelloser Thiere durch Hans
Schultze1 , welche sowohl die Bilder im frischen Zustande als
nach Anwendung von Reagentien berücksichtigt, gelangt zu1H. Schultze, Die fibrilläre Structur der Nervenelemente bei
Wirbellosen. Archiv für mikrosk. Anat. XVI. 1879.S.
34
demselben Ergebniss. Dagegen ist der Widerspruch solcher
Beobachter zu erwähnen, welche wie Hermann1 und Solbrig2
sich auf ein einziges Thier oder eine Thierclasse als Unter-
suchungsobject beschränkt haben. Es ist nicht wahrscheinlich,
dass diese Widersprüche von der Verschiedenheit der unter-
suchten Objecte herzuleiten seien; denn in der Regel findet ein
Beobachter, welcher seine Untersuchungen auf mehrere Thier-
classen ausdehnt, übereinstimmende Structurverhältnisse für die
so verschiedenen Objecte, während dasselbe Object meist ver-
schiedenen Beobachtern Anlass zu ganz abweichenden Beschrei-
bungen gibt.Um Missverständnissen vorzubeugen, muss ich daran erinnern,
dass nicht alle faserigen Elemente im Nervensystem wirbelloser
Thiere als „Nervenfasern“ bezeichnet werden können. Waldeyer
hat zuerst hervorgehoben, dass an vielen Orten selbständige,
isolirbare Nervenfasern mangeln und die Nervenstämme aus
feinen Fibrillen bestehen, welche durch Dissepimente, die von
einer gemeinsamen Scheide ausgehen, in dickere oder dünnere
Bündel zerlegt werden. Die fibrilläre Zusammensetzung des Inhalts
dieser Abtheilungen in den Nervenstämmen ist seither von vielen
Autoren und auch von solchen, welche, wie Hermann, die
„Nervenfasern“ als homogen beschreiben, bestätigt worden.3 Eine
ähnliche Anordnung der faserigen Nervensubstanz scheint im
Opticus und anderen Hirnnerven des Krebses vorzuliegen. Diese
Elemente, welche mit den von mir beschriebenen Fasern des
Flusskrebses nicht direct vergleichbar sind, wurden also von den
meisten neueren Autoren in übereinstimmender Weise aufgefasst
und gaben zu der Aufstellung der „Primitivfibrille als letztes
Structurelement der Nervenfasern“ Anlass. In der Beschreibung
der eigentlichen, mit selbständiger Scheide versehenen Fasern
zeigt sich dagegen ein Mangel an Übereinstimmung der ver-
schiedenen Untersucher, welcher durch neue Beobachtungen eine1E. Hermann, Das Centralnervensystem von Hirudo medicinalis.
Gekrönte Preisschrift. München 1875.2Solbrig, Über die feinere Structur der Nervenelemente bei den
Gasteropoden. Gekrönte Preisschrift. 1872.3Vgl. Hermann, l. c. pag. 50 u. ff.; H. Schultze, l. c.; Dietl l. c.
pag. 14 u. ff.; Krieger, l. c. pag. 15.S.
35
ähnliche Aufklärung finden dürfte, wie sie hier für den Flusskrebs
gegeben worden ist.Es ist bekannt, dass auch die Structur der Nervenfasern bei
den Wirbelthieren bisher nicht genügend festgestellt ist. Die
blassen, marklosen Fasern sind schon von ihrem Entdecker,
Remak1 , als aus feinen Fibrillen bestehend beschrieben worden;
und die Thatsache, dass ähnliche blasse Fasern im Embryonal-
leben an Stelle der markhaltigen sich finden, spricht zu Gunsten
derselben Structur der letzteren Fasern. Auch ist, seitdem
Waldeyer2 das Resultat seiner Untersuchungen über den Axen-
cylinder der Wirbelthiere in dem Satze zusammenfasste: Der
Axencylinder sei nach Ursprung, Endverhalten und chemischen
Reactionen dem Fibrillenbündel der Evertebraten homolog, doch
sei es bisher nicht gelungen, ihn histologisch in Fibrillen zu
zerlegen, von M. Schultze und anderen Beobachtern sowohl
eine Längsstreifung des Axencylinders als auch ein Zerfall
desselben in feine Fibrillen an verschiedenen Örtlichkeiten des
Nervensystems nachgewiesen worden. Doch ist noch immer
unerklärt, warum diese vermuthete fibrilläre Structur an der bei
weitem grössten Anzahl markhaltiger Nervenfasern nicht ersicht-
lich ist, und es bleibt zweifelhaft, ob die beobachtete Längs-
streifung alle Male auf Fibrillen zu beziehen sei, und ob diese
Fibrillen sich in der ganzen Strecke des Nerven vorfinden. Selbst
der neueste Beobachter H. Schultze3 , der entschiedenste Ver-
fechter der fibrillären Structur, kann doch nur aussagen, dieselbe
an der lebenden Faser „andeutungsweise“ gesehen zu haben.
Auf die von H. D. Schmidt4 und Arndt5 aufgestellte Ansicht,
dass der Axencylinder aus homogener Substanz, in welcher
Körnchen in bestimmter, überdies noch durch die Thätigkeit des
Nerven beeinflusster Anordnung enthalten sind, glaube ich keinen
Werth legen zu sollen, da dieselbe nichts anderes, als eine ziemlich1Remak, Observationes anatom. et microsc. de system. nerv. struct.
Berolini 1838.2l. c. pag. 207.
3H. Schultze, Axencylinder und Nervenzelle. Archiv für Anatomie
und Entwicklungsgeschichte. 1878.4Jahresbericht von Hofmann‑Schwalbe. 1874.
5Arndt, Etwas über die Axencylinder der Nervenfasern. Virchow’s
Archiv, Bd. LXXVIII. 1879.S.
36
willkürliche Ausdeutung der durch gewisse Reagentien hervor-
gebrachten Bilder zu sein scheint. Die von Arndt an diese
Auffassung geknüpften physiologischen Bemerkungen entziehen
sich dem Beweise ebenso sehr wie der Widerlegung.Von den Einwendungen gegen die fibrilläre Zusammen-
setzung des Axencylinders sind besonders die von Fleischl1
und Boll2 erwähnenswerth. Nach den Untersuchungen dieser
Autoren ist das Verhalten des Axencylinders das einer gerinn-
baren Flüssigkeit, womit dessen Zusammensetzung aus Fibrillen
unvereinbar wäre. Überträgt man aber den für die Nerven-
fasern des Flusskrebses gefundenen Bau auf den Axencylinder
der Wirbelthiere und nimmt an, dass der letztere aus feinen, sehr
hinfälligen Fibrillen und einer sehr weichen Zwischensubstanz
bestehe, so werden die Beobachtungen von Fleischl und Boll
sehr wohl mit der fibrillären Zusammensetzung des Axencylinders
verträglich. In der That hat schon Haeckel die Bildung eines
Gerinnsels in den Nervenfasern des Flusskrebses, welche doch
unzweifelhaft im frischen Zustande Fibrillen enthalten, beschrieben
und abgebildet.3Was die Structurverhältnisse der Nervenzellen betrifft, so
kann ich eine namhafte Anzahl von Beobachtungen an Elementen
von Wirbellosen und Wirbelthieren anführen, welche mit meiner
Beschreibung der Nervenzellen des Flusskrebses mehr oder weni-
ger übereinstimmen und geeignet sind, die Vermuthung von der
allgemeineren Bedeutung dieser Structurverhältnisse zu stützen.Zunächst ist eine Reihe von Autoren zu erwähnen, welche
das Vorhandensein von zweierlei Substanzen in der Nervenzelle
behauptet haben: So lehrt Buchholz,4 dass die Nervenzelle1Fleischl, Über die Beschaffenheit des Axencylinders. Festgabe an
C. Ludwig. 1874.2Boll, Über Zersetzungsbilder des markhaltigen Nervenfasers.
Archiv für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 1877.3Ich möchte hier noch auf die interessante Angabe von Trinchese
(Memoria sulla Struttura del Sistemo Nervoso dei Cefalopodi. Firenze 1868)
aufmerksam machen, dass eine stark lichtbrechende Markscheide, welche
mitunter selbst doppelt contourirt erscheint, auch an den peripheren Nerven
von Cephalopoden vorkommt. (Fig. 5 und 12 auf Trinchese’s Taf. I.)4Bemerkungen über den histologischen Bau des Centralnervensystems
der Süsswassermollusken. Müller’s Archiv 1863. pag. 251.S.
37
der Süsswassermollusken „aus einer hyalinen Grundsubstanz
besteht, in welcher, gleichmässig suspendirt, ein anderer, in Form
feiner Pünktchen auftretender Körper erscheint.“ Diese Grund-
substanz ist nach ihm vollkommen identisch mit dem Inhalt der
Zellfortsätze und der peripherischen Nervenstämme und müsse
für die eigentliche Nervensubstanz erklärt werden.Fleischl1 behauptet auf Grund von Bildern, welche er
nach Einwirkung von Borsäure auf frische Zellen des Ganglion
Gasseri vom Frosche sah: „Der Leib dieser Zellen besteht aus
einer weichen Substanz, welche entweder immer in kugelige v
Massen abgetheilt ist, oder sich nach Borsäureeinwirkung in
solche theilt. Zwischen diesen Kugeln liegt eine das Licht anders
brechende Zwischensubstanz“. Er sah ferner, dass der mit der
interglobulären Substanz in Zusammenhang stehende Kern nach
Borsäureeinwirkung aus der Zelle austrat.In Hinblick auf die später zu erwähnenden Beobachtungen
Schwalbe’s an demselben Objecte halte ich es für wahrscheinlich,
dass Fleischl’s globuläre Substanz der netzförmigen Substanz
in den Nervenzellen des Krebses gleichzustellen ist, deren Stränge
in Folge der Borsäureeinwirkung gerissen und zu discreten Ballen
vereinigt worden waren. Ich habe schon erwähnt, dass das Proto-
plasma der sympathischen Zellen vom Flusskrebs beim Absterben
oft ähnliche Formen annimmt, und muss noch bemerken, dass
Fleischl ’s Beschreibung des Kernes als eines im Leben
membranlosen Gebildes seither an vielen anderen Zellen bestätigt
worden ist.Hermann2 schliesst sich der von Fleischl gemachten
Aufstellung zweier Substanzen auf Grund seiner Beobachtungen
an den Nervenzellen des Blutegels an und fügt hinzu, dass die
interglobuläre Substanz allein den Fortsatz bildet.In vollkommener Übereinstimmung befinde ich mich aber
mit den Angaben von Schwalbe,3 welche ich ihrer Wichtigkeit
halber dem Wortlaute nach citiren will:1Über die Wirkung von Borsäure auf frische Ganglienzellen. Sitzungs-
berichte d. k. Akad. d. Wiss. LXI. Bd. 1870.2l. c. pag. 29 u. ff.
3Schwalbe, Bemerkungen über die Kerne der Ganglienzellen.
Jenaische Zeitschrift 1875. pag. 38.S.
38
„In analoger Weise fand ich im Körper der Spinalganglien-
zellen vom Frosch zwei Substanzen vertheilt, von denen die eine
ein sehr zartes Netzwerk formirte, das von der Oberfläche des
wandungslosen Kernes bis zur Zellenoberfläche reichte, die andere
hellere die Maschenräume ausfüllte. Die Substanz des Kern-
körperchens erwies sich als optisch verschieden von jenen beiden
Substanzen, dagegen schien der Kernsaft mit der Ausfüllungs-
masse der Maschenräume übereinzustimmen. Ist dies richtig, so
werden wir auch hier drei Substanzen zu unterscheiden haben:
die Nucleolarsubstanz, den Kernsaft und die reticuläre Substanz“.Und ferner: „Die pinselförmige Ausstrahlung der Axen-
cylinder in die Substanz der Ganglienzelle ist ferner einfach auf
eine regelmässigere Anordnung der Netzbälkchen, auf Bildung
regelmässig gegen den Anfang der Nervenfaser convergirender
Fäden zurückzuführen.“…Eine concentrische Anordnung dieser Netzbalken beschreibt
Schwalbe an diesen Nervenzellen des Frosches nicht, dagegen
hat er eine solche mehr oder weniger deutlich in den frischen
Spinalganglienzellen der Säugethiere gesehen.1 Dieselbe con-
centrische Streifung ist an den Nervenzellen verschiedener wirbel-
loser Thiere – Würmer, Arthropoden, Mollusken – von Leydig,2
Walter , Dietl, Boll,3 H. Schultze, Schwalbe u. A. gesehen
worden, und man darf vermuthen, dass dieses Bild in allen Fällen
auf jene Structur des Protoplasmas, welche an den Nervenzellen
des Flusskrebses erkannt wurde, zu beziehen ist.Boll und H. Schultze erblicken in diesen Beobachtungen
eine Bestätigung der Auffassung M. Schultze’s vom fibrillären
Bau der Nervenzelle, für deren Würdigung hier der Platz sein
möchte. Nach den bekannten Darstellungen M. Schultze’s4
besteht die Nervenzelle aus einer grossen Anzahl feiner Fibrillen,1Schwalbe, Über den Bau der Spinalganglien nebst Bemerkungen
über die sympathischen Ganglienzellen. Archiv f. mikrosc. Anat. IV. 1868.2Leydig, Vom Bau des thierischen Körpers. 1864, pag. 85.
3Boll, Beiträge zur vergleichenden Histologie des Molluskentypus.
Archiv für mikrosk. Anat. IV. Supplement. 1869.4Observationes de structura cellularum fibrarumque nervearum.
Bonner Universitätsprogramm, Aug. 1868. – Stricker’s Handbuch der
Lehre von den Geweben. 1871.S.
39
welche aus den Fortsätzen in dieselbe einstrahlen, und einer fein-
körnigen Zwischensubstanz. Die feinkörnige Substanz ist am
mächtigsten in der Umgebung des Kernes, die Fibrillen in der
Rindenschichte der Zelle; letztere dringen aber auch in die Tiefe
und ordnen sich concentrisch um den Kern, mit dessen Substanz
sie in keinerlei Zusammenhang stehen. Der Verlauf der einzelnen
Fibrillen, welche sich blos verflechten, aber nicht mit einander
verbinden, ist ein sehr complicirter. Es macht den Eindruck, als
ob sie die Zelle blos durchsetzen würden, um aus einem Fortsatze
in einen anderen zu gelangen. Doch konnte M. Schultze auch
nicht eine einzige derselben durch die Zelle hindurch verfolgen.1
In der Auffassung der Nervenzelle, zu welcher M. Schultze durch
diese Beobachtungen veranlasst wurde, tritt die feinkörnige
Zwischensubstanz zurück und die Zelle erscheint als ein Ort,
in welchem die selbständigen Fibrillen der verzweigten Fortsätze
eine Umlagerung behufs Bildung des Axencylinderfortsatzes
erfahren.Vergleichen wir diese Darstellung M. Schultze’s mit den
Bildern, welche die überlebenden Nervenzellen des Flusskrebses,
oder die Zellen des Ganglion Gasseri vom Frosch nach S c h w a l b e
zeigen, so ergibt sich zunächst, dass die Zusammensetzung der
Fortsätze aus Fibrillen und einer Zwischensubstanz, die Ein-
strahlung der ersteren in die Zelle, endlich das Fehlen eines
Zusammenhanges derselben mit dem Kerne für beide Fälle zutrifft.
Die grössere Anzahl der Fibrillen in den von Max Schultze
beschriebenen Elementen erklärt sich daraus, dass es sich hier
um Zellen mit vielen Fortsätzen, beim Flusskrebse und an den
Objecten Schwalbe’s um uni‑ oder bipolare Zellen handelt.
Die Eigenthümlichkeit der multipolaren Zellen M. Schultze’s
mag ferner den Eindruck erklären, dass die Fibrillen die Haupt-
masse der Zelle bilden und dieselbe nur durchsetzen. Um so mehr
muss die für die Übereinstimmung wichtige Thatsache hervor-
gehoben werden, dass es weder hier noch dort gelingt, einer
Fibrille ansichtig zu werden, welche ohne Unterbrechung durch
die Zelle hindurchzieht. Ein wesentlicher Unterschied liegt aber1„Fibrillae ex singulis processibus in cellulam confluentes diversis-
sima ratione sese innectunt neque unquam mihi contigit, ut unam earum per
totam cellulam oculis secutus sim.“ Observationes pag. 5.S.
40
darin, dass nach M. Schultze die Fibrillen in der Zelle ihre
Isolirung bewahren und durch eine feinkörnige Zwischensubstanz
getrennt sind, während nach Schwalbe’s und meinen Beob-
achtungen alle Fibrillen nach kürzerem oder längerem Verlauf in
die netzförmig angeordnete Zellsubstanz eingehen, deren Zwischen-
räume durch eine homogene Substanz ausgefüllt wird. Da muss
nun erinnert werden, dass kein Beweis für den überlebenden
Zustand der von Max Schultze beschriebenen Elemente vorliegt,
dagegen Anhaltspunkte genug, dieselben für abgestorbene zu
erklären. Die Bilder M. Schultze’s zeigen eine feinkörnige
Zwischensubstanz und einen scharf contourirten Kern; wir wissen
aber, dass diese beiden Structurverhältnisse an den Elementen des
Flusskrebses erst beim Absterben auftreten. Nach M. Schultze
zeigen ferner mit Jodserum, Überosmiumsäure und anderen Re-
agentien behandelte Zellen dieselbe Structur wie die vermeintlich
frischen, während wir gesehen haben, dass Reagentien niemals
die Structur der Nervenzellen unverändert erhalten und gerade
die Erkenntniss des Protoplasmas und des Kernes beeinträchtigen.
Wir dürfen also vermuthen, dass M. Schultze überhaupt keine
frischen Zellen gesehen, und dass die von ihm beschriebenen
Elemente im überlebenden Zustande eine ähnliche Structur wie
die Nervenzellen des Flusskrebses erkennen lassen würden.Die Annahme, dass gewisse Reagentien die Netzstränge des
Zellleibes mitunter als Fasern erscheinen lassen, würde auch eine
interessante Beobachtung Remak’s1 erklären, welche derselbe
der Naturforscherversammlung zu Wiesbaden 1852 mitgetheilt
hat: „Nach Vivisection einer Raja batis und 24stündiger Auf-
bewahrung der Wirbelsäule in einer verdünnten Lösung von
Chromsäure und doppelt chromsaurem Kali zeigte aber die
Substanz der Ganglienkugeln ein sehr regelmässiges, faseriges
Gefüge. Und zwar liessen sich zwei Schichten von Fäserchen
unterscheiden; die innere umgab concentrisch den Kern, die
äussere verlief nach beiden Polen in den Kanal des Axen-
schlauches hinein.“Die Auffassung M. Schultze’s von der Bedeutung der
Nervenzelle als Umlagerungsstätte der Fibrillen – welche übrigens156 Amtlicher Bericht pag. 182 u. ff.
S.
41
von ihrem Urheber selbst blos als eine mögliche hingestellt wurde
– ist zunächst durch den Umstand beseitigt, dass sie den nicht
zur Beobachtung kommenden ununterbrochenen Verlauf der
Fibrillen aus einem Fortsatze in einen anderen voraussetzt. Sodann
ist zu bemerken, dass dieselbe überhaupt nur für multipolare
Zellen, von denen sie abstrahirt wurde, in Betracht kommen kann,
denn in uni‑ oder bipolaren Zellen ist eine Umlagerung der
Fibrillen unmöglich. Diese Zellformen, welche im Nervensystem
wirbelloser Thiere die multipolaren weitaus zu überwiegen
scheinen, bedeuten demnach nach M. Schultze nichts als „kern-
haltige Anschwellungen der Nervenfaser“. Um einzusehen, wie
unzureichend diese Auffassung ist, muss man sich erinnern,
dass nach neueren Untersuchungen die uni‑, bi‑ und multipolaren
Zellformen durch mannigfache Übergangsformen verbunden
erscheinen.Unter einer bestimmten physiologischen Voraussetzung über
die Fibrillen der Nervenfaser kann man aber eine andere Auf-
fassung der Nervenzelle aussprechen. Nimmt man nämlich an,
dass jede Fibrille der Nervenfaser zur gesonderten Leitung der
Erregung befähigt ist, so ergibt sich aus Schwalbe’s und meinen
Beobachtungen, dass die im Nerven gesonderten Bahnen
in der Nervenzelle zusammenfliessen. Diese Auffassung
erstreckt sich auf alle bisher bekannten Formen der Nervenzelle;
man muss aber zugestehen, dass die Voraussetzung, auf welcher
sie beruht, lange nicht bewiesen ist, wenn gleich einiges, was
über das Endverhalten der Nerven bekannt ist, für dieselbe zu
sprechen scheint.Ich muss nochmals betonen, dass ich in diesem Abschnitte
nur gerechtfertigte Vermuthungen und Anhaltspunkte zu gewinnen
suche und durchaus nicht behaupten will, es sei sichergestellt,
dass allen Nervenzellen dieselbe Structur zukomme. Die Überein-
stimmung von einander so ferne stehenden Elementen wie der
grossen centralen Zellen des Flusskrebses und der Spinalganglien-
zellen des Frosches und der Säugethiere ist auffällig genug; doch
schon die sympathischen Zellen des Flusskrebses lassen die
gleiche Structur nicht sicher erkennen, ebensowenig nach
Schwalbe1 die multipolaren Zellen des Rückenmarkes. Die1Bemerkungen über die Kerne der Ganglienzellen. l. c., pag. 35.
S.
42
frischen Nervenzellen der Retinaerscheinen nach Schwalbe1
ganz durchsichtig bis auf einen schmalen Hof um den Kern; in
den Nervenzellen der freipräparirten Magenwand des
Blutegels beobachtete Hermann2 heftige Körnchenbewegung u. dgl.
Doch kann man die früher geäusserte Vermuthung durch diese
Beobachtungen auch nicht für widerlegt erachten, da es sehr wohl
möglich ist, dass an den erwähnten Elementen nur eine Modi-
fication jener Structur vorliegt, welche die Erkennung derselben
erschwert, wie ich dies von den sympathischen Zellen des Fluss-
krebses ausgesprochen habe. Die grosse Durchsichtigkeit der
Retinazellen, die ja durch die Örtlichkeit erfordert wird, schliesst
eine Sonderung des Zellleibes in zwei Substanzen, deren eine
netzförmig angeordnet in die Fibrillen der Nervenfaser übergeht,
noch nicht aus, da z. B. an der frischen Cornea die gewiss prä-
existirenden Hornhautzellen sich zunächst nicht von dem Gefüge
der Cornea abheben; und bei der grossen Hinfälligkeit der feineren
Structurverhältnisse im Nervengewebe muss man es auch unent-
schieden lassen, ob die von Hermann beschriebene Erscheinung
– nach Hermann’s eigenen Worten – „Tod oder Leben
bekunde“.Die Angaben Frommann’s,3 welcher vorwiegend auf die
Bilder der Silberbehandlung gestützt, eine complicirte fibrilläre
Structur der Zellen behauptet hat, kann ich, in so weit dieselbe
über das von Remak und M. Schultze Beobachtete hinausgeht,
so wenig wie andere Untersucher bestätigen oder verwerthen.
Dasselbe gilt von den zum Theil extravaganten Angaben Heitzmann’s.4Das Wesentliche an der für manche Nervenzellen erkannten,
für andere vermutheten Structur scheint nun aber keine Eigen-
thümlichkeit des Nervengewebes zu sein. Die Verhältnisse, welche
das Protoplasma und den Kern der überlebenden Nervenzelle1Ebendaselbst pag. 26.
2l. c., pag. 37.
3C. Frommann, Über die Färbung der Binde‑ und Nervensubstanz
des Rückenmarkes durch Argentum nitricum und über die Structur der
Nervenzellen. Virchow’s Archiv XXXI. 1864.4Heitzmann, Untersuchungen über das Protoplasma. Wiener akad.
Sitzungsber. Bd. LXVII. 1873.S.
43
charakterisiren, sind in ganz ähnlicher Weise an vielen
Zellen ganz abweichender Natur – Drüsenzellen, Epitelien, Knorpel-
zellen – erkannt worden. Was den Aufbau des Zelleibes aus
zwei physikalisch und chemisch verschiedenen Substanzen –
einer netzförmig angeordneten und einer anderen, die Räume
zwischen den Netzsträngen ausfüllenden – betrifft, so darf ich
auf Schwalbe’s oft citirte „Bemerkungen über die Kerne der
Ganglienzellen“ verweisen, worin die Analogien zwischen den
Substanzen der Nervenzelle und denen anderer Zellen bereits
ausführlich berücksichtigt sind. Besonders hervorheben möchte
ich noch die Beobachtungen Kupffer’s1 an den Zellen der
Speicheldrüsen von Periplaneta orientalis, weil an diesen Elementen
– wie an den Nervenzellen des Flusskrebses – die netzförmige
Substanz in unmittelbarem Zusammenhange mit den in die Zelle
eintretenden Nervenfibrillen steht.Es ist auch offenbar, dass die am Kern der Nervenzellen
gemachten Beobachtungen: Das Fehlen der Kernmembran, die
mannigfaltigen Formen der Kerngebilde, sowie die Bewegungs-
erscheinungen und Formänderungen derselben2 durchwegs Ver-
hältnissen entsprechen, welche wir in den letzten Jahren an Zellen
von sehr verschiedener Bedeutung – Knorpel‑, Epitelial‑,
Geschlechtszellen u. s. w. – kennen gelernt haben.Ich möchte nur bemerken, dass Gebilde, welche an Gestalt
und Veränderlichkeit den unregelmässigen Kerngebilden der
Nervenzellen gleichen, von den Beobachtern zumeist in sich
theilenden Zellen aufgefunden wurden, so dass man dort, wo
man solchen Kernfiguren begegnet, auf beginnende Zelltheilung
zu schliessen pflegt. Es scheint mir aber sehr unwahrscheinlich,
dass die grössten und am besten ausgebildeten Nervenzellen des
Flusskrebses bei grossen und kleinen Thieren und zu jeder Zeit
des Jahres in der Vorbereitung zur Theilung begriffen sein sollen,
während man andere Anzeichen dieses Vorganges an ihnen
niemals findet und auch sonst nichts über die Theilung ausgebil-
deter, functionirender Nervenzellen weiss. Viel näher liegt die1 C. Kupffer, Die Speicheldrüsen von] Periplaneta orientalis. Fest-
gabe an C.Ludwig. 1874.2 Vgl. dazu wiederum Schwalbe’s Bemerkungen etc.
S.
44
Annahme, dass diese Gebilde einen normalen Bestandtheil des Kernes der
Nervenzelle darstellen, und vielleicht wird dies auch für andere Zellen zu
erweisen sein. So bemerkt Schleicher1 in einer Abhandlung über
die Knorpelzelltheilung, dass sich „Körner, Stäbchen und Fäden auch im
knorpeligen Scapularrand des erwachsenen Frosches vorfinden, also auch
in Zellen, die sich nicht mehr vermehren.“ Jedoch fügt er hinzu, dass diese
Gebilde in der jugendlichen Zelle lebhafte Bewegungen zeigen, die man in
den Zellen am Scapularrande nicht mehr beobachtet; während ich an den
Kerngebilden der Nervenzellen der grössten mir zugänglichen Flusskrebse
überaus lebhafte Bewegungserscheinungen sah.Die Nervenzelle zeigt uns also bis jetzt kein
eigenthümliches Structurverhältniss; die Function
derselben ist mit der allgemeinen Structur der
thierischen Zelle, soweit dieselbe bis jetzt erkannt
wurde, verträglich.2 Doch darf aus diesem Umstande kein
Schluss auf die höhere oder mindere physiologische Dignität der
Nervenzelle gezogen werden.Ich will noch daran erinnern, dass kein Grund zur Annahme
vorliegt, das Verhältniss der Nervenzelle zur Nervenfaser sei bei
Wirbellosen ein anderes, als bei Wirbelthieren. Waldeyer hat
nämlich ausgesprochen, dass die Fortsätze der grossen centralen
Nervenzellen Wirbelloser niemals zu peripheren Nervenfasern
werden, sondern zunächst in die centrale Substanz des Ganglions
eintreten, daselbst sich in feine Fibrillen auflösen, und dass
anderseits die peripheren Nervenfasern durch Zusammentreten
der Fibrillen der Centralsubstanz entstehen. Es lag nahe, daran
die weitere Vermuthung zu knüpfen, dass in einer Nervenfaser
eines wirbellosen Thieres Fibrillen, welche verschiedenen Nerven-
zellen angehören, beisammen liegen.Leydig’s3 Anschauung unterscheidet sich von der Waldeyer’s
dadurch, dass er auch einen directen Übergang von1Schleicher, Die Knorpelzelltheilung. Archiv für mikrosk. Anat.,
XVI. 1878.2 Vgl. dazu Brücke, die Elementarorganismen. Diese Sitzgber. 1861,
pag. 385 und 408.3Leydig, Vom Bau des thierischen Körpers. 1864. pag. 89.
S.
45
Fortsätzen centraler Zellen in Nervenfasern gelten lässt, wodurch
der von Waldeyer behauptete Unterschied zwischen dem
Nervengewebe wirbelloser und dem der Wirbelthiere entfallen
würde. Bei Wirbelthieren ist bekanntlich der directe Übergang
von Zellfortsätzen in periphere Nervenfasern für die Zellen des
Centralorgans nachgewiesen worden und Deiters hat selbst
Merkmale angegeben, an welchen der Axencylinderfortsatz schon
bei seinem Ursprung aus der Nervenzelle erkennbar ist. Doch
ist es auch bei Wirbelthieren durchaus nicht ausgemacht, dass
alle Nervenfasern in gleicher Weise mit Nervenzellen zusammen-
hängen. Es bleibt vielmehr möglich, dass auch hier Nervenfasern
aus einer centralen Fasermasse entspringen, und dass in einer
peripheren Faser Fibrillen verschiedenen Ursprungs und ver-
schiedener Bedeutung enthalten sind. Es ist dieses Verhältniss
weder für die Wirbellosen bewiesen, noch für die Wirbelthiere
widerlegt.Einige Beobachtungen lassen vielmehr eine weitgehendere
Übereinstimmung des Nervengewebes beider grosser Thierclassen
auch in diesem Punkte erwarten. Bei den Phronimiden, einer
Familie der Flohkrebse, hat Claus1 durch Untersuchung der
Bauchganglienkette an Längsschnitten gefunden, dass die Fort-
sätze der grossen Nervenzellen direct in die Fasern der Nerven-
stämme – und zwar zum grösseren Theile in die der gekreuzten,
zum kleineren in die derselben Seite – übergehen. Claus geht
so weit zu vermuthen, dass die meisten grossen Zellen der Bauch-
ganglienkette multipolar seien.Eine gewisse Anzahl von multipolaren Zellen ist nun sicher-
lich im centralen Nervensystem der Crustaceen vorhanden, wie
aus Claus’Bildern und meinen Isolationspräparaten hervorgeht.
Die von mir beim Flusskrebs dargestellten multipolaren Zellen
zeigten überdies, wie bereits erwähnt, jene Charaktere ihrer Fort-
sätze, welche Deiters zur Unterscheidung zwischen Axencylinder‑
und Protoplasma‑Fortsatz veranlasst haben.2 Was die geringe Zahl1Claus, Der Organismus der Phronimiden. Arbeiten des zool. Instituts zu
Wien. Tom. II.2Vgl. Dietl. Die Gewebselemente des Centralnervensystems bei wirbellosen
Thieren. p. 10.S.
46
der Deiter’schen Zellen beim Flusskrebs betrifft, so muss
daran erinnert werden, dass auch bei Wirbelthieren wahrscheinlich
nur gewisse Gruppen von Zellen nach dem Schema von Deiters
gebaut sind.Erklärung der Tafel.
Fig. 1. Nervenzelle aus dem Schwanzganglion des Flusskrebses mit einge-
rolltem Fortsatz, welcher sich der Zellperipherie anschmiegt. Im
Kern ausser den rundlichen Kernkörpern mehrere kurze, dicke
Stäbchen und eine aus zwei Stücken bestehende Kernfigur. Gez. bei
Hartnack 3/8. Vergrösserung der Zeichnung 360.Fig. 2. Überlebende Nervenzelle aus einem Abdominalganglion mit kegel-
förmig entspringendem Fortsatz. Im Kern, welcher keine Kern-
membran besitzt, vier mehrspitzige Klümpchen und ein langer, an
einem Ende gebogener und gegabelter Stab. Bei k ein Kern des
einhüllenden Gewebes. Dieselbe Vergrösserung.Fig. 3. Randpartie aus dem spindelförmigen Magenganglion des Fluss-
krebses. Zwei unipolare Nervenzellen mit ihren Fortsätzen, deren
einer eine Tförmige Theilung erfährt. Die kleinere Zelle ist bei einer
Einstellung nahe der Oberfläche gezeichnet.
s Die dicke, concentrisch geschichtete Zellscheide.
ks Die Kerne derselben.
hm Stark glänzende homogene Massen am Rande der Zelle, doch
nach innen von der Hülle gelegen.
f Eine von einer anderen Zelle kommende Faser.
Dieselbe Vergrösserung.Fig. 4. Kern einer grossen Nervenzelle, welcher Bewegungserscheinungen
an beiderlei Kernkörpern zeigte. b ist fünf Minuten später als a
gezeichnet. Hartnack 3/X. Vergrösserung der Zeichnung 400.Fig. 5. Stück einer Zelle mit Fortsatz wie in Fig. 1. Im Kerne eine grosse
Anzahl von zierlichen gegabelten und geknickten Stäbchen. Dieselbe
Vergrösserung wie in Fig. 4.S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
9
–46