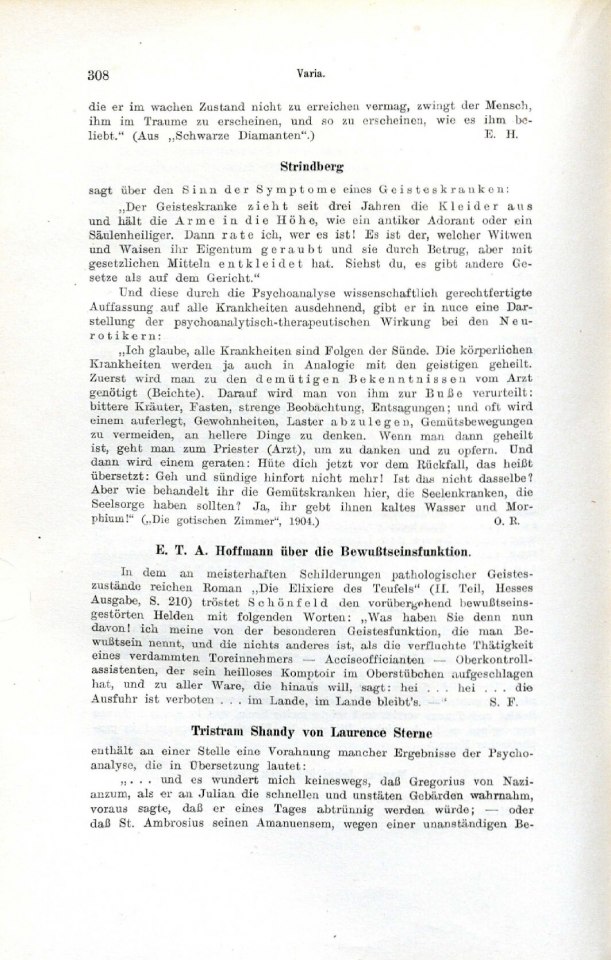Edition
Edierter Text
1919-005 F
E. T. A. Hoffmann über die Bewusstseinsfunktion
Editorischer Apparat
Bearbeitungsstatus Werk
Metadaten
E. T. A. Hoffmann über die Bewusstseinsfunktion
Transkription: Christine Diercks
Faksimile-Ausgabe Arkadi Blatow
Freuds Text erschien in der Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse 1919 in der Rubrik ›Varia‹.
Siehe dazu auch Sigmund Freuds ›Das Unheimliche‹, ebenfalls 1919 veröffentlicht.
Hoffman, E. T. A. (1915-1916): Die Elixiere des Teufels. Nachgelassene Papiere des Bruders Medardus eines Capuziners. Herausgegeben von dem Verfasser der Fantasiestücke in Callots Manier. Berlin: Duncker und Humblot, 2 Bde; Bd. I 1815, 378 S. + 2 Bl. Verlagsanzeigen; Bd. II 1816, 374 S
Volltext: Projekt Gutenberg https://www.projekt-gutenberg.org/etahoff/elexier1/elexie11.html
Die Elixiere des Teufels / Teil 1
Erster Abschnitt
Die Jahre der Kindheit und das Klosterleben
Zweiter Abschnitt
Der Eintritt in die Welt
Dritter Abschnitt
Die Abenteuer der Reise
Vierter Abschnitt
Das Leben am fürstlichen Hofe
E.T.A. Hoffmann: Die Elixiere des Teufels / Teil 2
Erster Abschnitt
Der Wendepunkt
Zweiter Abschnitt
Die Buße
Dritter Abschnitt
Die Rückkehr in das Kloster
E. T. A. Hoffmann
Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann
* 24. Januar 1776 in Königsberg, Ostpreußen
† 25. Juni 1822 in Berlin
deutscher Schriftsteller, Jurist, Komponist, Musikkritiker, Zeichner.
Handlung
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Elixiere_des_Teufels [2022-12-06]
„Der Roman ist eine fiktive Autobiographie. Der Protagonist, der Mönch Medardus, der mit nahezu allen handelnden Personen des Romans in irgendeiner Weise verwandt ist, weiß zu Beginn des Romans nichts von diesen Verbindungen und wird nach einer glücklichen Kindheit in ein paradiesisches Kloster aufgenommen. Er wächst hier heran und erhält, da er seinen Weg lobenswert geht, zwei wichtige Rollen in seinem Kloster: Er verwaltet die Reliquienkammer, in der sich eines der Elixiere des Teufels befindet, einer Sage nach vom Heiligen Antonius hinterlassen. Außerdem beginnt er zu predigen. Sein Rednertalent steigt ihm zu Kopfe, und so erklärt er sich selbst zum Heiligen Antonius und verliert in einer Ohnmacht sein Rednertalent.
Er gewinnt es zurück, als er von dem Elixier des Teufels trinkt. Als nun auch noch eine junge Frau, Aurelie, die große Ähnlichkeiten mit der heiligen Rosalia hat, ihm ihre Liebe beichtet, will er das Kloster verlassen, um sie zu suchen. Der Prior, der seine Unruhe bemerkt, schickt ihn als Gesandten des Klosters nach Italien.
Auf seiner Wanderung sieht er über einer Schlucht einen schlafenden Mann, der in die Schlucht zu fallen droht. Als er ihn zu wecken versucht, schrickt dieser auf und fällt hinab. Durch ein Missverständnis wird Medardus nun für den Gestürzten gehalten und als Graf Viktorin in einem Schloss aufgenommen. Er beginnt ein Verhältnis mit der Stiefmutter Aurelies, Euphemie, trifft aber später plötzlich Aurelie selbst. Seine Liebe zu ihr eskaliert, und er tötet Hermogen, Aurelies Bruder, und Euphemie. Er flieht und landet zuerst in einer Stadt, wo er Pietro Belcampo (alias Peter Schönfeld, wie er sich in Deutschland nannte), begegnet. Später gelangt er durch einen Unfall in ein Forsthaus, wo er seinem Doppelgänger begegnet, einem wahnsinnigen Mönch, der für den Bruder Medardus', also ihn selbst, gehalten wird. Dieser Mönch entpuppt sich als der in die Schlucht gefallene Viktorin, der im Zuge dessen eine Kopfverletzung erlitten hat und so dem Wahnsinn verfallen ist.
Medardus’ nächste Station ist ein Fürstenhof, an dem er verkleidet auftritt, aber von Aurelie, die dort erscheint, als der Mörder ihres Bruders erkannt und ins Gefängnis geworfen wird. Doch von dort wird er von seinem Doppelgänger gerettet, da dieser die Tat gesteht. Aurelie gesteht dem wieder freigesetzten Medardus ihre Liebe, und sie wollen heiraten. Doch am Hochzeitstag begegnet Medardus dem Doppelgänger Viktorin, der zum Tode geführt werden soll, schreit Aurelie die Wahrheit entgegen und meint, sie im gleichen Moment aus dem Affekt heraus niedergestochen zu haben. Er befreit den Doppelgänger und flieht zum zweiten Mal.
Doch sein Doppelgänger folgt ihm, die beiden kämpfen einen erbitterten Kampf, den Medardus zwar gewinnt, der ihn aber in eine tiefe Ohnmacht sinken lässt. Er erwacht in einer italienischen Klinik und zieht von dort reuig in ein Kloster weiter. Dort büßt er für seine Sünden, wird in ein Komplott um den Papst verwickelt, entgeht knapp dem Tod und macht sich auf den Weg zu seinem ehemaligen Kloster, nachdem er die Schriften eines alten Malers gelesen hat, worin er seine eigene Lebensgeschichte aufgeschrieben gefunden und nun verstanden hat.
Zurückgekehrt in sein Heimatkloster, wird er Zeuge der Einkleidung Aurelies, muss aber dann mit ansehen, wie sein Doppelgänger sie tötet und flieht. Medardus beginnt damit, sein Leben aufzuschreiben, und stirbt ein Jahr später an Aurelies Todestag.“
Zu diesem Werk Hoffmanns und dem Doppelgängermotiv siehe auch Freud (1919): Das Unheimliche.
Bibliografische Angaben zu diesem Werk (neu)
| AutorInnen | FE | M-P/F/H | SFG | Grinstein | Titel | Sonderdruck aus | In | Seiten | B | F | O | D | R | M | Rechte | KP/E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freud, Sigmund | 1919-005/1919 | 1919k | 1919-10 | 10446A | E. T. A. Hoffmann über die Bewußtseinsfunktion | IZP 5, 1919, 4 | 308 | Fertig ✔ | Fertig ✔ | Ganz fertig / zutreffend ✔ | Teilweise - | Fehlt ✖ | Ganz fertig / zutreffend ✔ | ✔ | EB | ✔ | |
| Freud, Sigmund | 1919-005/1987 | 1919k | 10446A | E. T. A. Hoffmann über die Bewußtseinsfunktion | GW Nachtragsband | 769 | Fertig ✔ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | ✔ | ✔ | |||
| Freud, Sigmund | 1919-005/2020 | 1919-10 | E. T. A. Hoffmann über die Bewusstseinsfunktion | SFG 16 | 333, 335 | Fertig ✔ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | ✔ | ✔ |
Bibliografische Angaben zu Übersetzungen zu diesem Werk (neu)
| AutorInnen | ÜbersetzerInnen | FE | M-P/F/H | SFG | Grinstein | Titel | In | Seiten | B | F | O | D | R | M | Rechte | KP/E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freud, Sigmund | Pirelli, Carlo | 1919-005/1993.it | E. T.A. Hoffmann sulla funzione della coscienza | Opere Complementi, 1993 | 161, 165 | Fertig ✔ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | ✔ | ✔ | ||||
| Freud, Sigmund | Cotet, Pierre | 1919-005/1996.fr | E. T. A. Hoffman et la fonction de la conscience | OCF.P 15, 1996 | 189–191 | Fertig ✔ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | ✔ | ✔ | ||||
| Freud, Sigmund | Fujino, Hiroshi | 1919-005/2006.ja | 意識の機能に関するE・T・A・ホフマンの見解 | Iwanami 17, 2006 | 227 | Fertig ✔ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | Nicht erforderlich/ | ✔ | ✔ |