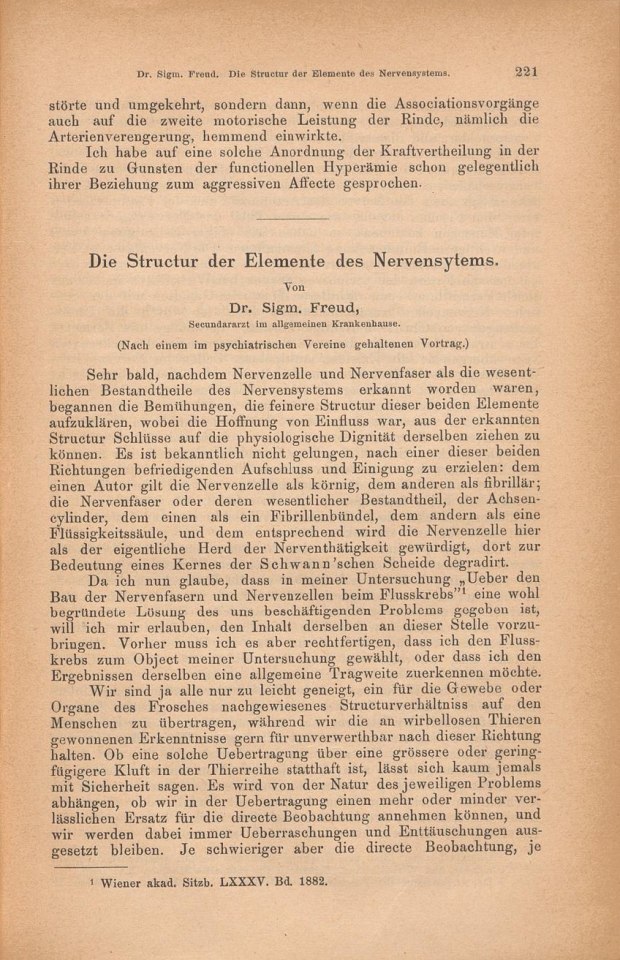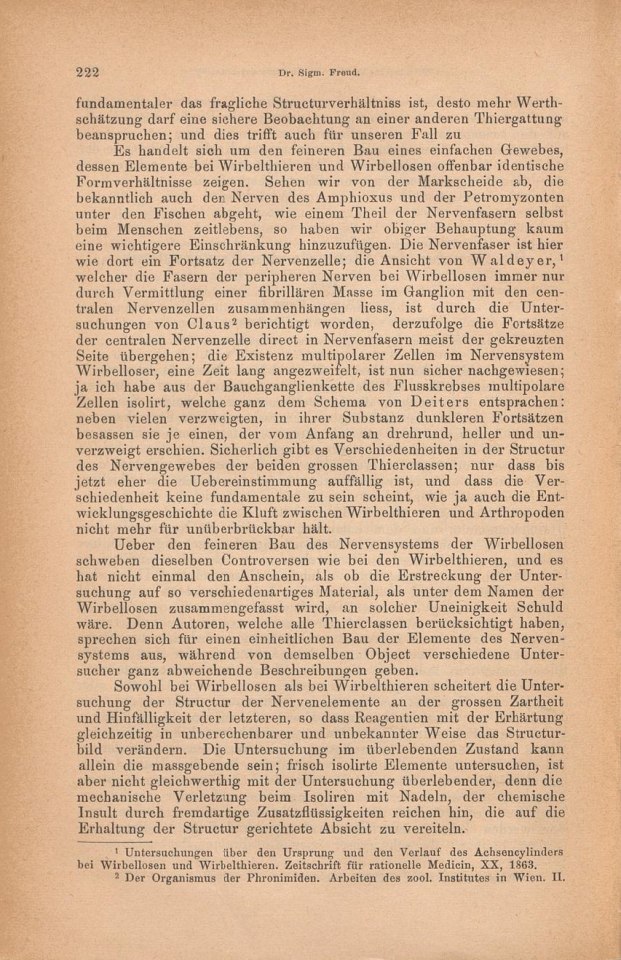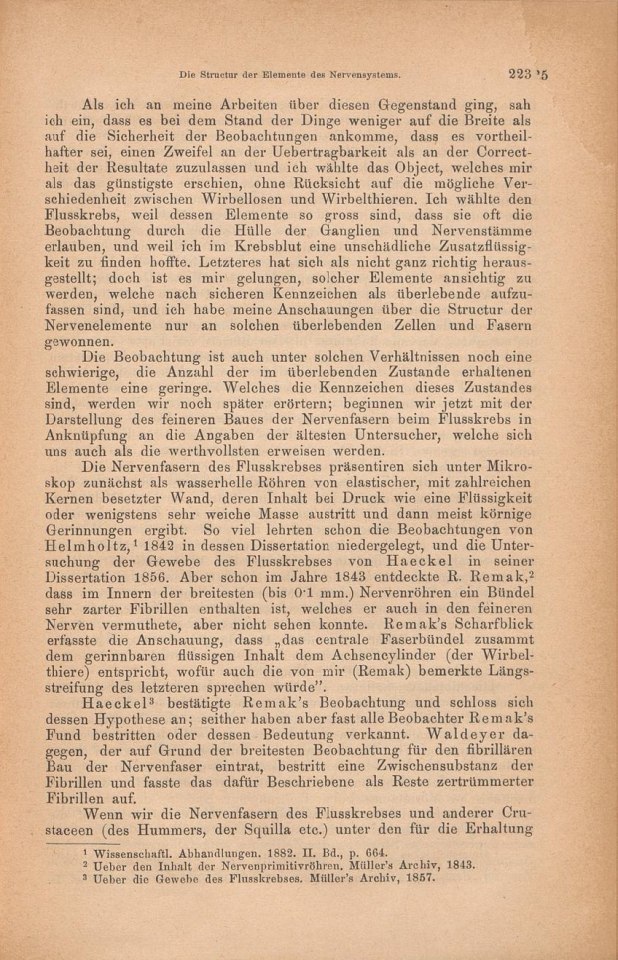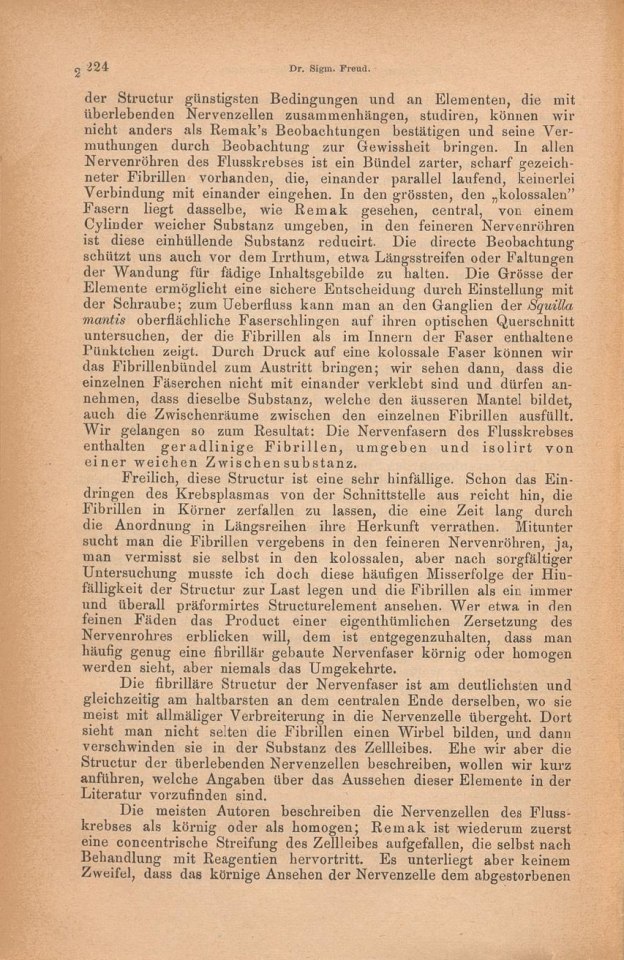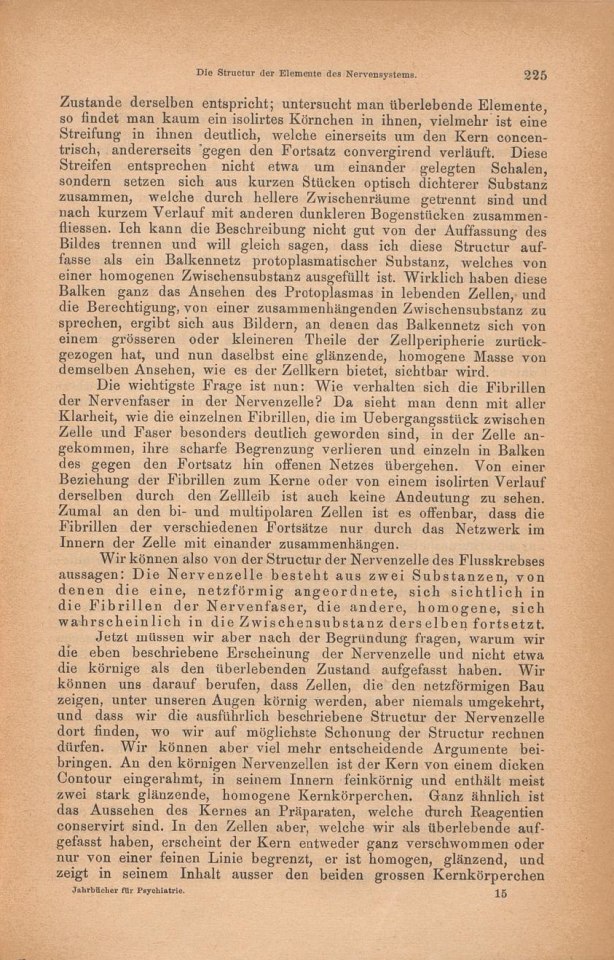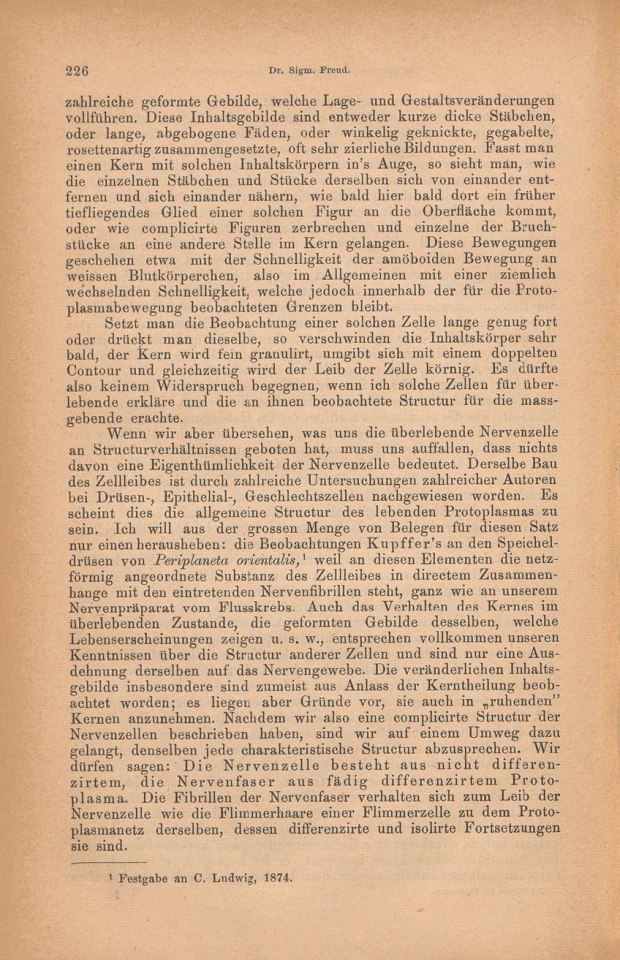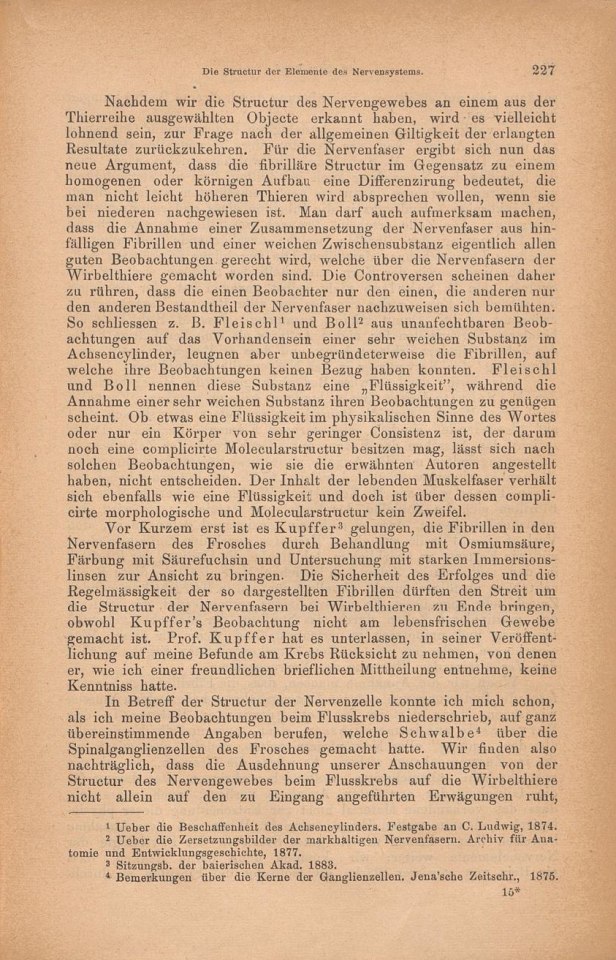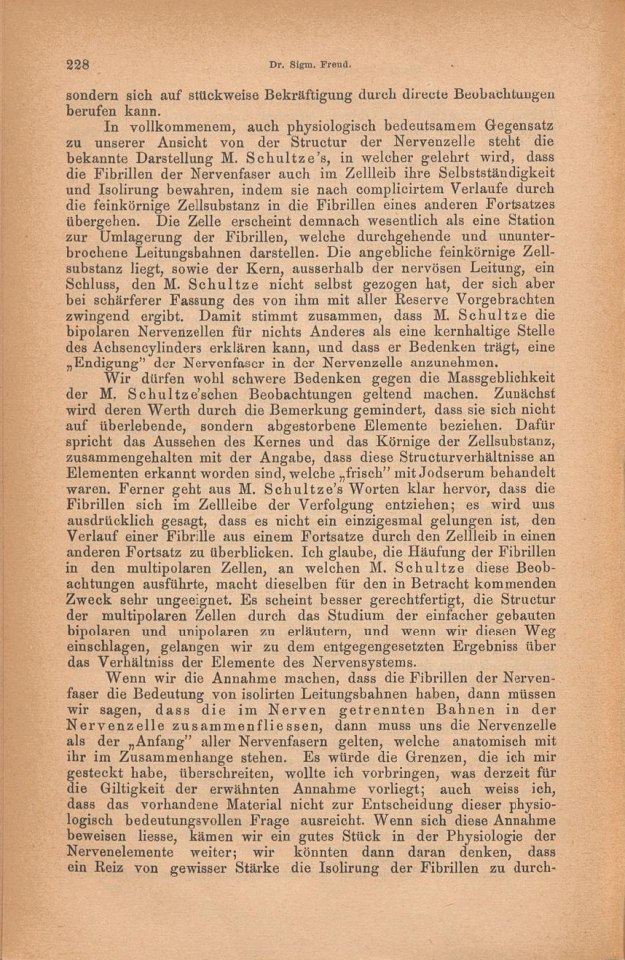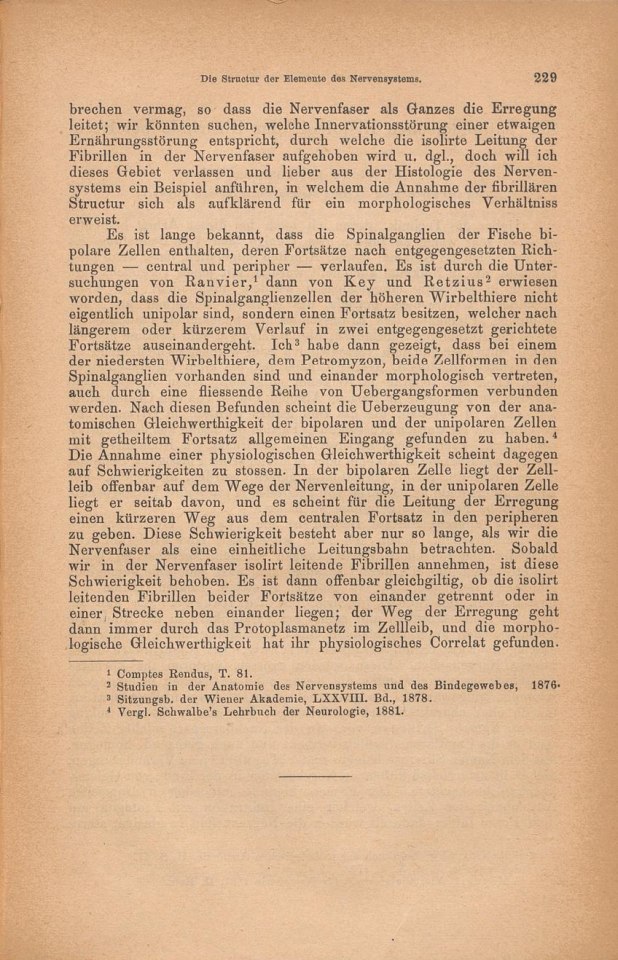S.
221
Die Structur der Elemente
des Nervensystems.Von
Dr. Sigm. Freud,
Secundararzt im Allgemeinen Krankenhause.
(Nach einem im Psychiatrischen Vereine gehaltenen Vortrag.)
Sehr bald, nachdem Nervenzelle und Nervenfaser als die wesentlichen Bestandtheile
des Nervensystems erkannt worden waren, begannen die Bemühungen,
die feinere Structur dieser beiden Elemente aufzuklären, wobei die
Hoffnung von Einfluss war, aus der erkannten Structur Schlüsse auf die physiologische
Dignität derselben ziehen zu können. Es ist bekanntlich nicht
gelungen, nach einer dieser beiden Richtungen befriedigenden Aufschluss
und Einigung zu erzielen: dem einen Autor gilt die Nervenzelle als körnig,
dem anderen als fibrillär; die Nervenfaser oder deren wesentlicher Bestandtheil,
der Achsencylinder, dem einen als ein Fibrillenbündel, dem andern
als eine Flüssigkeitssäule, und dem entsprechend wird die Nervenzelle hier
als der eigentliche Herd der Nerventhätigkeit gewürdigt, dort zur Bedeutung
eines Kernes der S c h w a n n ’schen Scheide degradirt.Da ich nun glaube, dass in meiner Untersuchung „Ueber den Bau der
Nervenfasern und Nervenzellen beim Flusskrebs“1 eine wohl begründete Lösung
des uns beschäftigenden Problems gegeben ist, will ich mir erlauben,
den Inhalt derselben an dieser Stelle vorzubringen. Vorher muss ich es aber
rechtfertigen, dass ich den Flusskrebs zum Object meiner Untersuchung gewählt,
oder dass ich den Ergebnissen derselben eine allgemeine Tragweite
zuerkennen möchte.Wir sind ja alle nur zu leicht geneigt, ein für die Gewebe oder Organe des
Frosches nachgewiesenes Structurverhältniss auf den Menschen zu übertragen,
während wir die an wirbellosen Thieren gewonnenen Erkenntnisse gern
für unverwerthbar nach dieser Richtung halten. Ob eine solche Uebertragung
über eine grössere oder geringfügigere Kluft in der Thierreihe statthaft ist,
lässt sich kaum jemals mit Sicherheit sagen. Es wird von der Natur des jeweiligen
Problems abhängen, ob wir in der Uebertragung einen mehr oder minder
verlässlichen Ersatz für die directe Beobachtung annehmen können, und
wir werden dabei immer Ueberraschungen und Enttäuschungen ausgesetzt
bleiben. Je schwieriger aber die directe Beobachtung, je1 Wiener akad. Sitzb. LXXXV. Bd. 1882.
S.
222
fundamentaler
das fragliche Structurverhältniss ist, desto mehr Werthschätzung darf eine
sichere Beobachtung an einer anderen Thiergattung beanspruchen; und dies
trifft auch für unseren Fall zu.Es handelt sich um den feineren Bau eines einfachen Gewebes, dessen Elemente
bei Wirbelthieren und Wirbellosen offenbar identische Formverhältnisse
zeigen. Sehen wir von der Markscheide ab, die bekanntlich auch den
Nerven des Amphioxus und der Petromyzonten unter den Fischen abgeht, wie
einem Theil der Nervenfasern selbst beim Menschen zeitlebens, so haben wir
obiger Behauptung kaum eine wichtigere Einschränkung hinzuzufügen. Die
Nervenfaser ist hier wie dort ein Fortsatz der Nervenzelle; die Ansicht von
Wa l d e y e r , 1 welcher die Fasern der peripheren Nerven bei Wirbellosen
immer nur durch Vermittlung einer fibrillären Masse im Ganglion mit den
centralen Nervenzellen zusammenhängen liess, ist durch die Untersuchungen
von C l a u s 2 berichtigt worden, derzufolge die Fortsätze der centralen
Nervenzelle direct in Nervenfasern meist der gekreuzten Seite übergehen; die
Existenz multipolarer Zellen im Nervensystem Wirbelloser, eine Zeit lang
angezweifelt, ist nun sicher nachgewiesen; ja ich habe aus der Bauchganglienkette
des Flusskrebses multipolare Zellen isolirt, welche ganz dem Schema von
D e i t e r s entsprachen: neben vielen verzweigten, in ihrer Substanz dunkleren
Fortsätzen besassen sie je einen, der vom Anfang an drehrund, heller
und unverzweigt erschien. Sicherlich gibt es Verschiedenheiten in der Structur
des Nervengewebes der beiden grossen Thierclassen; nur dass bis jetzt eher
die Uebereinstimmung auffällig ist, und dass die Verschiedenheit keine fundamentale
zu sein scheint, wie ja auch die Entwicklungsgeschichte die Kluft
zwischen Wirbelthieren und Arthropoden nicht mehr für unüberbrückbar hält.Ueber den feineren Bau des Nervensystems der Wirbellosen schweben dieselben
Controversen wie bei den Wirbelthieren, und es hat nicht einmal den
Anschein, als ob die Erstreckung der Untersuchung auf so verschiedenartiges
Material, als unter dem Namen der Wirbellosen zusammengefasst wird, an
solcher Uneinigkeit Schuld wäre. Denn Autoren, welche alle Thierclassen
berücksichtigt haben, sprechen sich für einen einheitlichen Bau der Elemente
des Nervensystems aus, während von demselben Object verschiedene
Untersucher ganz abweichende Beschreibungen geben.Sowohl bei Wirbellosen als bei Wirbelthieren scheitert die Untersuchung
der Structur der Nervenelemente an der grossen Zartheit und Hinfälligkeit
der letzteren, so dass Reagentien mit der Erhärtung gleichzeitig in unberechenbarer
und unbekannter Weise das Structurbild verändern. Die Untersuchung
im überlebenden Zustand kann allein die massgebende sein; frisch
isolirte Elemente untersuchen, ist aber nicht gleichwerthig mit der Untersuchung
überlebender, denn die mechanische Verletzung beim Isoliren mit
Nadeln, der chemische Insult durch fremdartige Zusatzflüssigkeiten reichen
hin, die auf die Erhaltung der Structur gerichtete Absicht zu vereiteln.1 Untersuchungen über den Ursprung und den Verlauf des Achsencylinders bei
Wirbellosen und Wirbelthieren. Zeitschrift für rationelle Medicin, XX, 1863.2 Der Organismus der Phronimiden. Arbeiten des zool. Institutes in Wien. II.
S.
223
Als ich an meine Arbeiten über diesen Gegenstand ging, sah ich
ein, dass es bei dem Stand der Dinge weniger auf die Breite als auf die Sicherheit
der Beobachtungen ankomme, dass es vortheilhafter sei, einen
Zweifel an der Uebertragbarkeit als an der Correctheit der Resultate zuzulassen
und ich wählte das Object, welches mir als das günstigste erschien,
ohne Rücksicht auf die mögliche Verschiedenheit zwischen Wirbellosen und
Wirbelthieren. Ich wählte den Flusskrebs, weil dessen Elemente so gross
sind, dass sie oft die Beobachtung durch die Hülle der Ganglien und Nervenstämme
erlauben, und weil ich im Krebsblut eine unschädliche Zusatzflüssigkeit
zu finden hoffte. Letzteres hat sich als nicht ganz richtig herausgestellt;
doch ist es mir gelungen, solcher Elemente ansichtig zu werden, welche nach
sicheren Kennzeichen als überlebende aufzufassen sind, und ich habe meine
Anschauungen über die Structur der Nervenelemente nur an solchen überlebenden
Zellen und Fasern gewonnen.Die Beobachtung ist auch unter solchen Verhältnissen noch eine schwierige,
die Anzahl der im überlebenden Zustande erhaltenen Elemente eine
geringe. Welches die Kennzeichen dieses Zustandes sind, werden wir noch
später erörtern; beginnen wir jetzt mit der Darstellung des feineren Baues der
Nervenfasern beim Flusskrebs in Anknüpfung an die Angaben der ältesten
Untersucher, welche sich uns auch als die werthvollsten erweisen werden.
Die Nervenfasern des Flusskrebses präsentiren sich unter Mikroskop zunächst
als wasserhelle Röhren von elastischer, mit zahlreichen Kernen besetzter
Wand, deren Inhalt bei Druck wie eine Flüssigkeit oder wenigstens
sehr weiche Masse austritt und dann meist körnige Gerinnungen ergibt. So
viel lehrten schon die Beobachtungen von H e l m h o l t z 1 , 1842 in
dessen Dissertation niedergelegt, und die Untersuchung der Gewebe des
Flusskrebses von H a e c k e l in seiner Dissertation 1856. Aber schon
im Jahre 1843 entdeckte R. R e m a k ,2 dass im Innern der breitesten (bis
0.1 mm.) Nervenröhren ein Bündel sehr zarter Fibrillen enthalten ist, welches
er auch in den feineren Nerven vermuthete, aber nicht sehen konnte.
R e m a k ’s Scharfblick erfasste die Anschauung, dass „das centrale Faserbündel
zusammt dem gerinnbaren flüssigen Inhalt dem Achsencylinder (der
Wirbelthiere) entspricht, wofür auch die von mir (Remak) bemerkte Längsstreifung
des letzteren sprechen würde“.H a e c k e l 3 bestätigte R e m a k ’s Beobachtung und schloss sich dessen
Hypothese an; seither haben aber fast alle Beobachter R e m a k ’s Fund
bestritten oder dessen Bedeutung verkannt. Wa l d e y e r dagegen, der auf
Grund der breitesten Beobachtung für den fibrillären Bau der Nervenfaser
eintrat, bestritt eine Zwischensubstanz der Fibrillen und fasste das dafür
Beschriebene als Reste zertrümmerter Fibrillen auf.
Wenn wir die Nervenfasern des Flusskrebses und anderer Crustaceen (des
Hummers, der Squilla etc.) unter den für die Erhaltung1 Wissenschaftl. Abhandlungen. 1882. II. Bd., p. 664.
2 Ueber den Inhalt der Nervenprimitivröhren. Müller’s Archiv, 1843.
3 Ueber die Gewebe des Flusskrebses. Müller’s Archiv, 1857.
S.
224
der Structur
günstigsten Bedingungen und an Elementen, die mit überlebenden Nervenzellen
zusammenhängen, studiren, können wir nicht anders als R e m a k ’s
Beobachtungen bestätigen und seine Vermuthungen durch Beobachtung zur
Gewissheit bringen. In allen Nervenröhren des Flusskrebses ist ein Bündel
zarter, scharf gezeichneter Fibrillen vorhanden, die, einander parallel
laufend, keinerlei Verbindung mit einander eingehen. In den grössten, den
„kolossalen“ Fasern liegt dasselbe, wie R e m a k gesehen, central, von einem
Cylinder weicher Substanz umgeben, in den feineren Nervenröhren ist
diese einhüllende Substanz reducirt. Die directe Beobachtung schützt uns
auch vor dem Irrthum, etwa Längsstreifen oder Faltungen der Wandung für
fädige Inhaltsgebilde zu halten. Die Grösse der Elemente ermöglicht eine
sichere Entscheidung durch Einstellung mit der Schraube; zum Ueberfluss
kann man an den Ganglien der Squilla mantis oberflächliche Faserschlingen
auf ihren optischen Querschnitt untersuchen, der die Fibrillen als im Innern
der Faser enthaltene Pünktchen zeigt. Durch Druck auf eine kolossale
Faser können wir das Fibrillenbündel zum Austritt bringen; wir sehen dann,
dass die einzelnen Fäserchen nicht mit einander verklebt sind und dürfen
annehmen, dass dieselbe Substanz, welche den äusseren Mantel bildet, auch
die Zwischenräume zwischen den einzelnen Fibrillen ausfüllt. Wir gelangen
so zum Resultat: Die Nervenfasern des Flusskrebses enthalten g e r a d l i -
n i g e F i b r i l l e n , u m g e b e n u n d i s o l i r t v o n e i n e r
w e i c h e n Z w i s c h e n s u b s t a n z .Freilich, diese Structur ist eine sehr hinfällige. Schon das Eindringen des
Krebsplasmas von der Schnittstelle aus reicht hin, die Fibrillen in Körner
zerfallen zu lassen, die eine Zeit lang durch die Anordnung in Längsreihen
ihre Herkunft verrathen. Mitunter sucht man die Fibrillen vergebens in den
feineren Nervenröhren, ja, man vermisst sie selbst in den kolossalen, aber
nach sorgfältiger Untersuchung musste ich doch diese häufigen Misserfolge
der Hinfälligkeit der Structur zur Last legen und die Fibrillen als ein immer
und überall präformirtes Structurelement ansehen. Wer etwa in den feinen
Fäden das Product einer eigenthümlichen Zersetzung des Nervenrohres erblicken
will, dem ist entgegenzuhalten, dass man häufig genug eine fibrillär
gebaute Nervenfaser körnig oder homogen werden sieht, aber niemals das
Umgekehrte.Die fibrilläre Structur der Nervenfaser ist am deutlichsten und gleichzeitig
am haltbarsten an dem centralen Ende derselben, wo sie meist mit allmäliger
Verbreiterung in die Nervenzelle übergeht. Dort sieht man nicht selten die
Fibrillen einen Wirbel bilden, und dann verschwinden sie in der Substanz
des Zellleibes. Ehe wir aber die Structur der überlebenden Nervenzellen beschreiben,
wollen wir kurz anführen, welche Angaben über das Aussehen
dieser Elemente in der Literatur vorzufinden sind.Die meisten Autoren beschreiben die Nervenzellen des Flusskrebses als
körnig oder als homogen; R e m a k ist wiederum zuerst eine concentri-
sche Streifung des Zellleibes aufgefallen, die selbst nach Behandlung mit
Reagentien hervortritt. Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass das körnige
Ansehen der Nervenzelle dem abgestorbenenS.
225
Zustande derselben entspricht; untersucht man überlebende Elemente,
so findet man kaum ein isolirtes Körnchen in ihnen, vielmehr ist eine
Streifung in ihnen deutlich, welche einerseits um den Kern concen-
trisch, andererseits gegen den Fortsatz convergirend verläuft. Diese
Streifen entsprechen nicht etwa um einander gelegten Schalen,
sondern setzen sich aus kurzen Stücken optisch
dichterer Substanz zusammen, welche durch hellere Zwischenräume getrennt
sind und nach kurzem Verlauf mit anderen dunkleren Bogenstücken zusammenfliessen.
Ich kann die Beschreibung nicht gut von der Auffassung
des Bildes trennen und will gleich sagen, dass ich diese Structur auffasse als
ein Balkennetz protoplasmatischer Substanz, welches von einer homogenen
Zwischensubstanz ausgefüllt ist. Wirklich haben diese Balken ganz das Ansehen
des Protoplasmas in lebenden Zellen, und die Berechtigung, von einer
zusammenhängenden Zwischensubstanz zu sprechen, ergibt sich aus Bildern,
an denen das Balkennetz sich von einem grösseren oder kleineren Theile der
Zellperipherie zurückgezogen hat, und nun daselbst eine glänzende, homogene
Masse von demselben Ansehen, wie es der Zellkern bietet, sichtbar wird.Die wichtigste Frage ist nun: Wie verhalten sich die Fibrillen der Nervenfaser
in der Nervenzelle? Da sieht man denn mit aller Klarheit, wie die einzelnen
Fibrillen, die im Uebergangsstück zwischen Zelle und Faser besonders
deutlich geworden sind, in der Zelle angekommen, ihre scharfe Begrenzung
verlieren und einzeln in Balken des gegen den Fortsatz hin offenen Netzes
übergehen. Von einer Beziehung der Fibrillen zum Kerne oder von einem
isolirten Verlauf derselben durch den Zellleib ist auch keine Andeutung zu
sehen. Zumal an den bi- und multipolaren Zellen ist es offenbar, dass die
Fibrillen der verschiedenen Fortsätze nur durch das Netzwerk im Innern der
Zelle mit einander zusammenhängen.Wir können also von der Structur der Nervenzelle des Flusskrebses aussagen:
D i e N e r v e n z e l l e b e s t e h t a u s z w e i S u b s t a n z e n ,
v o n d e n e n d i e e i n e , n e t z f ö r m i g a n g e o r d n e t e ,
s i c h s i c h t l i c h i n d i e F i b r i l l e n d e r N e r v e n f a s e r ,
d i e a n d e r e , h o m o g e n e , s i c h w a h r s c h e i n l i c h i n
d i e Z w i s c h e n s u b s t a n z d e r s e l b e n f o r t s e t z t .Jetzt müssen wir aber nach der Begründung fragen, warum wir die eben
beschriebene Erscheinung der Nervenzelle und nicht etwa die körnige als
den überlebenden Zustand aufgefasst haben. Wir können uns darauf berufen,
dass Zellen, die den netzförmigen Bau zeigen, unter unseren Augen körnig
werden, aber niemals umgekehrt, und dass wir die ausführlich beschriebene
Structur der Nervenzelle dort finden, wo wir auf möglichste Schonung der
Structur rechnen dürfen. Wir können aber viel mehr entscheidende Argumente
beibringen. An den körnigen Nervenzellen ist der Kern von einem
dicken Contour eingerahmt, in seinem Innern feinkörnig und enthält meist
zwei stark glänzende, homogene Kernkörperchen. Ganz ähnlich ist das Aussehen
des Kernes an Präparaten, welche durch Reagentien conservirt sind.
In den Zellen aber, welche wir als überlebende aufgefasst haben, erscheint
der Kern entweder ganz verschwommen oder nur von einer feinen Linie
begrenzt, er ist homogen, glänzend, und zeigt in seinem Inhalt ausser den
beiden grossen KernkörperchenS.
226
zahlreiche geformte Gebilde, welche Lage- und Gestaltsveränderungen
vollführen. Diese Inhaltsgebilde sind entweder kurze dicke Stäbchen,
oder lange, abgebogene Fäden, oder winkelig geknickte, gegabelte,
rosettenartig zusammengesetzte, oft sehr zierliche
Bildungen. Fasst man einen Kern mit solchen Inhaltskörpern in’s Auge, so
sieht man, wie die einzelnen Stäbchen und Stücke derselben sich von einander
entfernen und sich einander nähern, wie bald hier bald dort ein früher
tiefliegendes Glied einer solchen Figur an die Oberfläche kommt, oder wie
complicirte Figuren zerbrechen und einzelne der Bruchstücke an eine andere
Stelle im Kern gelangen. Diese Bewegungen geschehen etwa mit der
Schnelligkeit der amöboiden Bewegung an weissen Blutkörperchen, also im
Allgemeinen mit einer ziemlich wechselnden Schnelligkeit, welche jedoch
innerhalb der für die Protoplasmabewegung beobachteten Grenzen bleibt.Setzt man die Beobachtung einer solchen Zelle lange genug fort oder
drückt man dieselbe, so verschwinden die Inhaltskörper sehr bald, der Kern
wird fein granulirt, umgibt sich mit einem doppelten Contour und gleichzeitig
wird der Leib der Zelle körnig. Es dürfte also keinem Widerspruch
begegnen, wenn ich solche Zellen für überlebende erkläre und die an ihnen
beobachtete Structur für die massgebende erachte.Wenn wir aber übersehen, was uns die überlebende Nervenzelle an Structurverhältnissen
geboten hat, muss uns auffallen, dass nichts davon eine Ei-
genthümlichkeit der Nervenzelle bedeutet. Derselbe Bau des Zellleibes ist
durch zahlreiche Untersuchungen zahlreicher Autoren bei Drüsen-, Epithelial-,
Geschlechtszellen nachgewiesen worden. Es scheint dies die allgemeine
Structur des lebenden Protoplasmas zu sein. Ich will aus der grossen
Menge von Belegen für diesen Satz nur einen herausheben: die Beobachtungen
K u p f f e r ’s an den Speicheldrüsen von Periplaneta orientalis,1 weil
an diesen Elementen die netzförmig angeordnete Substanz des Zellleibes in
directem Zusammenhange mit den eintretenden Nervenfibrillen steht, ganz
wie an unserem Nervenpräparat vom Flusskrebs. Auch das Verhalten des
Kernes im überlebenden Zustande, die geformten Gebilde desselben, welche
Lebenserscheinungen zeigen u. s. w., entsprechen vollkommen unseren
Kenntnissen über die Structur anderer Zellen und sind nur eine Ausdehnung
derselben auf das Nervengewebe. Die veränderlichen Inhaltsgebilde insbesondere
sind zumeist aus Anlass der Kerntheilung beobachtet worden; es
liegen aber Gründe vor, sie auch in „ruhenden“ Kernen anzunehmen. Nachdem
wir also eine complicirte Structur der Nervenzellen beschrieben haben,
sind wir auf einem Umweg dazu gelangt, denselben jede charakteristische
Structur abzusprechen. Wir dürfen sagen: D i e N e r v e n z e l l e b e -
s t e h t a u s n i c h t d i f f e r e n z i r t e m , d i e N e r v e n -
f a s e r a u s f ä d i g d i f f e r e n z i r t e m P r o t o p l a s m a .
Die Fibrillen der Nervenfaser verhalten sich zum Leib der Nervenzelle wie
die Flimmerhaare einer Flimmerzelle zu dem Protoplasmanetz derselben,
dessen differenzirte und isolirte Fortsetzungen sie sind.1 Festgabe an C. Ludwig, 1874.
S.
227
Nachdem wir die Structur des Nervengewebes an einem aus der
Thierreihe ausgewählten Objecte erkannt haben, wird es vielleicht lohnend
sein, zur Frage nach der allgemeinen Giltigkeit der erlangten Resultate zurückzukehren.
Für die Nervenfaser ergibt sich nun das neue Argument, dass
die fibrilläre Structur im Gegensatz zu einem homogenen oder körnigen
Aufbau eine Differenzirung bedeutet, die man nicht leicht höheren Thieren
wird absprechen wollen, wenn sie bei niederen nachgewiesen ist. Man darf
auch aufmerksam machen, dass die Annahme einer Zusammensetzung der
Nervenfaser aus hinfälligen Fibrillen und einer weichen Zwischensubstanz
eigentlich allen guten Beobachtungen gerecht wird, welche über die Nerven-
fasern der Wirbelthiere gemacht worden sind. Die Controversen scheinen
daher zu rühren, dass die einen Beobachter nur den einen, die anderen nur
den anderen Bestandtheil der Nervenfaser nachzuweisen sich bemühten.
So schliessen z. B. F l e i s c h l 1 und B o l l 2 aus unanfechtbaren Beobachtungen
auf das Vorhandensein einer sehr weichen Substanz im Achsencylinder,
leugnen aber unbegründeterweise die Fibrillen, auf welche ihre
Beobachtungen keinen Bezug haben konnten. F l e i s c h l und B o l l
nennen diese Substanz eine „Flüssigkeit“, während die Annahme einer sehr
weichen Substanz ihren Beobachtungen zu genügen scheint. Ob etwas eine
Flüssigkeit im physikalischen Sinne des Wortes oder nur ein Körper von sehr
geringer Consistenz ist, der darum noch eine complicirte Molecularstructur
besitzen mag, lässt sich nach solchen Beobachtungen, wie sie die erwähnten
Autoren angestellt haben, nicht entscheiden. Der Inhalt der lebenden Muskelfaser
verhält sich ebenfalls wie eine Flüssigkeit und doch ist über dessen
complicirte morphologische und Molecularstructur kein Zweifel.Vor Kurzem erst ist es K u p f f e r 3 gelungen, die Fibrillen in den
Nervenfasern des Frosches durch Behandlung mit Osmiumsäure, Färbung
mit Säurefuchsin und Untersuchung mit starken Immersionslinsen zur Ansicht
zu bringen. Die Sicherheit des Erfolges und die Regelmässigkeit der
so dargestellten Fibrillen dürften den Streit um die Structur der Nervenfasern
bei Wirbelthieren zu Ende bringen, obwohl K u p f f e r ’s Beobachtung
nicht am lebensfrischen Gewebe gemacht ist. Prof. K u p f f e r hat es unterlassen,
in seiner Veröffentlichung auf meine Befunde am Krebs Rücksicht
zu nehmen, von denen er, wie ich einer freundlichen brieflichen Mittheilung
entnehme, keine Kenntniss hatte.In Betreff der Structur der Nervenzelle konnte ich mich schon, als ich
meine Beobachtungen beim Flusskrebs niederschrieb, auf ganz übereinstimmende
Angaben berufen, welche S c h w a l b e 4 über die Spinalganglienzellen
des Frosches gemacht hatte. Wir finden also nachträglich, dass die
Ausdehnung unserer Anschauungen von der Structur des Nervengewebes
beim Flusskrebs auf die Wirbelthiere nicht allein auf den zu Eingang angeführten
Erwägungen ruht,1 Ueber die Beschaffenheit des Achsencylinders. Festgabe an C. Ludwig, 1874.
2 Ueber die Zersetzungsbilder der markhaltigen Nervenfasern. Archiv für Anatomie
und Entwicklungsgeschichte, 1877.3 Sitzungsb. der baierischen Akad. 1883.
4 Bemerkungen über die Kerne der Ganglienzellen. Jena’sche Zeitschr., 1875.
S.
228
sondern sich auf stückweise Bekräftigung durch directe Beobachtungen
berufen kann.In vollkommenem, auch physiologisch bedeutsamem Gegensatz zu unserer
Ansicht von der Structur der Nervenzelle steht die bekannte Darstellung
M. S c h u l t z e ’s, in welcher gelehrt wird, dass die Fibrillen der Nervenfaser
auch im Zellleib ihre Selbstständigkeit und Isolirung bewahren, indem
sie nach complicirtem Verlaufe durch die feinkörnige Zellsubstanz in die
Fibrillen eines anderen Fortsatzes übergehen. Die Zelle erscheint demnach
wesentlich als eine Station zur Umlagerung der Fibrillen, welche durchgehende
und ununterbrochene Leitungsbahnen darstellen. Die angebliche feinkörnige
Zellsubstanz liegt, sowie der Kern, ausserhalb der nervösen Leitung,
ein Schluss, den M. S c h u l t z e nicht selbst gezogen hat, der sich aber bei
schärferer Fassung des von ihm mit aller Reserve Vorgebrachten zwingend
ergibt. Damit stimmt zusammen, dass M. S c h u l t z e die bipolaren Nervenzellen
für nichts Anderes als eine kernhaltige Stelle des Achsencylinders
erklären kann, und dass er Bedenken trägt, eine „Endigung“ der Nervenfaser
in der Nervenzelle anzunehmen.Wir dürfen wohl schwere Bedenken gegen die Massgeblichkeit der M.
S c h u l t z e ’schen Beobachtungen geltend machen. Zunächst wird deren
Werth durch die Bemerkung gemindert, dass sie sich nicht auf überlebende,
sondern abgestorbene Elemente beziehen. Dafür spricht das Aussehen des
Kernes und das Körnige der Zellsubstanz, zusammengehalten mit der Angabe,
dass diese Structurverhältnisse an Elementen erkannt worden sind, welche
„frisch“ mit Jodserum behandelt waren. Ferner geht aus M. S c h u l t z e ’s
Worten klar hervor, dass die Fibrillen sich im Zellleibe der Verfolgung entziehen;
es wird uns ausdrücklich gesagt, dass es nicht ein einzigesmal gelungen
ist, den Verlauf einer Fibrille aus einem Fortsatze durch den Zellleib in einen
anderen Fortsatz zu überblicken. Ich glaube, die Häufung der Fibrillen in
den multipolaren Zellen, an welchen M. S c h u l t z e diese Beobachtungen
ausführte, macht dieselben für den in Betracht kommenden Zweck sehr ungeeignet.
Es scheint besser gerechtfertigt, die Structur der multipolaren Zellen
durch das Studium der einfacher gebauten bipolaren und unipolaren zu
erläutern, und wenn wir diesen Weg einschlagen, gelangen wir zu dem entgegengesetzten
Ergebniss über das Verhältniss der Elemente des Nervensystems.
Wenn wir die Annahme machen, dass die Fibrillen der Nervenfaser die
Bedeutung von isolirten Leitungsbahnen haben, dann müssen wir sagen,
d a s s d i e i m N e r v e n g e t r e n n t e n B a h n e n i n
d e r N e r v e n z e l l e z u s a m m e n f l i e s s e n , dann muss uns
die Nervenzelle als der „Anfang“ aller Nervenfasern gelten, welche anatomisch
mit ihr im Zusammenhange stehen. Es würde die Grenzen, die ich
mir gesteckt habe, überschreiten, wollte ich vorbringen, was derzeit für
die Giltigkeit der erwähnten Annahme vorliegt; auch weiss ich, dass das
vorhandene Material nicht zur Entscheidung dieser physiologisch bedeutungsvollen
Frage ausreicht. Wenn sich diese Annahme beweisen liesse,
kämen wir ein gutes Stück in der Physiologie der Nervenelemente weiter;
wir könnten dann daran denken, dass ein Reiz von gewisser Stärke
die Isolirung der Fibrillen zu durch-S.
229
brechen vermag, so dass die Nervenfaser als Ganzes die Erregung
leitet; wir könnten suchen, welche Innervationsstörung einer etwaigen
Ernährungsstörung entspricht, durch welche die isolirte Leitung der
Fibrillen in der Nervenfaser aufgehoben wird u. dgl., doch will ich
dieses Gebiet verlassen und lieber aus der Histologie des Nerven-
systems ein Beispiel anführen, in welchem die Annahme der fibrillären
Structur sich als aufklärend für ein morphologisches Verhältniss
erweist.Es ist lange bekannt, dass die Spinalganglien der Fische bipolare Zellen
enthalten, deren Fortsätze nach entgegengesetzten Richtungen – central und
peripher – verlaufen. Es ist durch die Untersuchungen von R a n v i e r ,1
dann von K e y und R e t z i u s 2 erwiesen worden, dass die Spinalganglienzellen
der höheren Wirbelthiere nicht eigentlich unipolar sind, sondern
einen Fortsatz besitzen, welcher nach längerem oder kürzerem Verlauf in
zwei entgegengesetzt gerichtete Fortsätze auseinandergeht. Ich3 habe dann
gezeigt, dass bei einem der niedersten Wirbelthiere, dem Petromyzon, beide
Zellformen in den Spinalganglien vorhanden sind und einander morphologisch
vertreten, auch durch eine fliessende Reihe von Uebergangsformen
verbunden werden. Nach diesen Befunden scheint die Ueberzeugung von der
anatomischen Gleichwerthigkeit der bipolaren und der unipolaren Zellen
mit getheiltem Fortsatz allgemeinen Eingang gefunden zu haben.15 Die Annahme
einer physiologischen Gleichwerthigkeit scheint dagegen auf Schwierigkeiten
zu stossen. In der bipolaren Zelle liegt der Zellleib offenbar auf
dem Wege der Nervenleitung, in der unipolaren Zelle liegt er seitab davon,
und es scheint für die Leitung der Erregung einen kürzeren Weg aus dem
centralen Fortsatz in den peripheren zu geben. Diese Schwierigkeit besteht
aber nur so lange, als wir die Nervenfaser als eine einheitliche Leitungsbahn
betrachten. Sobald wir in der Nervenfaser isolirt leitende Fibrillen annehmen,
ist diese Schwierigkeit behoben. Es ist dann offenbar gleichgiltig, ob
die isolirt leitenden Fibrillen beider Fortsätze von einander getrennt oder in
einer Strecke neben einander liegen; der Weg der Erregung geht dann immer
durch das Protoplasmanetz im Zellleib, und die morphologische Gleichwerthigkeit
hat ihr physiologisches Correlat gefunden.1 Comptes Rendus, T. 81.
2 Studien in der Anatomie des Nervensystems und des Bindegewebes, 1876.
3 Sitzungsb. der Wiener Akademie, LXXVIII. Bd., 1878.
7173936
221
–229