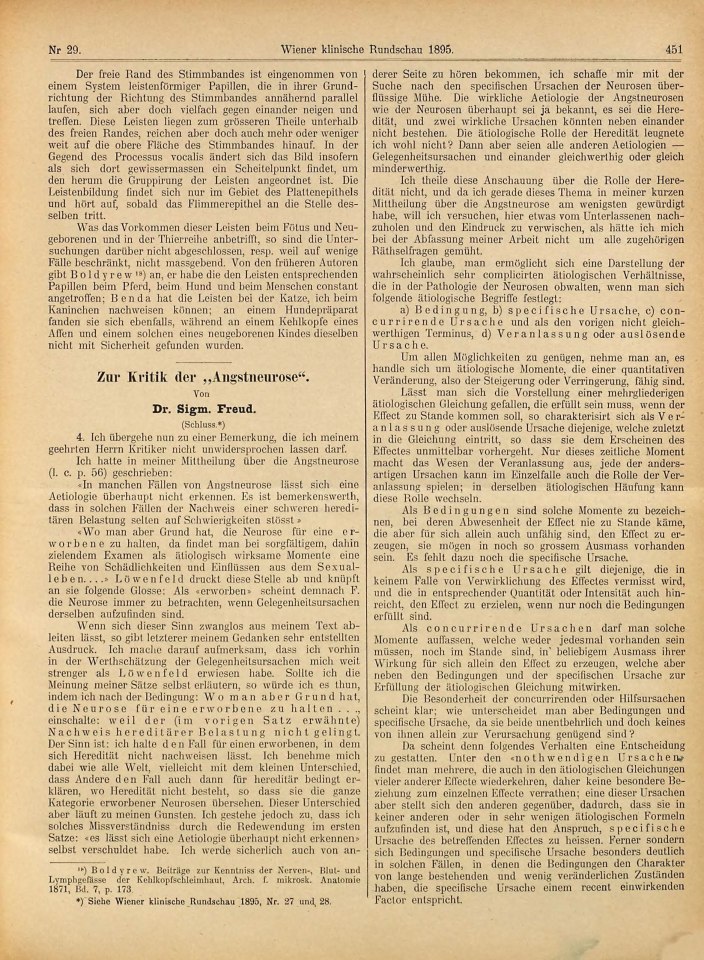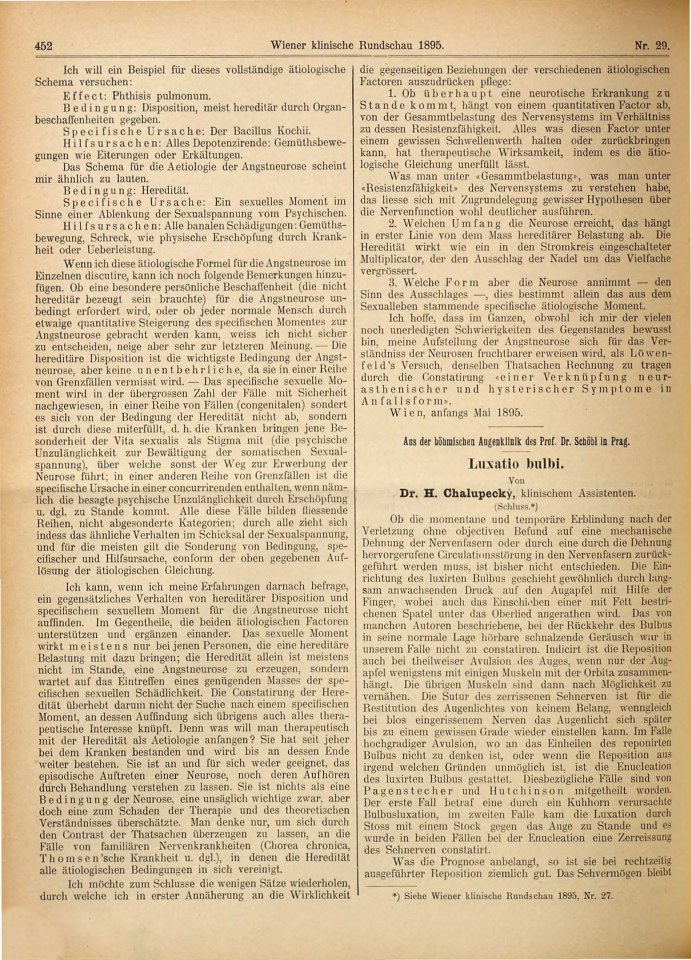S.
Der freie Rand des Stimmbandes ist: eingenommen von
einem System leistenl'ürmiger Papillen, die in ihrer Grund-
richtung der Richtung des Stimmbendes annähernd parallel
laufen, sich aber doch vielfach gegen einander neigen und
treffen. Diese Leisten liegen zum grösseren Theile unterlith
des freien Bundes, miehen aber doch auch mehr oder weniger
weit auf die obere Fläche des Stimmbandes hinauf. In der
Gegend des Processus vooalis ändert sich das Bild insofern
als sich dort gewissermassen ein Scheitelpunkt findet, um
den herum die Gruppirung der Leisten angeordnet ist. Die
Leistenbildung findet sich nur im Gebiet des Plattenepithels
und hört auf, sobald das Flilnlnerepithel im die Stelle des-
selben tritt.Was das Vorkommen dieser Leisten heim Fütus und Neu-
geborenen und in der Thierreihe nnhetriil‘t, so sind die Unter-
suchungen darüber nicht abgeschlossen, resp. weil auf wenige
Fälle beschränkt, nicht. illassgehcnd. Von den früheren Autoren
gibt B 0 ] dyrew m) an, er habe die den Leisten entsprechenden
Pnpillen beim Pferd, beim Hund und beim Menschen constant
angetrotl'en; B ende hat die Leisten bei der Katze, ich beim
Kaninchen nachweisen können; an einem Hundepriiparnt
fanden sie sich ebenfalls, wiihrend an einem Kehlkopfe eines
Affen und einem solchen eines neugeborenen Kindes dieselben
nicht mit sicherheit gefunden wurden.Zur Kritik der „Angstneurose“.
VonDr. Sig-m. Proud.
(Schluss!)4, Ich übergehe nun zu einer Bemerkung, die ieh meinem
geehrten Herrn Kritiker nicht unu'idei‘spi'ocherl lassen darf.Ich hatte in meiner Mittheilung über die Angstncurose
(l. c. p. 56) geschrieben:«In manchen Fällen von Angstneurosc lässt sich eine
Aetiolcgie überhaupt nicht erkennen. Es ist bemerkenswerth,
dass in solchen Fällen der Nachweis einer schweren heredi»
tären Belastung selten aufSchwierigkcitcn stllsst»«Wo man aber Grund hat die Neurnse fiir eine er-
Worbene zu halten, da findet man bei sorgfiiltigem, dahin
zielendem Examen als ätiologisch wirksame Momente eine
Reihe von Schädlichkeiten und Einflüssen aus dem Sexual—
leben „.) Lilwenfeld druckt diese Stelle al) und knüpft
an sie folgende Glosse: Als «erworben» scheint demnach F.
die Neurose immer zu betrachten, wenn Gelegcnheitsursachen
derselben aufzufinden sind.Wenn sich dieser Sinn zwanglos aus meinem Text abe
leiten lässt, so gibt letzterer meinem Gedanken sehr entstcllten
Ausdruck. Ich mache darauf aufmerksam, dass ich vorhin
in der Werthschi'itzung der Gelngrnheitsursaehen mich weit
strenger als Löwenfeld erwiesen habe. Sollte ich die
Meinung meiner Sätze selbst erläutern, so wiirde ich es thun,
indem ich nach der Bedingung: W u m an aber Grund hat,
die Neurone fiir eine erworbene zu halten . . .,
einschalte: weil der (im vorigen Satz erwähnte)
Nachweis hereditl'trcr Belastung nicht gelingt,
Der Sinn ist: ich halte ll en Fall für einen erworbenen, in dem
sich Hereditiit nicht nachweisen lässt. Ich benehme mich
dabei wie alle Welt, vielleicht mit. dem kleinen Unterschied
dass Andere den Fall auch dann fiir hereditär bedingt e
klären, wo Heredität nicht besteht, so dass sit: die ganze
Kategorie erworbener Neurusen übersehen. Dieser Unterschied
aber läuft zu meinen Gunsten, Ich gestehe jedoch zu, dass ich
solches Missverständnis durch die liedewenduug im ersten
Satze: «es lässt sich eine Aetlolngie iiberhaupt nicht erkennen—
selbst verschuldet habe. Ich werde sicherlich auch von an»..) uol_dyrrw. Beiträge zur Kennlliiss der Nerven, Blut- und
Lymphgeiiisse der K2hlknpfsclileimhaut, Arch. [ mikrosk, Anatomie
1871, Bel. 7, p. 173.») Siehe Wiener klinische Rundschnu tesa, Nr. 27 und, in.
Wiener klinische Rundschau 1895
derer Seite zu hören bekommen, ich schade mir mit der
Suche nach den specifischen Ursachen der Neurosen tib6r-
flüssige Mühe. Die wirkliche Aetiolngie der Angstncurosen
wie der Neurnsen überhaupt sei ja bekannt, es sei die Here
dität, und zwei wirkliche Ursachen könnten neben einander
nicht bestehen. Die ätiologische Rolle der Heredität leuguete
ich wohl nicht? Dann aber seien alle anderen Aetiologien —
Gelegenheitsursachcn und einander gleichwerthig oder gleich
nlinderwerthig.Ich theile diese Anschauung über die Rolle der Here—
dititt nicht, und da ich gerade dieses Thema in meiner kurzen
Mittheilung über die Angstneurose am wenigsten gewürdigt
habe, Will ich versuchen, hier etwas vom tlnterlasscncn nach-
zuholen und den Eindruck zu verwischen, als hätte ich mich
bei der Abfassung meiner Arbeit nicht um alle zugehörigen
Rilthsclfragen gemüht.Ich glaube, man ermöglicht sich eine Darstellung der
wahrscheinlich sehr complicirten ät'lologischen Verhältnisse,
die in der Pathologie der Neurosen 0bwalten, wenn man sich
folgende ätiologische Begriffe festlegt:a.) Bedingung, b) specifische Ursache, c) con—
currirende Ursache und als den vorigen nicht gleich
werthigcn Terminus, d) Veranlassung oder auslöscndc
U r s a c h 0.Um allen Möglichkeiten zu genügen, nehme man an, es
handle sich um ätiologische Momente, die einer quantitativen
Veränderung, also der Steigerung oder Verringerung, ruhig sind.Lässt man sich die Vorstellung einer mehrgliederigen
tltiologischen Gleichung gefallen, die erfüllt sein muss, wenn der
Effect zu Stande kommen soll, so charakterisirt sich als Vera
« n las s un g oder nuslösendc Ursache diejenige, welche zuletzt
in die Gleichung eintritt, so dass sie dem Erscheinen des
Effectes unmittelbar Vorhergeht. Nur dieses zeitliche Moment
macht das Wesen der Veranlassung aus, jede der anders-
artigen Ursachen kann im Einzelfalle auch die Rolle der Ver—
anlassung spielen; in derselben ältiologischen Häufung kann
diese Rolle wechseln.Als B edin gun gen sind solche Momente zu bezeich-
nen, bei deren Abwesenheit der Effect nie zu Stande käme,
die aber für sich allein auch unfähig sind, den Etlect zu er»
zeugen, sie mtlgen in noch so grossem Ausmass vorhanden
sein. Es fehlt dazu noch die specifische Ursache.Als specifische Ursache gilt diejenige, die in
keinem Falle von Verwirklichung des Effectes vermisst Wird,
und die in entsprechender Quantität oder Intensität auch hina
reichß den Effect zu erzielen, wenn nurnoch die Bedingungen
erfüllt sind.Als ccncurrirende Ursachen darf man solche
Momente autiassen, welche weder jedesmal vorhanden sein
miissen, noch im Stande sind, in' beliebigem Ausmass ihrer
Wirkung für sich allein den Effect zu erzeugen, welche aber
neben den Be 'ngungen und der specifischcn Ursache zur
Erfüllung der ätiologischen Gleichung mitwirken.Die Besonderheit der concurrirendcn oder Hilfsursachen
scheint klar; wie unterscheidet man aber Bedingungen und
specifische Ursache, da sie beide unentbehrlich und doch keines
von ihnen allein zur Verursachung genügend sind?Da scheint denn folgendes Verhalten eine Entscheidung
zu gestatten. Unter den «nothwcndigen l'rsachcm
findet man mehrere, die auch in den iitiologisclit‘n Gleichungen
vieler anderer Effecte wiederkehren, daher keine besondere lie-
xieliung zum einzelnen Effectc verrathen; eine dieser Ursachen
aber stellt sich den anderen gegeniiber, dadurch, dass sie in
keiner anderen oder in ‚sehr wenigen ätiologischen Formeln
uuizufuidcu ist, und diese hat den Anspruch, specifische
Ursache des betrefl'enden ElTectes zu heissen. Ferner sondern
sich Bedingungen und specifischc Ursache besonders deutlich
in solchen Fällen, in denen die Bedingungen den Charakter
von lange bestehenden und wenig veränderlichen Zuständen
haben, die specifische Ursache einem recent eillulrkendoii
Factor entspricht.S.
452
Ich will ein Beispiel für dieses vollständige ätiologische
Schema versuchen:E [ lest: Phthlsis pulmonum.
B e din gu n g: Disposition, meist hereditär durch Organ-
beschnil’enheiten gegeben.Speciiische Ursache: Der Bacillus Kochii.
H i l i” s u r s a c h e n: Alles Depotenzirende: Gemüthsbewe—
gungen wie Eiterungen oder Erkaltungcn,Das Schema für die Aetiologie der Angstneurose scheint
mir ähnlich zu lauten.Bedingung: Heredität.
Spa ci tisch e Ursache: Ein sexuelles Moment im
Sinne einer Ablenkung der Sexualspannung vom Psychischen.Hi 1 is ursach en: Alle banalen Schädigungen: Gemüths-
hewegnng, Schreck, wie physische Erschöpfung durch Krank—
heit oder Ueberleistung‚Wenn ich diese ätiologischc Formel für die Angstneurusc im
Einzelnen discutire, kann in. noch folgende Bemerkungen hinzu-
fügen. Oli eine besondere persönliche Beschafi‘enheit (die nicht
hereditär bezeugt sein brauchte) für die Angstneurose un-
bedingt erfordert wird, oder ob jeder normale Mensch durch
etwaige quantitative Steigerung des specifischen Momentes zur
Angstneurose gebracht werden kann, weiss ich nicht sicher
zu entscheiden, neige aber sehr zur letzteren Meinung.— Die
hereditäre Disposition ist die wichtigste Bedingung der Angst—
neurose, aber keine n ne n tb eh r l i c h 9, da sie in einer Reihe
von Grenzfiillen vermisst wird. — Das spccliische sexuelle Mo-
ment wird in der übergrossen Zahl der Fälle mit Sicherheit
nachgewiesen, in einer Reihe von Fällen (congenitalen) senden
es sich von der Bedingung der Heredit.ät nicht ab, sondern
ist durch diese miteri'tillt, d. h. die Kranken bringen jene 13c-
sonderheit der Vita sexualis als Stigma mit (die psychische
Unzulänglichkeit zur Bewältigung der somatischcn Sexual-
spsnnung), über welche sonst der Weg zur Erwerbung der
Neurose führt; in einer anderen Reihe von Grenzfiillen ist die
speciiische Ursache in einer conourrirenden enthalten, wenn näm—
lich die besagte psychische Unzulänglichkeit durch Erschöpfung
u. dgL zu Stande kommt. Alle diese Fälle bilden fliessendc
Reihen, nicht abgesonderte Kategorien; durch alle zieht sich
indes! das ähnliche Ver-halten im Schicksal der Sexualspannung,
und ftir die meisten gilt die Sonderung von Bedingung, spee
einscher und Hilßurs—nehe, conionn der einen gegebenen Ant-
lösung der ätiologischen Gleichung,Ich kann, wenn ich meine Erfahrungen damach heirage,
ein gegensätaliches Verhalten von herediiärer Disposition und
specilischern sexuellern Moment für die Angstneurose nicht.
auifinden. lm Gegentheile, die beiden ätiologisehen Factcren
unterstützen und ergänzen einander. Das sexuelle Moment
wirkt meistens nur bei jenen Personen, die eine hcrcditäre
Belastung mit dazu bringen; die Hereditäl allein ist meistens
nicht im Stande, eine Angelncurose zu erzeugen, sondern
wartet auf das Eintrefl‘en eines genügenden Masses der spe-
cifischen sexuellen Sehädlichkait. Die Constaürung der Here—
dilät überbebt darum nicht der Suche nach einem specitischen
Moment, an dessen Aulfindung sich übrigens auch alles thera»
peutische Interesse knüpr Denn was will man therapeutisch
mit der Heredität als Aetiologie anfangen? Sie hat seit jeher
bei dem Kranken bestanden und wird bis an dessen Ende
weiter bestehen. Sie ist an und fiir sich weder geeignet, das
episudische Auftreten einer Neurone, nach deren Authtiren
durch Behandlung verstehen zu lassen. Sie ist nichts als eine
8 e din g u n g der Neurose, eine unsäglich wichtige zwar, aber
doch eine zum Schaden der Therapie und des theoretischen
Verständnisses überschätzte. Man denke nur, um sich durch
den Contrast der Thatsachen überzeugen zu lassen, an die
Fälle von familiären Nerrcnkl'ankheiten [Chorea chronica,
Thomsen’sche Krankheit u. dgl.), in denen die Herediiät
alle aLiolugischen Bedingungen in sich vereinigt.ich möchte zum Schlusse die wenigen Suize wiederholen,
durch welche ich in erster Annäherung an die WirklichkeitWiener klinische Rundschau 1895.
Nr. 29.
die gegenseitigen Beziehungen der verschiedenen iltialogischen
Factoren auszudrucken pflege:1. Ob ti b e rh an )) t eine neurotische Erkrankung zu
Stande kommt, hängt von einem quantitativen Factor ab,
von der Gesammtbelsstung des Nervensystems im Verhältnis
zu dessen Resistenzt‘shigkeit. Alles was diesen Factor unter
einem gewissen Schwellenwerth halten oder zuruekbringen
kann, hat. therapeutische Wirksamkeit, indem es die Ettin-
logischc Gleichung um:th lässt,Was man unter «Gesammtbelastungr, was man unter
«Resistenzlähigkeit» des Nervensystems zu verstehen habe,
das hasse sich mit Zugrundelegung gewisser Hypothesen über
die Nerveul'unctinn wohl deutlicher ausführen.2. Welchen Umfang die Neurose erreicht, das hängt
in erster Linie von dem Mass hureditiirer Belastung ab, Die
Heredität wirkt wie ein in den Stromkreis eingeschaltetßr
Multiplicator, der den Ausschlag der Nadel um das Vielfache
vergrcssert.3. Welche Form aber die Neurose annimmt — den
Sinn des Ausschlages —-, dies bestimmt allein das aus dem
Sexuallehen stammende specifische ittiologische Moment.Ich halle, dass im Ganzen, obwohl ich mir der vielen
noch unerledigten Schwierigkeiten des Gegenstandes bewusst
bin, meine Aufstellung der Angstneurose sich für das Ver-
ständniss der Neurosen Fruchtbarer erweisen wird, als Löwen—
leid‘s Versuch, denselben Tlmlsachen Rechnung zu tragen
durch die Constatirung «einer Verknüpfung neur—
asthenischer und hysterisnher Symptome in
Aniallslnrnh.Wien, anfangs Mai 1395.
im flßt’ binnlrclun “(allle das ml. Dr. Wil ln Put,
Luxatlo billbl.Von
Dr. E. Gha.lupookü‚ klinischem Assistenten,
(Schluss!)Ob die momentane und temporäre Erblindung nach der
Verletzung ohne objectiven Befund nut eine mechanische
Dehnung der Nervenl'asern oder durch eine durch die Dehnung
hervorgerufene Circulatinnsslör'ung in den Nervenfasern zurück-
getllhrt werden muss, ist bisher nicht entschieden. Die Ein—
richtung des luxirlen Bulbus geschieht gewöhnlich durch lung-
sam anwachsenden Dmck auf den Auguptel mit Hilfe der
Finger, wobei auch das Einschi—‘bcn einer mit Fett bestri-
chenen Spare! unter das Oberlied ungerathen wird. Das von
manchen Autoren beschriebene, bei der Rückkehr des Bulbus
in seine normale Lage horbare scilnalzende Geräusch war in
unserem Falle n'chl zu conslaliren. lndicirt ist die Reposition
auch bei thein ser Avulsion «les Auges, wenn nur der Aug-
apl'cl wenigstens mit einigen Muskeln mit. der Orhila zusammen-
hängt. Die iibrigen Muskeln sind dann nach Möglichkeit zu
ver-nahen. Die Sutur des zenissenen Sehnerven ist tur die
Restitution des Augenlichtes von keinem Heizung, wenngleich
bei blos cingcrisscnem Nerven das Augenlicht sich später
bis zu einem gewissen Grade wieder einstellen kann. im Falle
hochgradiger Avulsion, wo an das Einheilen des rcponir‘ten
Bulbus nicht zu denken ist, oder wenn die Reposition aus
irgend welchen Gründen unmöglich ist, ist. die Enneleation
des luxirten Bulhus gestattet Diesbeztigliche Fälle sind von
Pagenstecher und Hutchinson mitgetheilt werden
Der erste Fall betritt eine durch ein Kullliom verursachte
llulbllsluxatinn, iin zweiten Falle kam die Luxation durch
Stoss mit einem Stock gegen dns Auge zu Stunde und es
wurde in beiden Fluten bei der Enucleation eine Zermissung
des Sehnerven constatirt.Was die Prognose anbelangt, so ist sie bei rechtzeitig
ausgei'uhrmr llcposilion ziemlich gut. Das Sehvcrmogcn bleibt') Siehe Wiener klinische Rundschau 1895, Nr. 274
mdp.39015006996527
451
–452