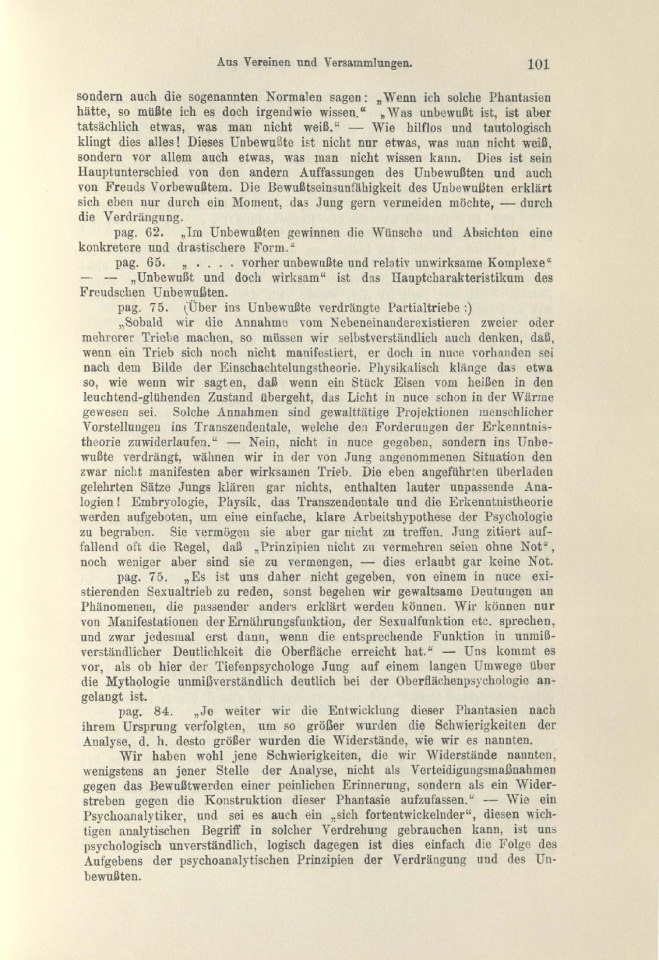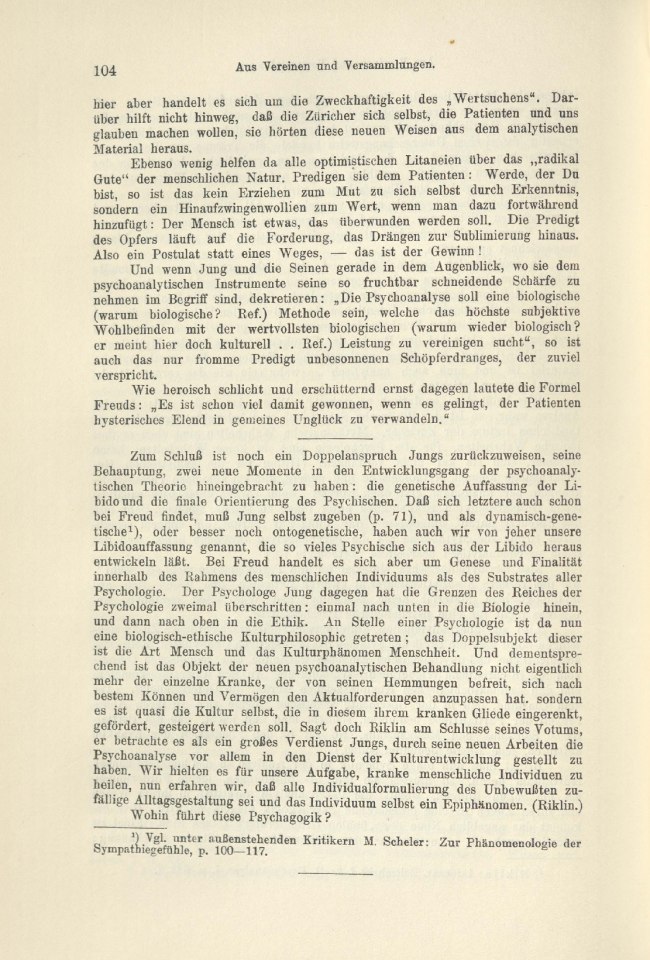S.
Aus Vereinen und Versammlungen,
Über das Ubw. bei Jung und seine Wendung ins Ethische. り
Von Dr. M. Eitingon.Man darf den Begriff des UnbewuBten zweifellos für den wichtigsten
Eckstein des Baues der psychoanalytischen Neurosenlehre erklären, Wohl
darum hat Freud, ein guter Baumeister, diesen Begriff so sorgfältig zu
sichern gesucht. Und er steht bestimmter vor uns als die andern wichtigen
Momente, als sein Korrelatsbegriff der Verdrängung, als die Sexualtheorie,
die Trieblehre u. a. m.Die Freudsche Konzeption des UnbewuBten ist bekanntlich enger als
der Begriff des UnbewuBten überhaupt, der eine lange Geschichte hat und
in der zeitgenössischen Psychologie von verschiedenen Autoren in sehr ver-
schiedener Weise definiert wird, worauf einzugehen wir hier keinen Anlaß
haben. Freuds UnbewuBtes sind nicht psychische Inhalte, von denen das
Subjekt nichts weil, sondern ein Psychisches, das durch den kontradiktorischen
Gegensatz zum BewuBten ausgezeichnet, eine Reihe ihm allein eigentümlicher
Züge hat: Seine [eigene psychische Realität, seine Unusurierbarkeit (was
einmal gut als seine ,Zeitlosigkeit“ bezeichnet worden ist), seine Freiheit
vom Satze des Widerspruches (die Gleichwertigkeit von Position und Ne-
gation bei seinen Inhalten), die überwiegende Symbolhaftigkeit seines Aus-
druckes etc. Nur ein solches Unbewuftes vermag den allgemeinen psycho-
analytischen Formeln für die neurotischen Symptome Inhalt zu geben, nur
auf seiner scharfumrissenen Plattform wird uns das „Negativ der Perversion“
zu einem wirksamen hinführenden Gesichtspunkt, Während das Unbewufte
von dem wir nur aussagen können, daß es von uns nicht gewußt ist, uns
auch kein Wissen über jene Phänomengruppe vermitteln kann.Freud kämpft für das Recht der Psychologie, ihre Tatsachen durch
ihre eigenen, adäquaten Hilfsmittel zu erklären, ohne sich von einer physio-
logisch orientierten Gedåchtnislehre beirren zu lassen.Wenn ein der Psychoanalyse Nahestender, wie z. B. Bleuler, das
Freudsche UnbewuBte vom UnbewuBten überhaupt nicht zu trennen vermag,
so ist das durchaus nicht nebensåchlich, wie er meint, sondern damit sinkt
sein Satz?): Dem Begriff des UnbewuSten gebe Freud mit Recht eine so
große Bedeutung, weil ohne ihn ein Verständnis der Neurosen, mancher
Psychosen und auch der Normalpsychologie nicht moglich sei, zu einer
vagen Phrase herab.Jung hat nun auch, aber weniger konsequent und offen als Bleuler,
und in großem Widerspruche zu seiner eigenen, so anspruchsvollen theoretischen1) Aus der Diskussion der „Berliner Psychoanalyt. Vereinigung“, a. 17. I. 14.
?) Bleuler: Kritik der Freudschen Theorien 1913. Allgemeine Zeitschrift fiir
Psychiatrie 70. V. p. 670.7
S.
100 Aus Vereinen und Versammlungen.
Attitüde, den psychoanalytischen Begriff 8 TUnbewuBten von seinem spezi-
fischen Inhalt leer gemacht uud durch fortwährende Verwechslungen und
Übersetzungen ins Vulgärpsychologische verschiedener Observanz entstellt.
Eine Reihe von Zitaten aus Jungs ,Versuch einer Darstellung der
psychoanalytischen Theorie“ sollen dies näher erläutern :
pag. 5. „Freuds geniale Empirie fand in jenen Studien bereits Momente,
die über die damalige Traumatheorie hinausführten : die Verdrängung, den
Mechanismus einer Hinausverlegung eines Bewußtseinsinhaltes in die außer-
bewußte Sphäre. Wir nennen diese Sphäre das Unbewußte und definieren
dieses als das uns nicht bewußte Psychische.“
pag. 24—25. „Aufgabe der Psychoanalyse ist es, den versteckten
Ort aufzufinden, an dem die Libido sich befindet und wo sie selbst dem
Patienten unzugänglich ist. Dieser Ort ist das „Nichtbewußte“, das man
auch als das „Unbewußte“ bezeichnet, ohne damit einen mysteriösen Sinn
zu verbinden. Wir wollen damit nicht mehr sagen, als daß die An-
nahme von psychischen Entitäten außerhalb des Bewußtseins ein notwendiges
Postulat ist. Denn die Erfahrung lehrt uns sozusagen tagtäglich, daß es
nichtbewußte psychische Prozesse geben muß, die den Libidohaushalt in
wirklicher Weise beeinflussen.“ — Das ist sehr vag! Ein derartiges Unbe-
wußte erkennen viele AuBenstehende an, die z. B. von ,unbowuBten Bedin-
gungen des BewuBtseins* sprechen.
pag. 49. „Die Kranke lebt in einer Phantasiewelt, welche man nicht
anders als infantil bezeichnen kann. Alle Nervenärzte und Psychiater haben
gewiß täglich Gelegenheit, von jenen kindischen Vorurteilen, Illusionen und
affektiven Ansprüchen, denen sich die Neurotiker hingeben, zu vernehmen.
Die frühesten Phantasien bestehen aus allerhand vagen und halbverstandenen
Eindrücken, die sie von ihren Eltern empfangen hatten, um den Vater grup-
pierten sich allerhand sonderbare Gefühle, schwankend zwischen Ängstlichkeit,
Grauen, Abneigung, Ekel, Liebe und Begeisterung.“ — Also alle Psychiater
kennen den Inhalt des „Unbewußten“ !
pag. 48. „Man bemerkte bald, daß die Kranken partiell oder total
noch in ihrer kindlichen Welt leben, nicht daß ihnen dies ohneweiters be-
wußt wäre! Im Gegenteil ist es die schwierige Aufgabe der Psychoanalyse,
die psychologische Anpassungsweise des Kranken so genau zu studieren, daß
man den Finger auf die infantilen Mißverständnisse legen kann.“
pag. 50. „Das Gebiet der unbewuBten Infantilphantasien ist zum
eigentlichen Forschungsobjekt der Psychoanalyse geworden, denn dieses Ge-
biet scheint den Schlüssel zur Ätiologie der Neurosen zu enthalten.“
„Diejenigen Phantasiesysteme, die sich schon auf bloße Befragung der
Patienten präsentieren, sind meist komponierter Natur, romanhaft und dra-
matisch ausgearbeitet, Sie sind trotz ihrer elaborierten Beschaffenheit von
relativ geringem Wert für die Erforschung des Unbewuften. Sie sind dazu
schon zu sehr den Anforderungen der Etikette und der gesellschaftlichen Moral
ausgesetzt, indem sie eben bewußt sind, — und nun nicht mehr viel verraten.
Die wertvolleren und die anscheinend einflufreicheren Phantasien sind nicht
pva in dem „vorhin definierten Sinne, Sie sind also nur auf dem Wege
A en > השא Technik zu eruieren.* = Warum sind nun diese
À h sien nicht bewußt? Was macht sic unbewuBt? Doch nicht
etwa Deutlichkeitsdradunterschiede nur?
„pag. öl. „Insofern diese Phantasien unbewußt sind, weiß der Kranke
EDINA Je rens ue direkte Befragung darüber wire ganz sinnlos,
wieder hören, daß die Patienten, und nicht nur diese,S.
Aus Vereinen und Versammlungen. 101
sondern auch die sogenannten Normalen sagen: ,Wenn ich solche Phantasien
hätte, so müßte ich es doch irgendwie wissen.“ „Was unbewuBt ist, ist aber
tatsächlich etwas, was man nicht wei — Wie hilflos und tautologisch
klingt dies alles! Dieses Unbewuóte ist nicht nur etwas, was man nicht weiß,
sondern vor allem auch etwas, was man nicht wissen kann. Dies ist sein
Hauptunterschied von den andern Auffassungen des Unbewuften und auch
von Freuds VorbewuBtem. Die Bewuftseinsunfühigkeit des Unbewuliten erklärt
sich eben nur durch ein Moment, das Jung gern vermeiden möchte, — durch
die Verdrängung.pag. 62. „Im UnbewuBten gewinnen die Wünsche und Absichten eine
konkretere und drastischere Form.*pag. 65. , ・ . . . vorher unbewnBte und relativ unwirksame Komplexe“
ー 一 ,UnbewuBt und doch wirksam“ ist das Hauptcharakteristikum des
Freudschen Unbewubten.pag. 75. (Über ins Unbewufite verdrüngte Partialtriebe :)
„Sobald wir die Annahme vom Nebeneinanderexistieren zweier oder
mehrerer Triebe machen, so müssen wir selbstverståndlich auch denken, daß,
wenn ein Trieb sich noch nicht manifestiert, er doch in nuce vorhanden sei
nach dem Bilde der Einschachtelungstheorie. Physikalisch klünge das etwa
so, wie wenn wir sagten, daß wenn ein Stück Eisen vom heißen in den
leuchtend-glühenden Zustand übergeht, das Licht in nuce schon in der Wärme
gewesen sei. Solche Annahmen sind gewalttätige Projektionen menschlicher
Vorstellungen ins Transzendentale, welche den Forderungen der Erkenntnis-
theorie zuwiderlaufen.^ — Nein, nicht in nuce gegeben, sondern ins Unbe-
wußte verdrängt, wühnen wir in der von Jung angenommenen Situation den
zwar nicht manifesten aber wirksamen Trieb. Die eben angeführten überladen
gelehrten Sätze Jungs klären gar nichts, enthalten lauter unpassende Ana-
logien! Embryologie, Physik, das Transzendentale und die Erkenntnistheorie
werden aufgeboten, um eine einfache, klare Arbeitshypothese der Psychologie
zu begraben. Sie vermügen sie aber gar nicht zu treffen. Jung zitiert auf-
fallend oft die Regel, daß „Prinzipien nicht zu vermehren seien ohne Not“,
noch weniger aber sind sie zu vermengen, — dies erlaubt gar keine Not.pag. 75. „Es ist uns daher nicht gegeben, von einem in nuce exi-
stierenden Sexualtrieb zu reden, sonst begehen wir gewaltsame Deutungen an
Phünomenen, die passender anders erklürt werden konnen. Wir kónnen nur
von Manifestationen der Ernührungsfunktion, der Sexualfunktion etc. sprechen,
und zwar jedesmal erst dann, wenn die entsprechende Funktion in unmif-
verständlicher Deutlichkeit die Oberfläche erreicht hat.“ — Uns kommt es
vor, als ob hier der Tiefenpsychologe Jung auf einem langen Umwege über
die Mythologie unmifjverståndlich deutlich bei der Oberflächenpsychologie an-
gelangt ist.pag. 84. „Je weiter wir die Entwicklung dieser Phantasien nach
ihrem Ursprung verfolgten, um so größer wurden die Schwierigkeiten der
Analyse, d. h. desto grofer wurden die Widerstinde, wie wir es nannten.Wir haben wohl jene Schwierigkeiten, die wir Widerstände nannten,
wenigstens an jener Stelle der Analyse, nicht als Verteidigungsmafinahmen
gegen das BewuBtwerden einer peinlichen Erinnerung, sondern als ein Wider-
streben gegen die Konstruktion dieser Phantasie aufzufassen.^ — Wie ein
Psychoanalytiker, und sei es auch ein „sich fortentwickelnder“, diesen wich-
tigen analytischen Begriff in solcher Verdrehung gebrauchen kann, ist uns
psyehologisch unverstündlich, logisch dagegen ist dies einfach die Folge des
Aufgebens der psychoanalytischen Prinzipien der Verdrüngung und des Un-
bewulten.S.
102 Aus Vereinen und Versammlungen.
pag. 93. „Eine Phantasie im Zustand des Unbewußten existiert“
wirklich nur dann, wenn sie irgend eine nachweisbare Wirkung auf das
Bewußtsein hat, z. B. in Form eines Traumes. Sonst ist sie mit gutem Ge-
wissen als unwirklich zu bezeichnen,“ — Jung muß früher kein so „gutes
Gewissen“ oder eine feinere Empfindlichkeit für die „Phantasien im Zustand
des Unbewußten“ gehabt haben, da er selbst eine Reihe von Komplexmerk-
malen zu eruieren gesucht hat, die die Wirklichkeit des scheinbar unwirk-
lichen Unbewußten demonstrieren sollten, — allen Leuten mit „gutem Gewissen“pag. 132. (hübsch ist auch die Redewendung:) . . . . „die nicht an-
gewendete, sogenannte „verdrängte“ Libido.“ Rai(„Erlaubt nämlich das Individuum bewußt oder unbewuBt, daß die Li-
bido vor einer notwendigen Aufgabe ausweicht, dann verursacht die nicht
angewendete, sogenannte ,verdringte“ Libido allerhand äußere und innere
Zufålle, Symptome jeglicher Art, welche sich dem Individuum in peinlicher
Art aufdrängen.“)Jung nimmt nun, wie wir gesehen haben, dem Freudschen Unbewuften
alles Spezifische, ihm nur die Symbolhaftigkeit lassend, wobei Jung auch den
Begriff des Symbols verändert. Für Freud ist das Symbol ein wohldeter-
miniertes seelisches Phänomen, das mit der Verdrångungslehre steht und fällt;
stellt doch das Symbol nur einen der Wege der Umgehung der Verdringung
oder der Wiederkehr des Verdringten dar. Die Auffassung Jungs dagegen
vom Symbol ist ein Kompromi⑥ aus der nichtanalytischen intellektualistischen
Definition des Symbols als unklares Denken und der Silbererschen ,funktio-
nalen Symbolik.Aber einerseits das UnbewuBte alles bestimmten Inhaltes und aller be-
sonderen Eigenschaften beraubend, verleihen ihm anderseits Jung und die
Seinen eine neue Funktion, seine ,,prospektive Tendenz", die, von den Zü-
richern in den symbolischen Äußerungen des Unbewuften entdeckt, der Zii-
richer årztliches Handeln und dann auch ihr Denken iiber die Neurose ganz
veråndert hat.Wenn die Züricher sich wundern, daß wir das, von dem das analytische
Patientenmaterial angeblich so deutlich rede, nicht auch entdeckt haben, so
können wir unsrerseits nur durch das Staunen antworten, über die bei aller
Versuchung durch den Pragmatismus so große methodologische Naivitit, die
nicht merkt, daß sie nur das wiederfindet, was sie vorher hineingelegt hat.Was aber soll eigentlich diese prospektive Tendenz? An der Konsti-
tuierung der eigentlichen Symptome ist sie nicht beteiligt, diese „inszenieren“
Aktualkonflikt, Regression und Disposition, wie angeborene Empfindlichkeit etc.
(Man sieht, dieser neue Dispositionsbegriff sieht weniger einer Verfeinerung
unserer Ansichten ähnlich, als einem Rückfall in ältere, banale medizinische
Gesichtspunkte.)Eher hat das prospektive, auch teleologisches Unbewufte genannt, die
entgegengesetzte Funktion, es stehe im Dienste der Heilungstendenzen. (Hei-
lung gleich Anpassung.) Es rede deutlich aus manchen Perversionen und be-
sonders aus den Träumen. Riklin sagt り : „Den sadistischen "Tendenzen in
uns ist nun eine neue Bedeutung und verschiedene kulturelle Bewertung ver-
lichen, sie enthalten eine Neigung zur Umwandlung, zum aktiven Opfer.“
Jung sagt?): „Wir können aber wohl mit Recht vermuten, daß unter den
pho RIED xi Betrachtungen zur christlichen Passionsgeschichte. Wissen und?) Jung: Versuch einer Darstellung etc. p. 111.
S.
Aus Vereinen und Versammlungen. 103
subliminalen Materialien des Traumes auch jene Zukunftskombinationen auf-
zufinden wären, die darum subliminal sind, weil sie noch nicht den bewuBt-
seinsfähigen Deutlichkeitsgrad erreicht haben.“ Nur infolge unserer bisherigen
einseitig historischen Untersuchungsweise handeln die Träume von Vergangen-
heitswiinschen, während sie den Ziirichern von symbolischen Intentionen der
vorausschauenden Sehnsucht erzählen (wobei auf irgend eine Weise aus dem
Vorausschauen sogleich ein Hinaufschauen wird !)Wie aber diese Symbolsprache verstehen? All dieses Intendieren und
Vorausschauen bliebe ganz vag und leer, wenn es nicht gelinge, das Inten-
dierte, Vorausgewollte irgendwo als teilweise realisiert oder wenigstens klarer
ausgezeichnet anzutreffen,In individuellen Seelenabläufen ist dies nicht anzutreffen, man mußte
deshalb vom Individuum weit weggehen; und in der Geschichte der Moral
und der Religion, besonders in der Mythologie, fanden sie die Realisierungen,
in denen sie die angeblichen Intentionen des individuellen Unbewußten deutend
spiegeln, Die typischen Symbole des neuen, d. h. prospektiven Unbewußten
lernt man also nicht bei der Psyche der Kranken, sondern bei der Mythologie.Riklin!) sagt in seinem apologetischen Votum: , Das mythologische
Material ist und muB auch analytisch so wahr sein wie das rezente Denk-
material unserer Patienten,“Was heißt das „analytisch so wahr“? Wenn das heißen soll: für die
Analyse wahr, so ist der Riklinsche Satz falsch und beleuchtet grell den me-
thodischen Irrtum der Züricher. Mythologische Wahrheiten sind eben mytho-
logische Wahrheiten, für die Psychologie sind sie keine Wahrheiten, keine
Irrtümer, sind sie gar nicht vorhanden. (Hilfen für die analytischen Ge-
dankenginge können mythologische und andere, ähnlich komplexe Tatbestands-
gruppen per analogiam erst dann werden, wenn vorher unter psychoanalyti-
schen Gesichtspunkten Erkenntnisse unter ihnen zu stande kommen. Sehr fein
hat Ferenczi darauf hingewiesen, daß Jung nur darum mit einigem schein-
baren Erfolg die Mythologie auf die Psychoanalyse anwenden kann, weil das
schon psychoanalytisch bearbeitete Mythologie ist.)Also ist mythologisches Material für die Psychoanalyse nicht so „wahr“,
wie das rezente Assoziationsmaterial unserer Patienten, und lassen sich 8
mythologischem Material keine psychologischen Wahrheiten gewinnen, we-
nigstens nicht fiir eine psychologische Psychoanalyse.Also aus tiberindividuellen, kulturentwickelungsgeschichtlichen Zusammen-
hängen holte man die Typik der Symbole des prospektiven Unbewußten, Religions-
geschichtliche und mythologische Einflüsse wandelten den heidnischen Odipus-
komplex in christliche Wiedergeburtssymbolik um, Aus den Kastrationskomplex-
und den sadomasochistischen Komplexzeichen wurde die Opfersymbolik. (Aus
dem Umstand, daß in der Geschichte asketische Ideale sich zu ihren Äuße-
rungen der Partialtriebe bedienten, schließt man nun leicht, daß die Partial-
triebe Sadismus und Masochismus, wo sie in den Phantasien der Kranken
auftreten, jene Ideale bedeuten sollen.)Bringt man nun obige Symbolik in der Analyse an das konkrete Einzel-
individuum heran, so müssen sie ibm als Mahnungen, ideale Forderungen,
als ein Sollen klingen, womit die Psychoanalyse unrettbar in ihrem Wesen
und ihren Zielen in eine ethisierende Psychagogik umgebogen wird. Hier be-
kommt das angeblich Neue der „finalen Orientierung“ seinen Sinn. Final ist
natürlich auch das „Lustsuchen* des Unbewuften der älteren Anschauung :1) Riklin: Internat, Zeitschrift f. ärztl. Psychoanalyse. I. p. 622 ff,
S.
104 Aus Vereinen und Versammlungen,
hier aber handelt es sich um die Zweckhaftigkeit des y Wertsuchens“. Dar-
über hilft nicht hinweg, daß die Ziiricher sich selbst, die Patienten und uns
glauben machen wollen, sie hörten diese neuen Weisen aus dem analytischen
Material heraus. àEbenso wenig helfen da alle optimistischen Litaneien über das „radikal
Gute'* der menschlichen Natur. Predigen sie dem Patienten: Werde, der Du
bist, so ist das kein Erziehen zum Mut zu sich selbst durch Erkenntnis,
sondern ein Hinaufzwingenwollien zum Wert, wenn man dazu fortwührend
hinzufügt: Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Die Predigt
des Opfers läuft auf die Forderung, das Drängen zur Sublimierung hinaus.
Also ein Postulat statt eines Weges, — das ist der Gewinn !Und wenn Jung und die Seinen gerade in dem Augenblick, wo sie dem
psychoanalytischen Instrumente seine so fruchtbar schneidende Schärfe zu
nehmen im Begriff sind, dekretieren: „Die Psychoanalyse soll eine biologische
(warum biologische? Ref.) Methode sein, welche das höchste subjektive
Wohlbefinden mit der wertvollsten biologischen (warum wieder biologisch?er meint hier doch kulturell . . Ref.) Leistung zu vereinigen sucht“, so ist
auch das nur fromme Predigt unbesonnenen Schöpferdranges, der zuviel
verspricht.Wie heroisch schlicht und erschütternd ernst dagegen lautete die Formel
Freuds: „Es ist schon viel damit gewonnen, wenn es gelingt, der Patienten
hysterisches Elend in gemeines Unglück zu verwandeln,“Zum Schluß ist noch ein Doppelanspruch Jungs zurückzuweisen, seine
Behauptung, zwei neue Momente in den Entwicklungsgang der psychoanaly-
tischen Theorie hineingebracht zu haben: die genetische Auffassung der Li-
bido und die finale Orientierung des Psychischen. Daß sich letztere auch schon
bei Freud findet, muß Jung selbst zugeben (p. 71), und als dynamisch-gene-
tische!), oder besser noch ontogenetische, haben auch wir von jeher unsere
Libidoauffassung genannt, die so vieles Psychische sich aus der Libido heraus
entwickeln läßt. Bei Freud handelt es sich aber um Genese und Finalität
innerhalb des Rahmens des menschlichen Individuums als des Substrates aller
Psychologie. Der Psychologe Jung dagegen hat die Grenzen des Reiches der
Psychologie zweimal überschritten: einmal nach unten in die Biologie hinein,
und dann nach oben in die Ethik. An Stelle einer Psychologie ist da nun
eine biologisch-ethische Kulturphilosophic getreten; das Doppelsubjekt dieser
ist die Art Mensch und das Kulturphänomen Menschheit. Und dementspre-
chend ist das Objekt der neuen psychoanalytischen Behandlung nicht eigentlich
mehr der einzelne Kranke, der von seinen Hemmungen befreit, sich nach
bestem Können und Vermögen den Aktualforderungen anzupassen hat. sondern
es ist quasi die Kultur selbst, die in diesem ihrem kranken Gliede eingerenkt,
gefördert, gesteigert werden soll. Sagt doch Riklin am Schlusse seines Votums,
er betrachte es als ein großes Verdienst Jungs, durch seine neuen Arbeiten die
Psychoanalyse vor allem in den Dienst der Kulturentwicklung gestellt zu
haben. Wir hielten es für unsere Aufgabe, kranke menschliche Individuen zu
heilen, nun erfahren wir, daß alle Individualformulierung des Unbewußten zu-
fällige Alltagsgestaltung sei und das Individuum selbst ein Epiphänomen. (Riklin.)Wohin führt diese Psychagogik ?
3) Vgl. unter außenstehenden Kritik sø å i
dod Me TR 4 ה en Kritikern M. Scheler: Zur Phünomenologie der
Über das Ubw. bei Jung und seine Wendung ins Ethische
InternationaleZeitschriftFuumlrPsychoanalyseIi.Band1914Heft1
99
–104