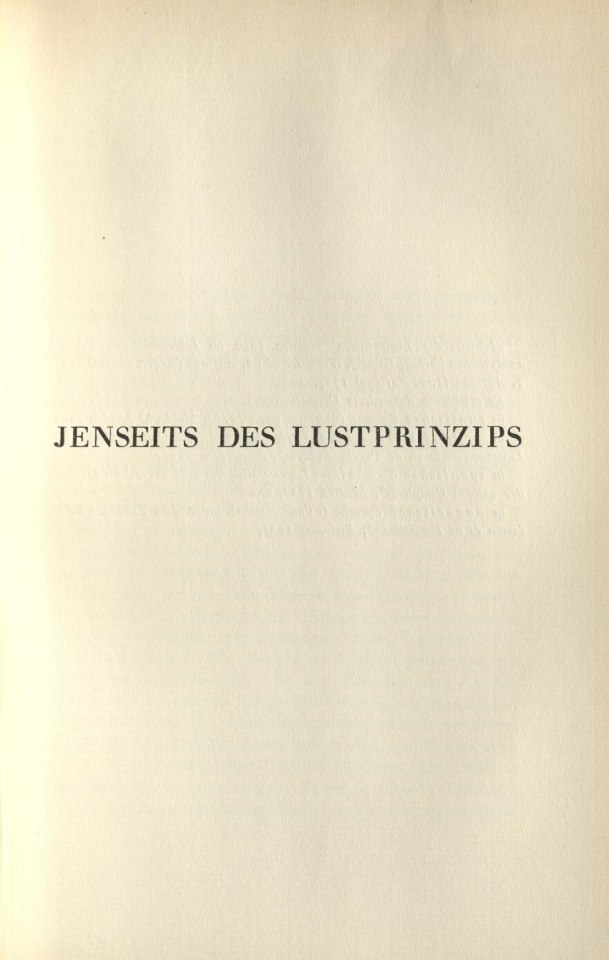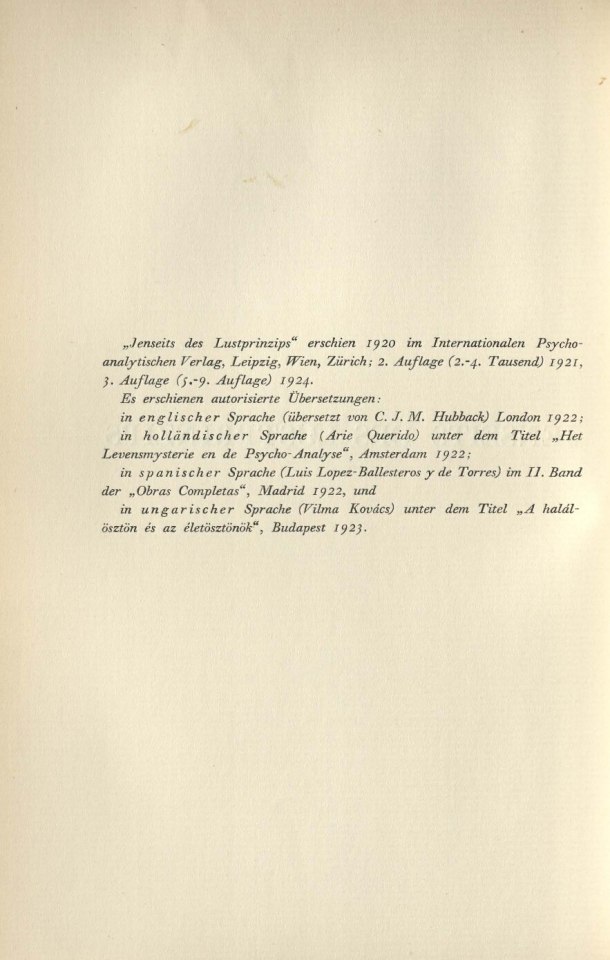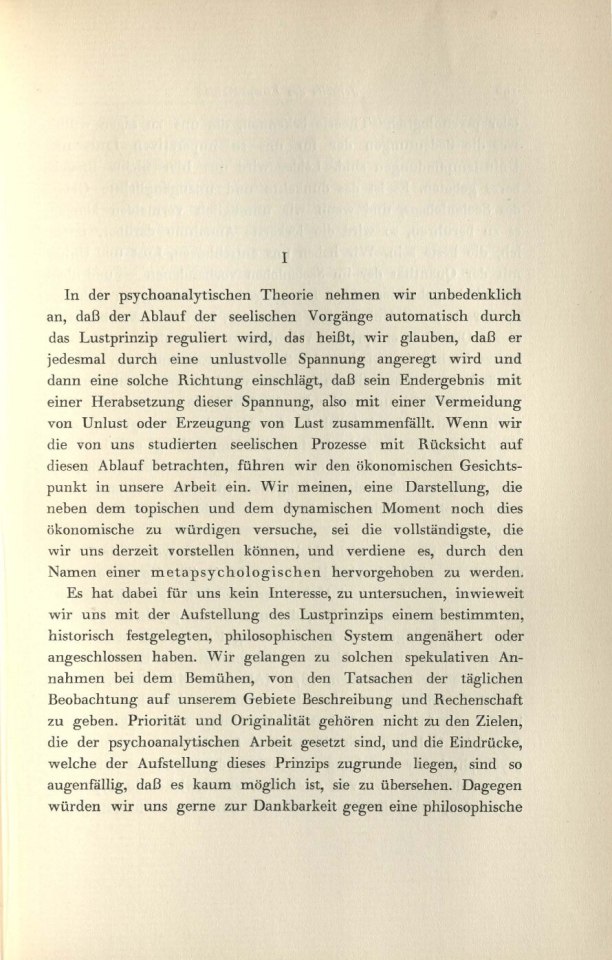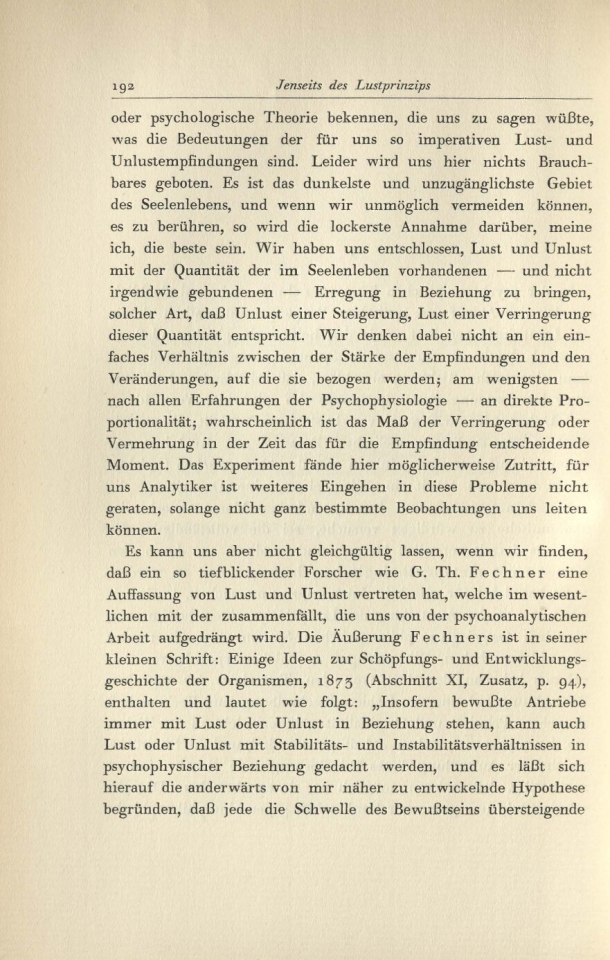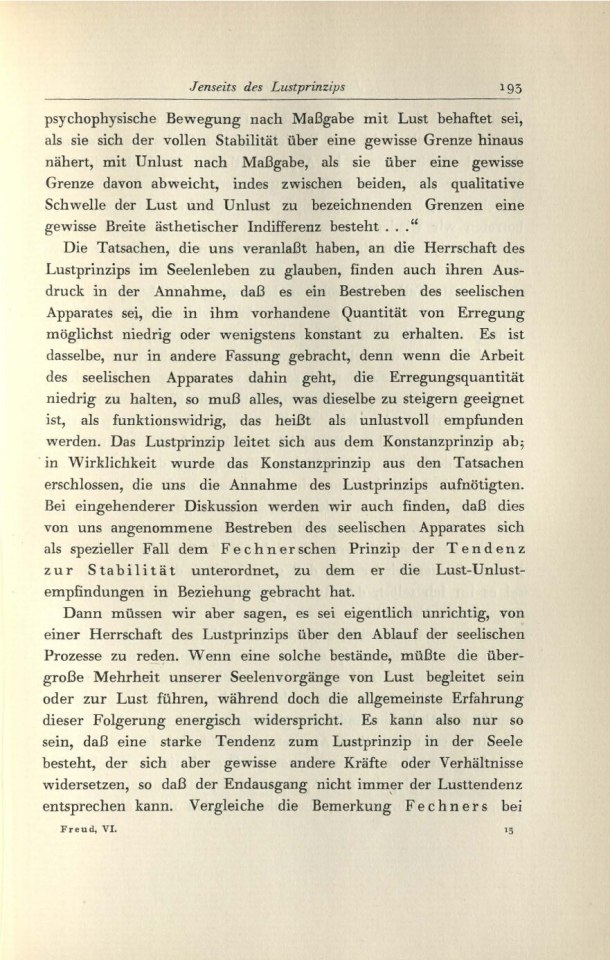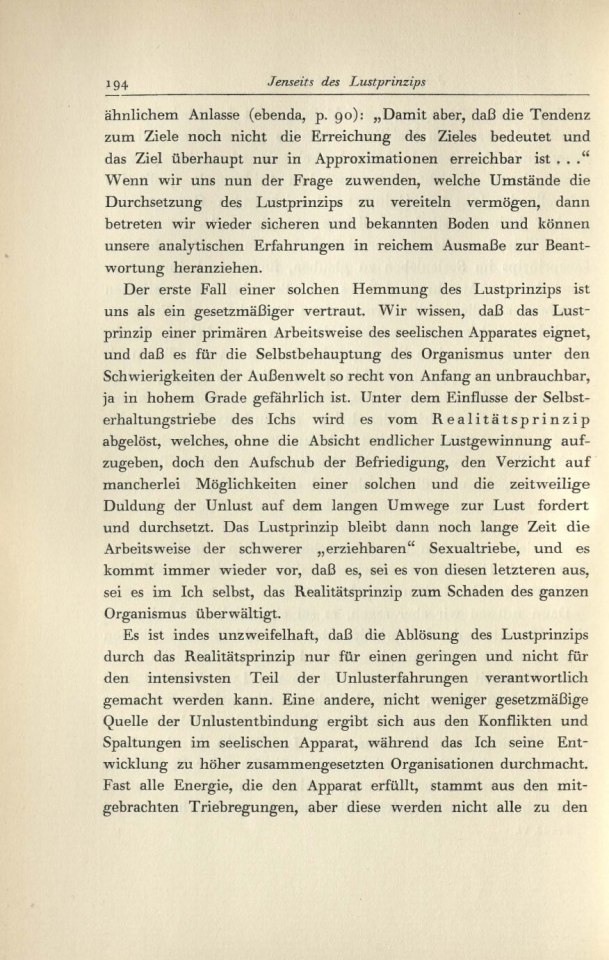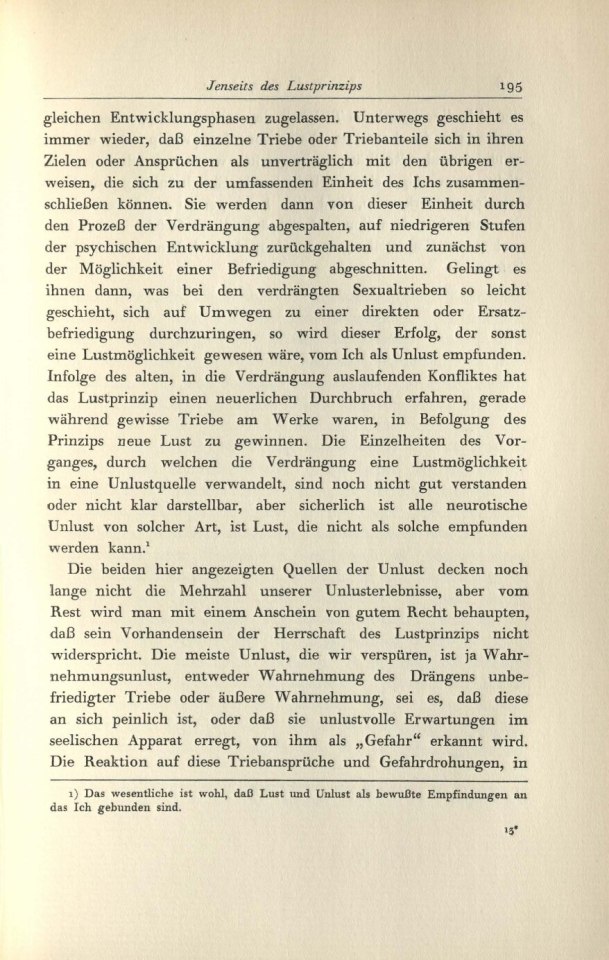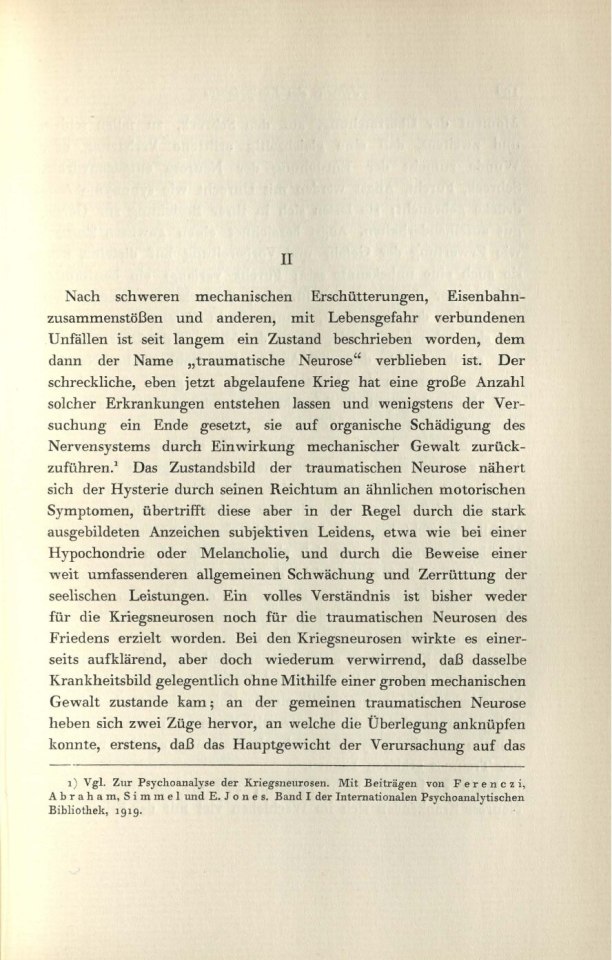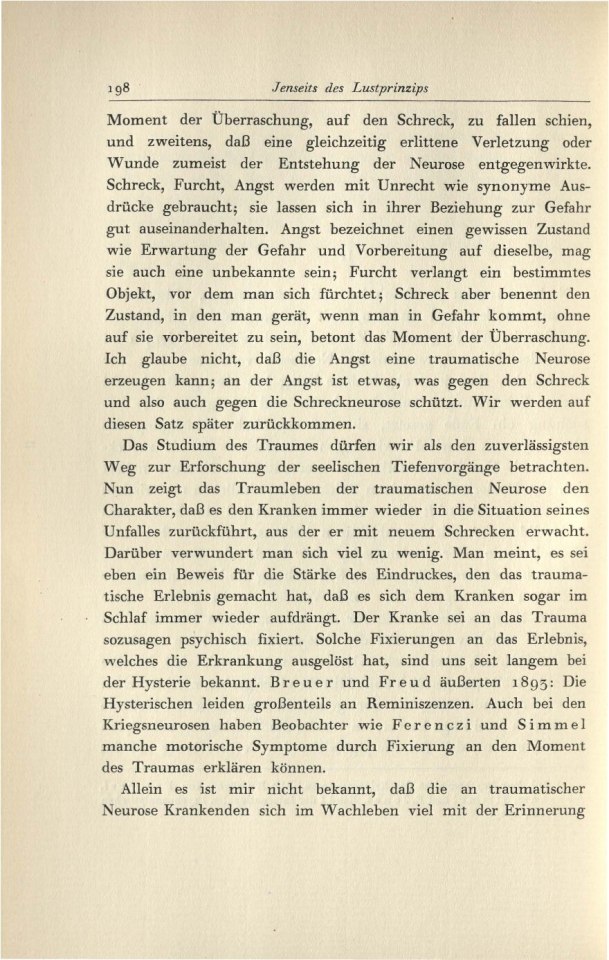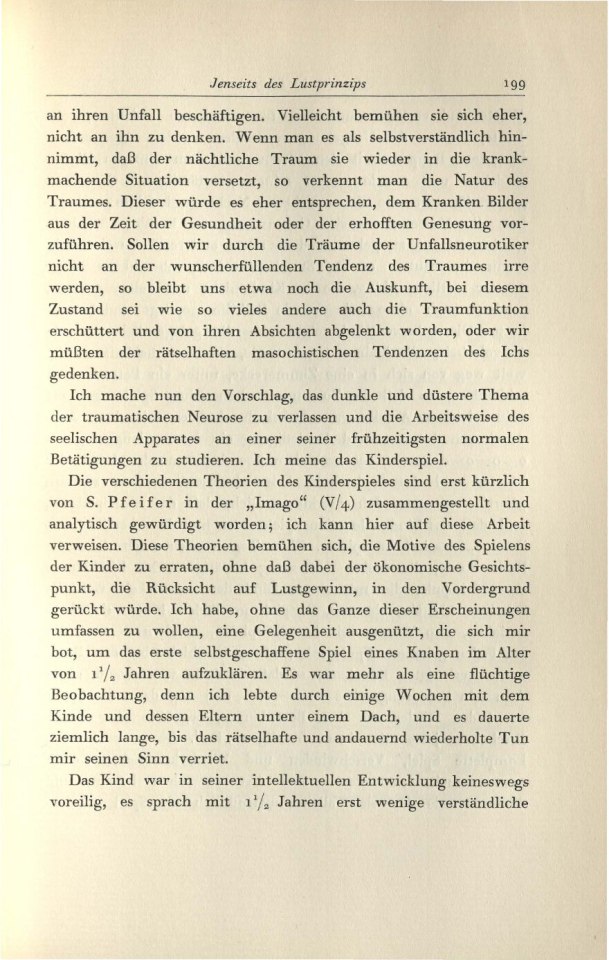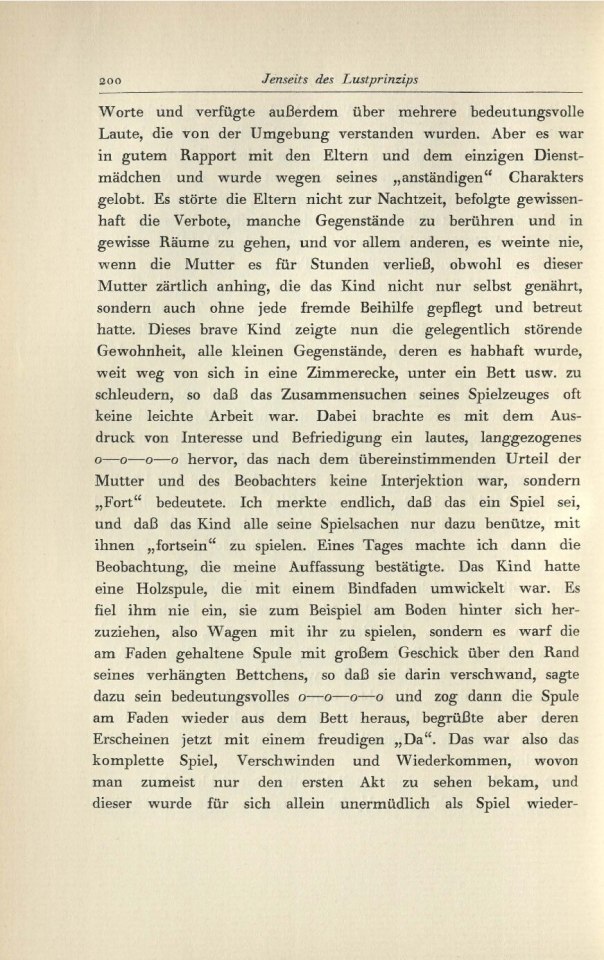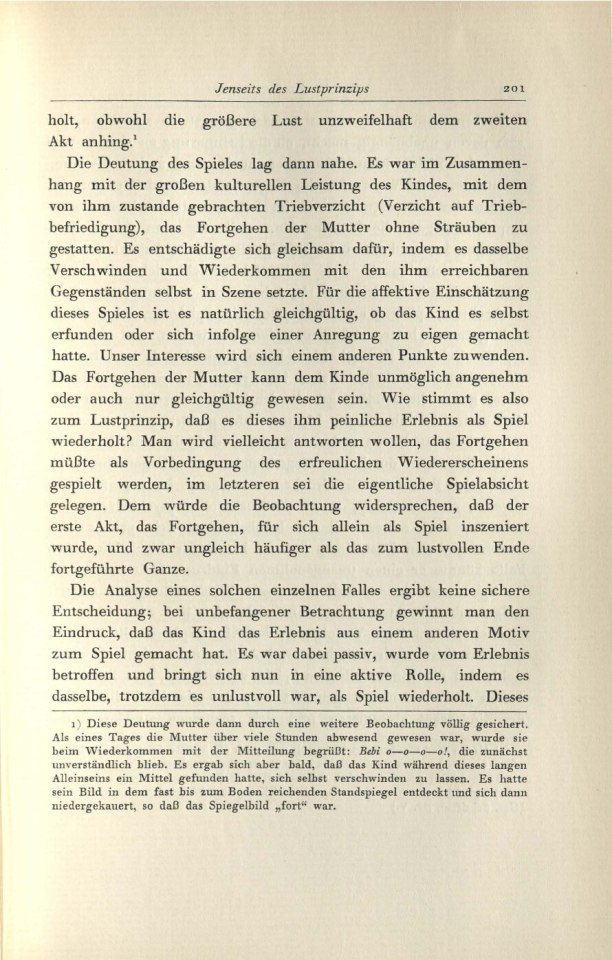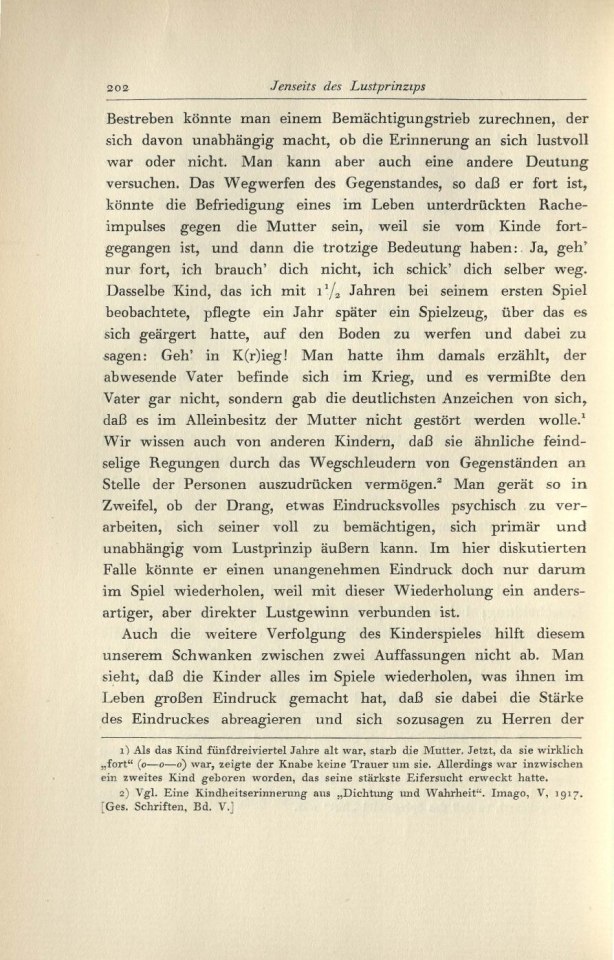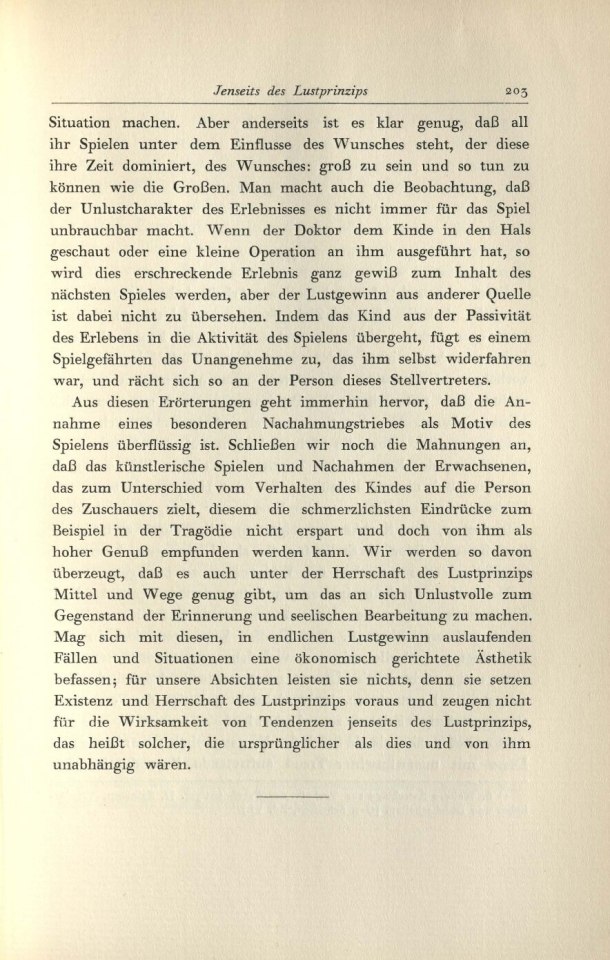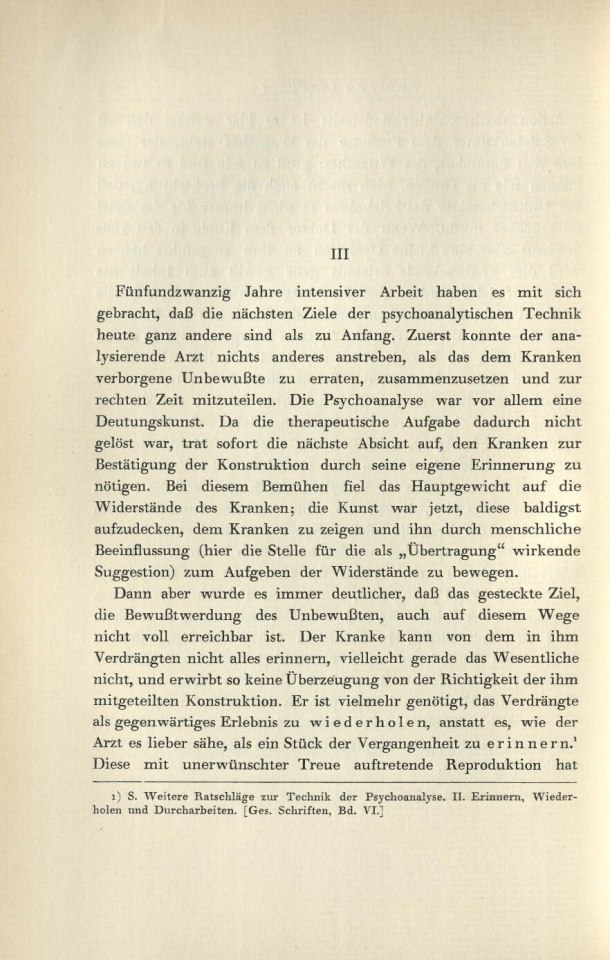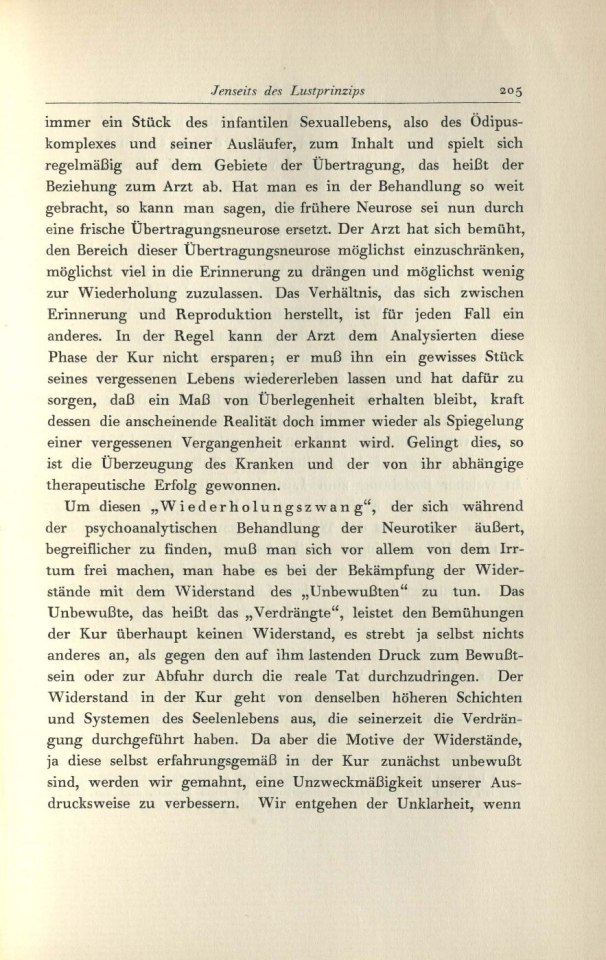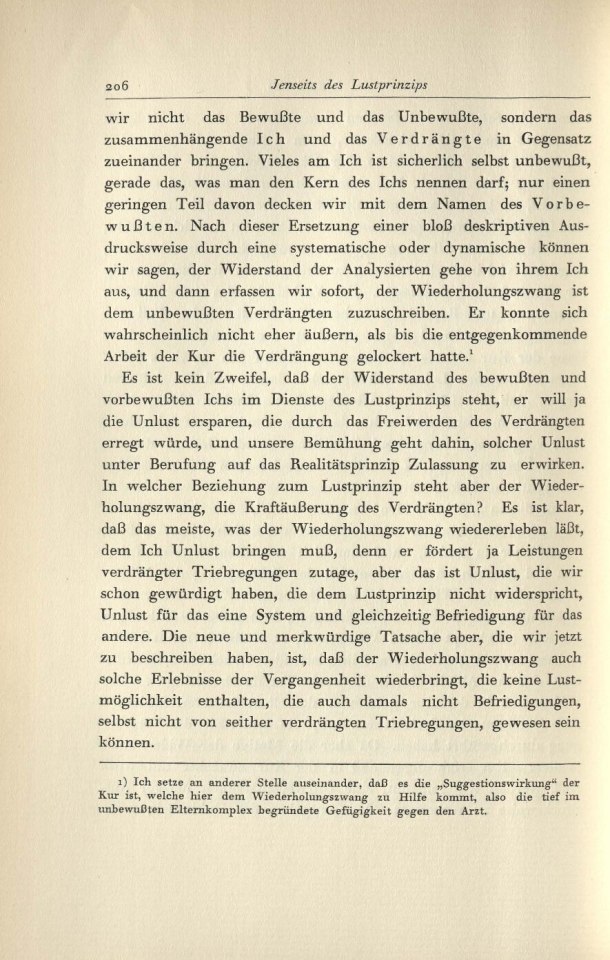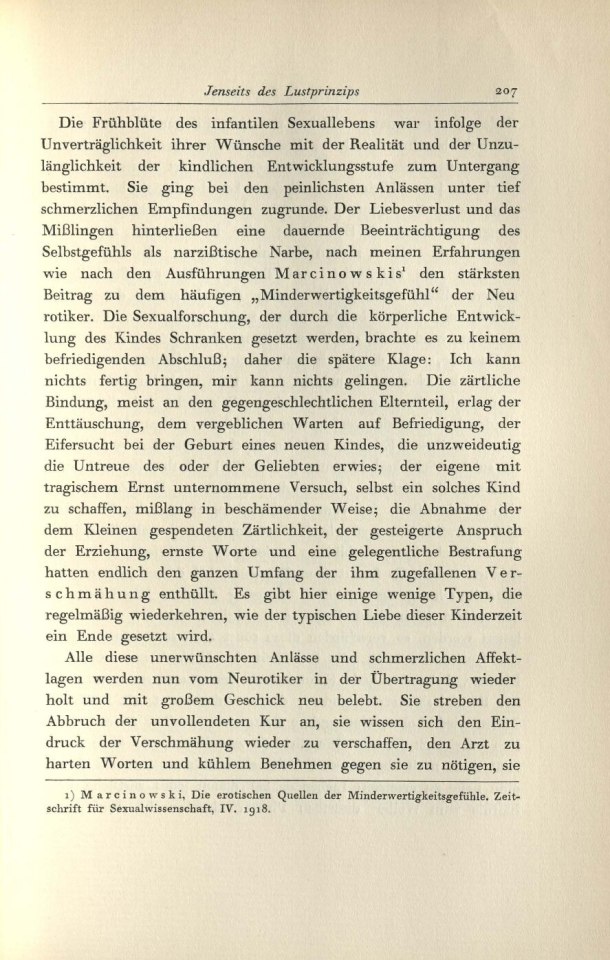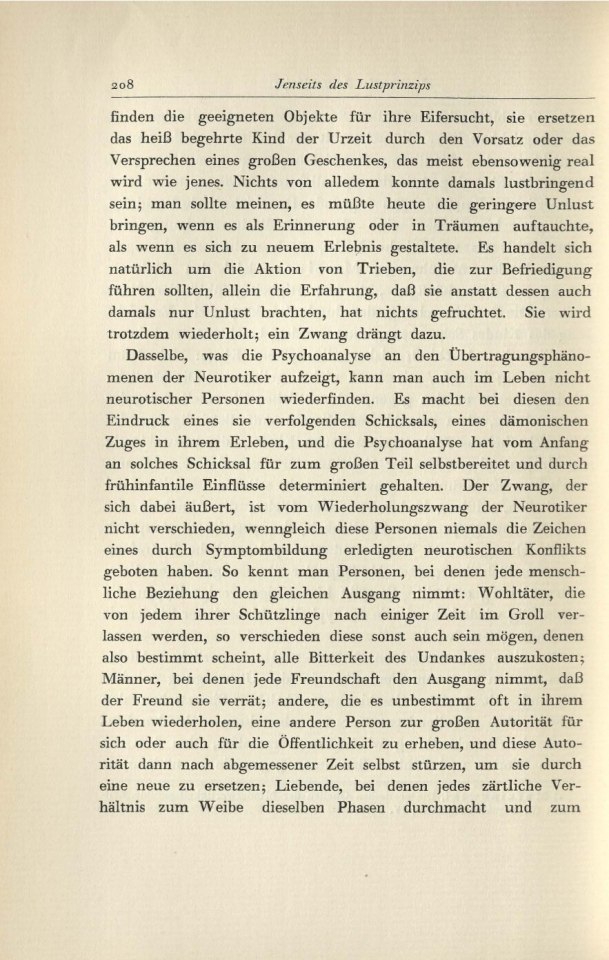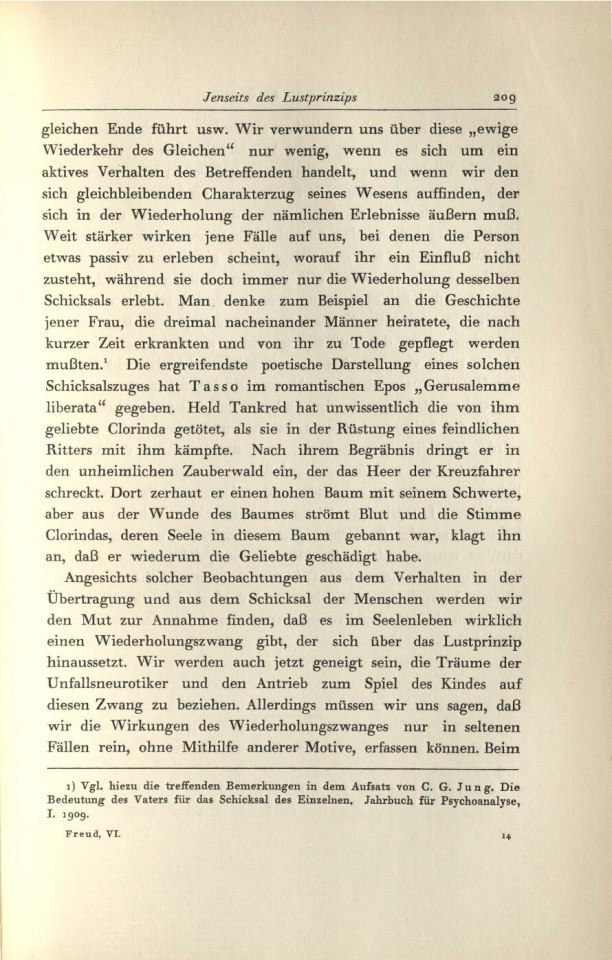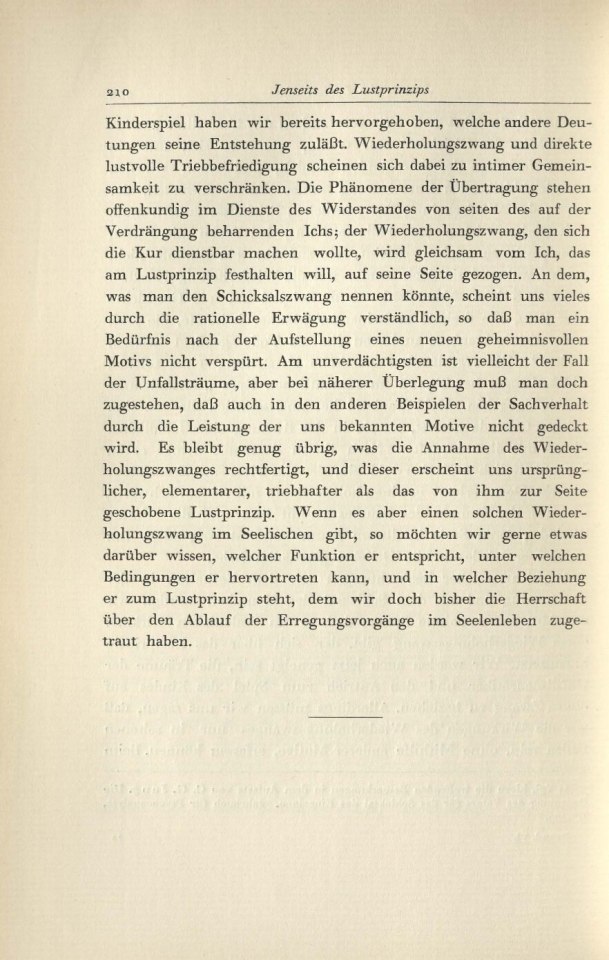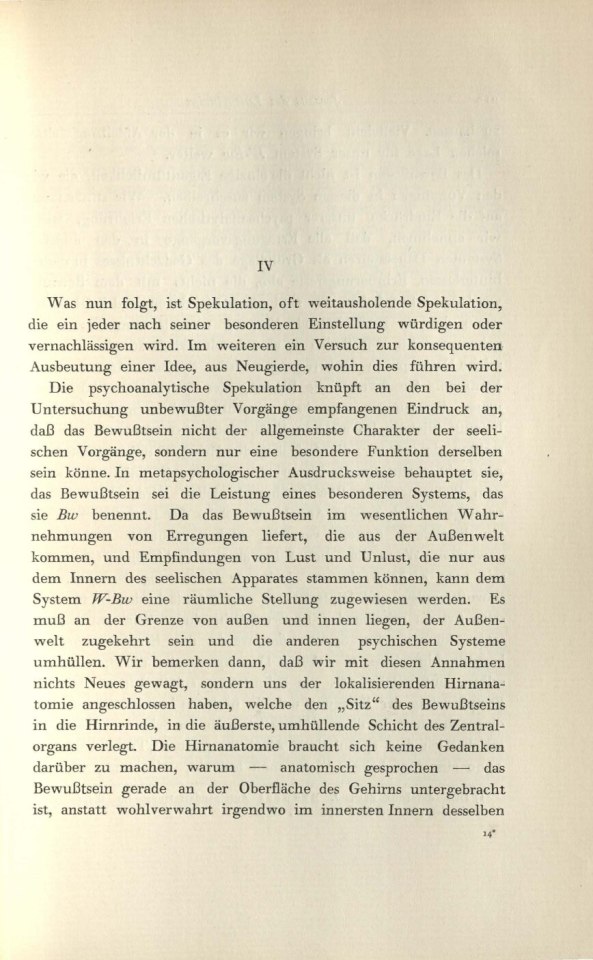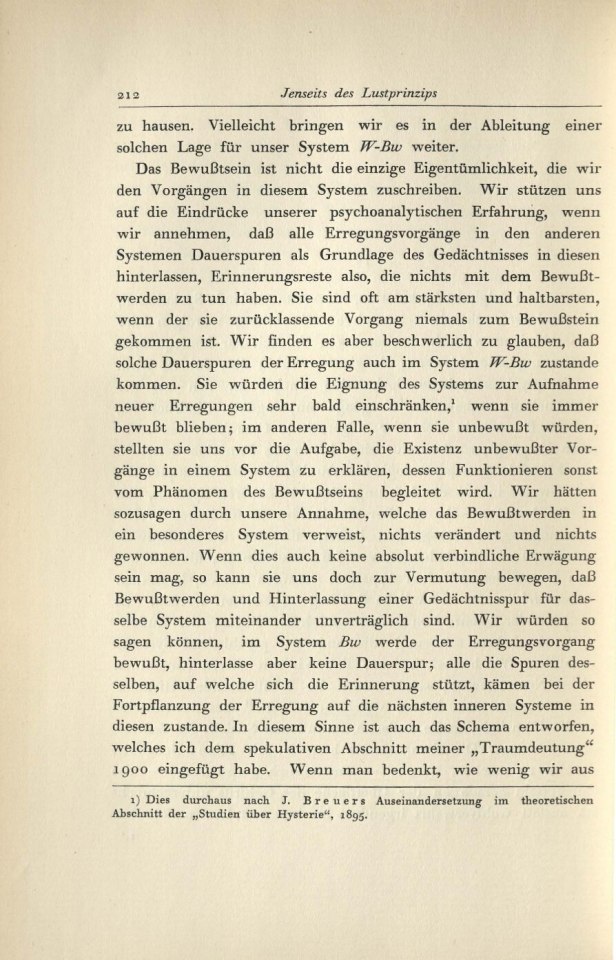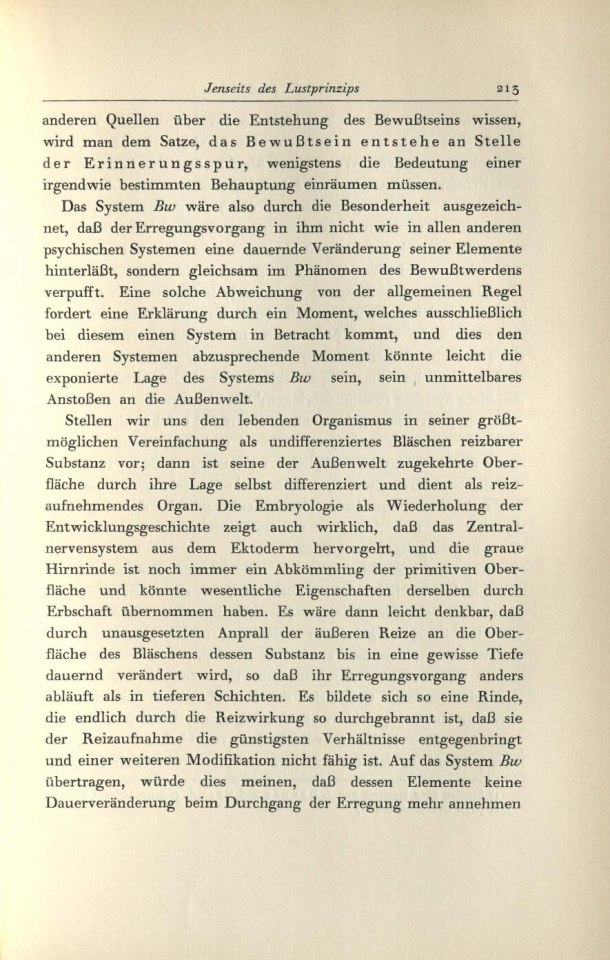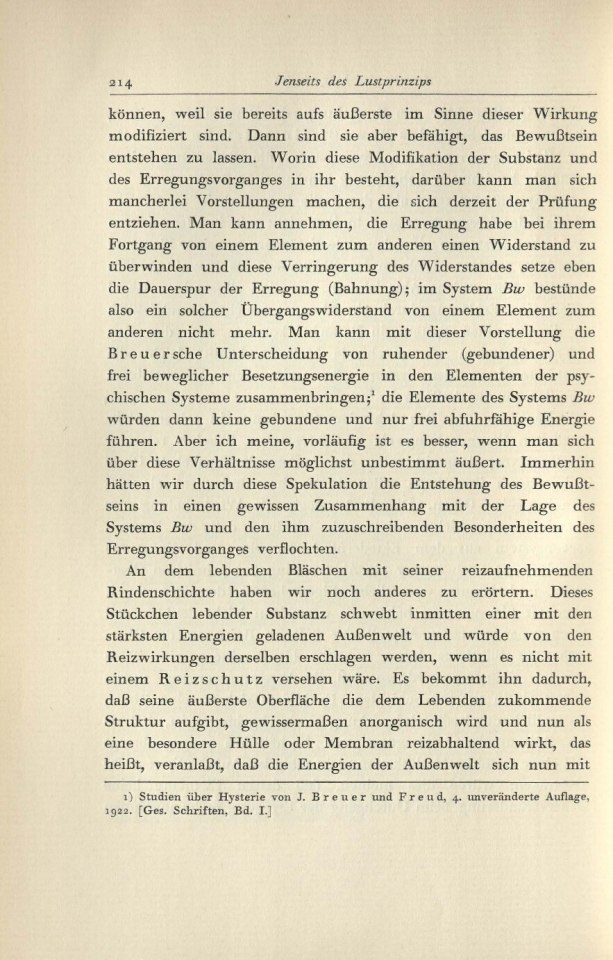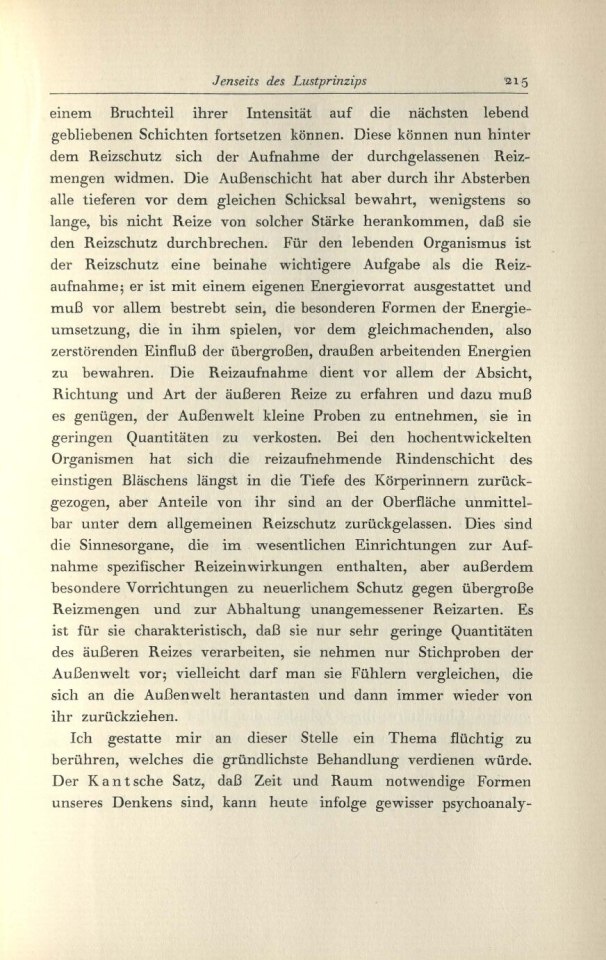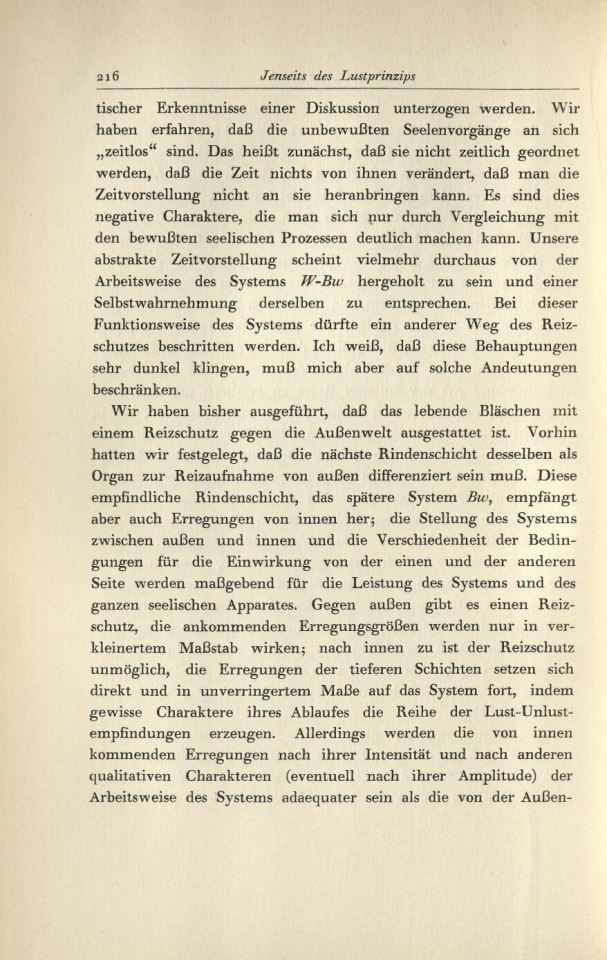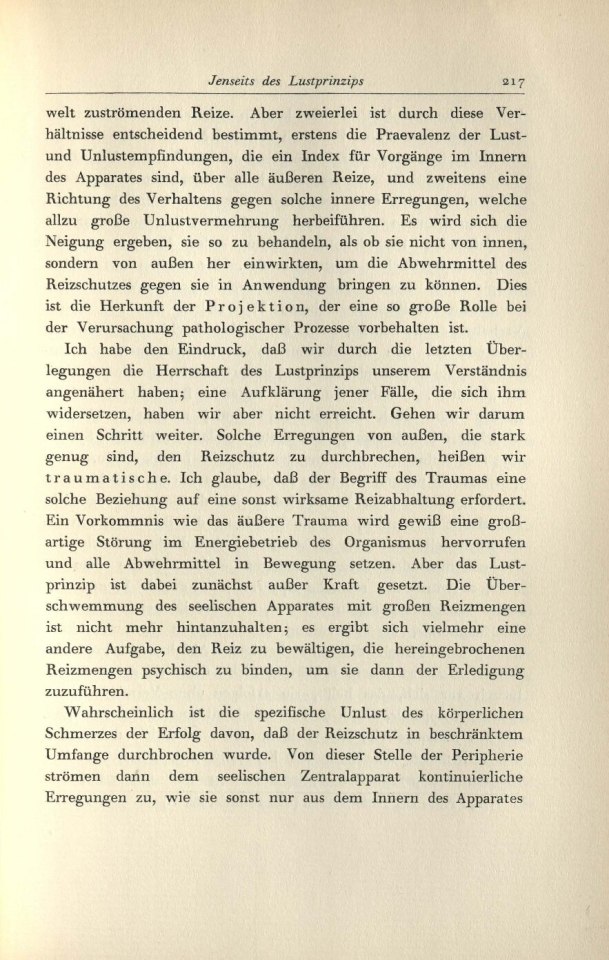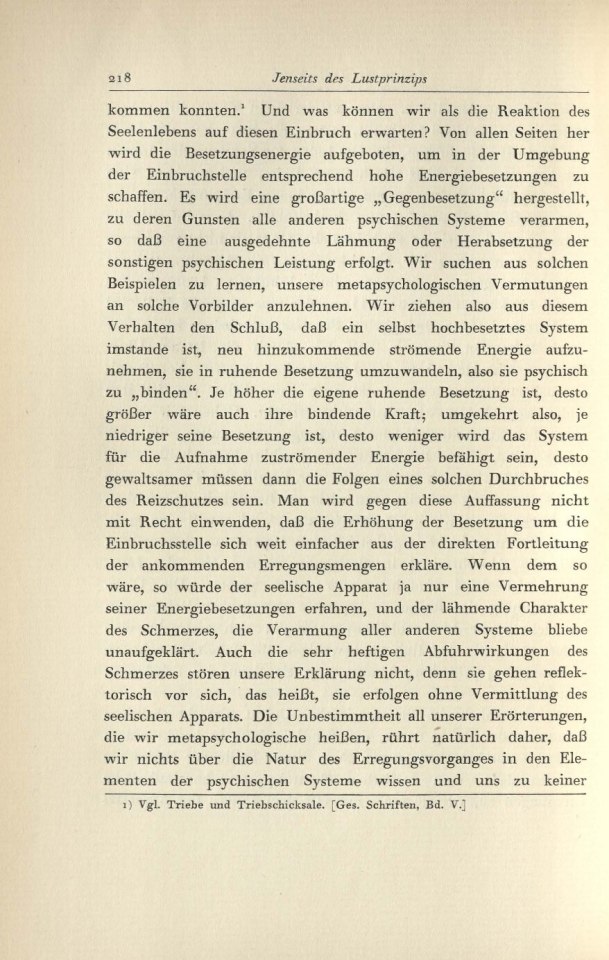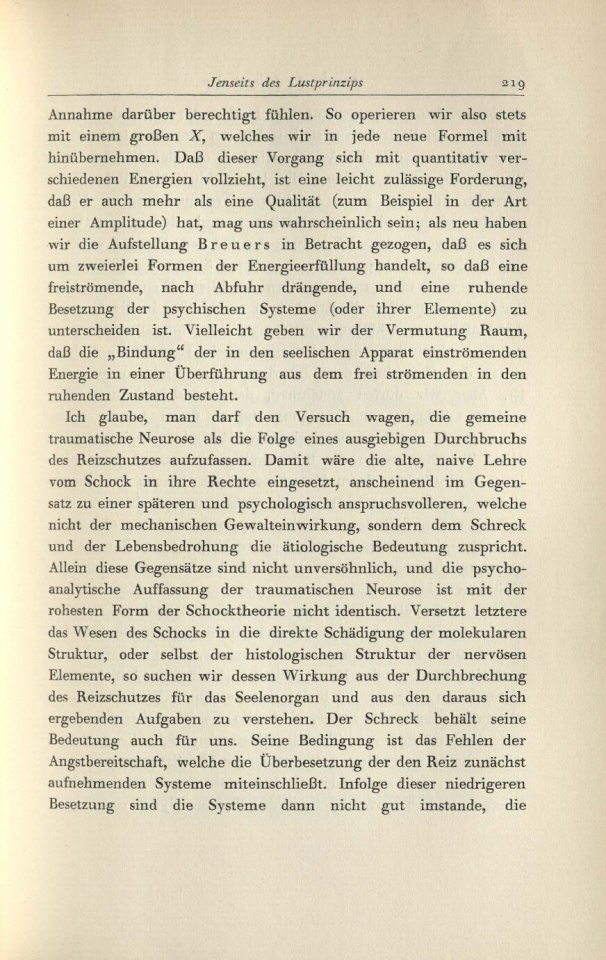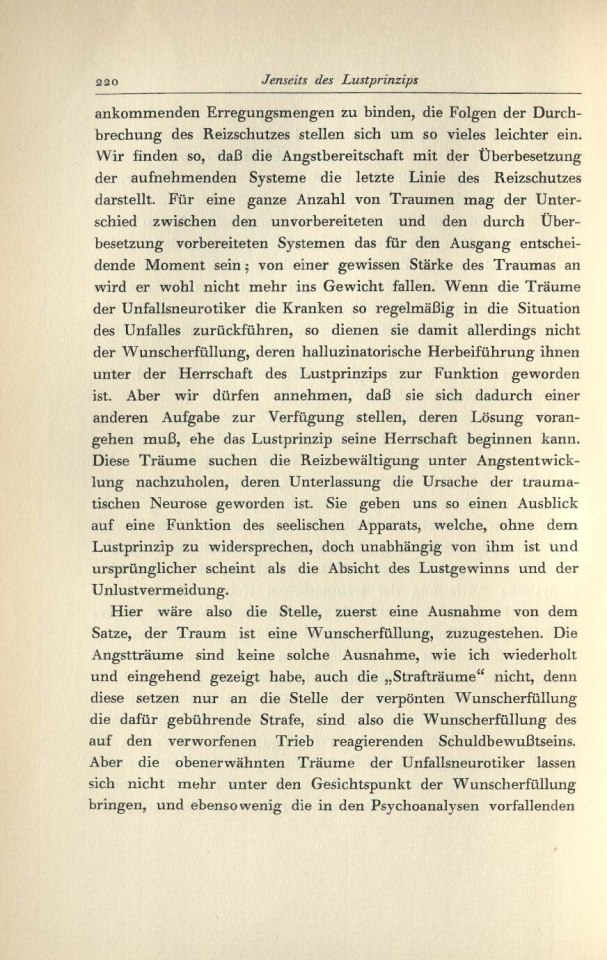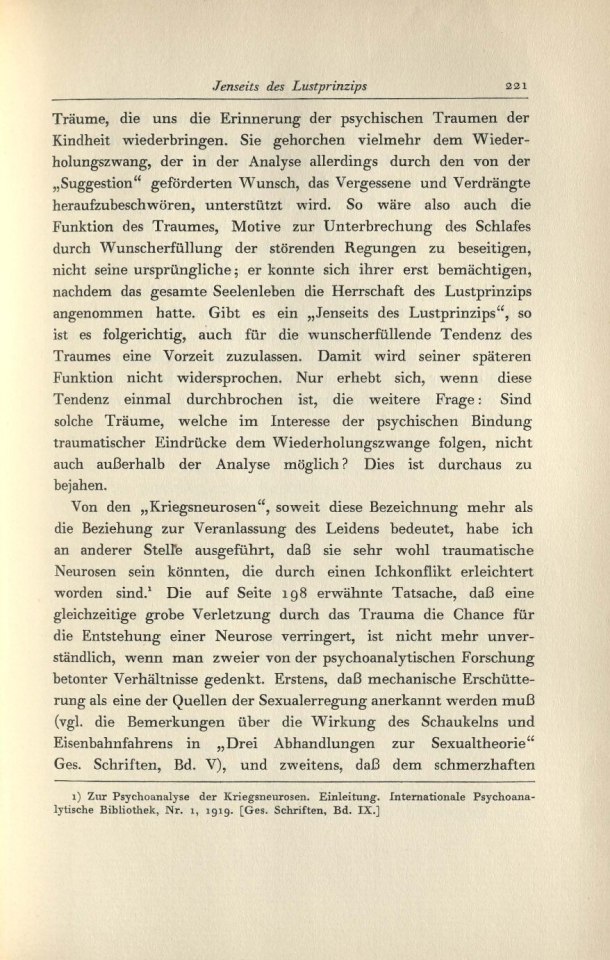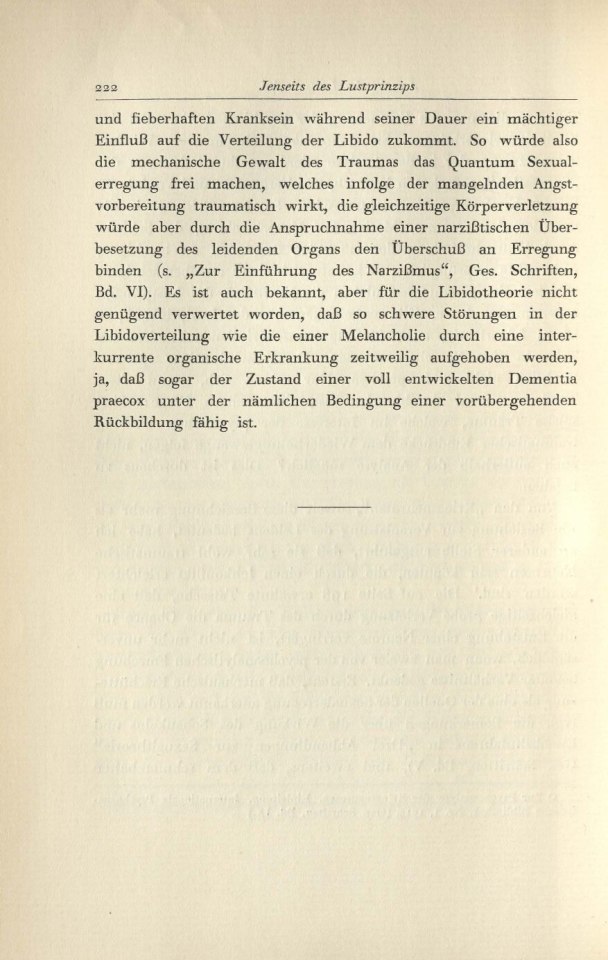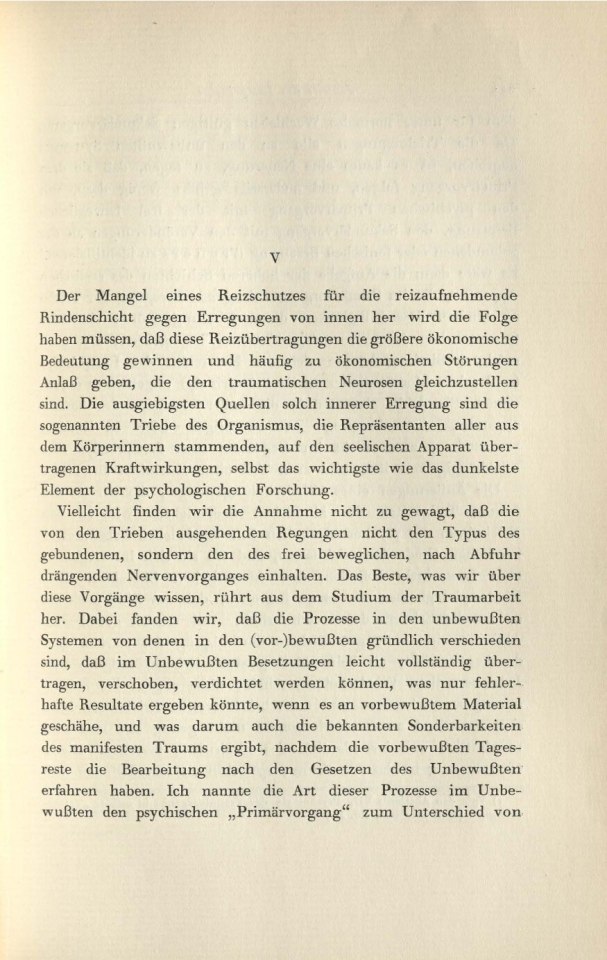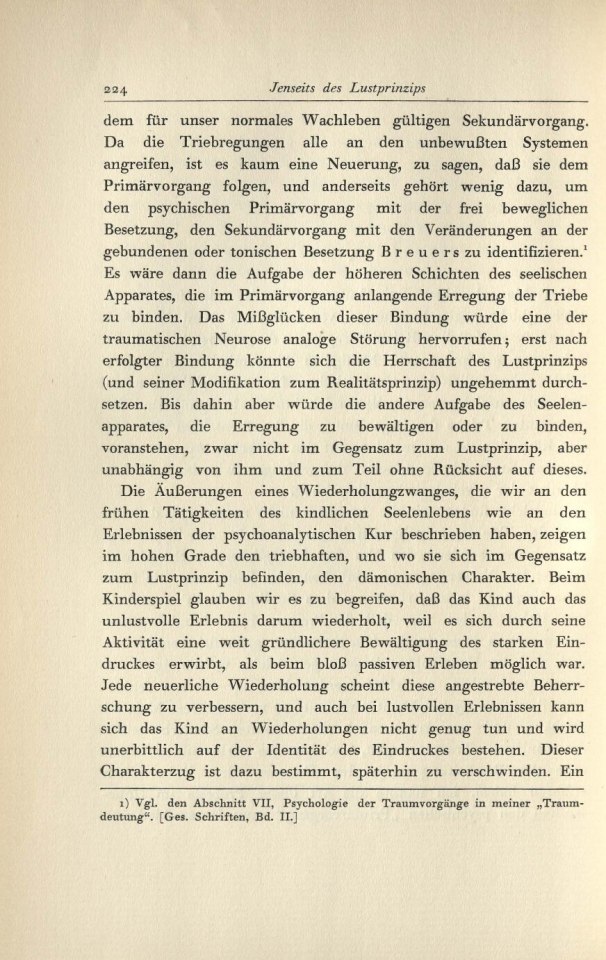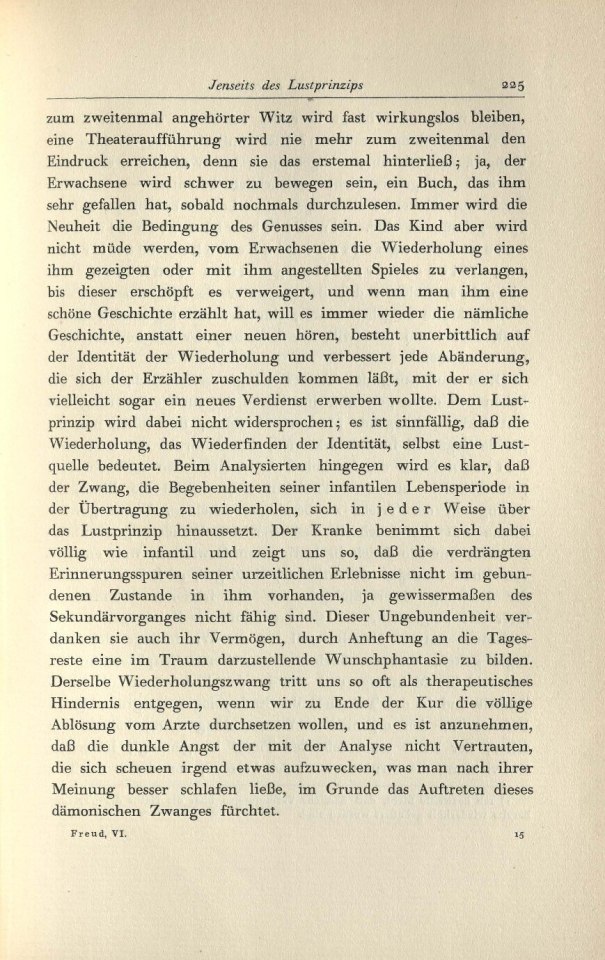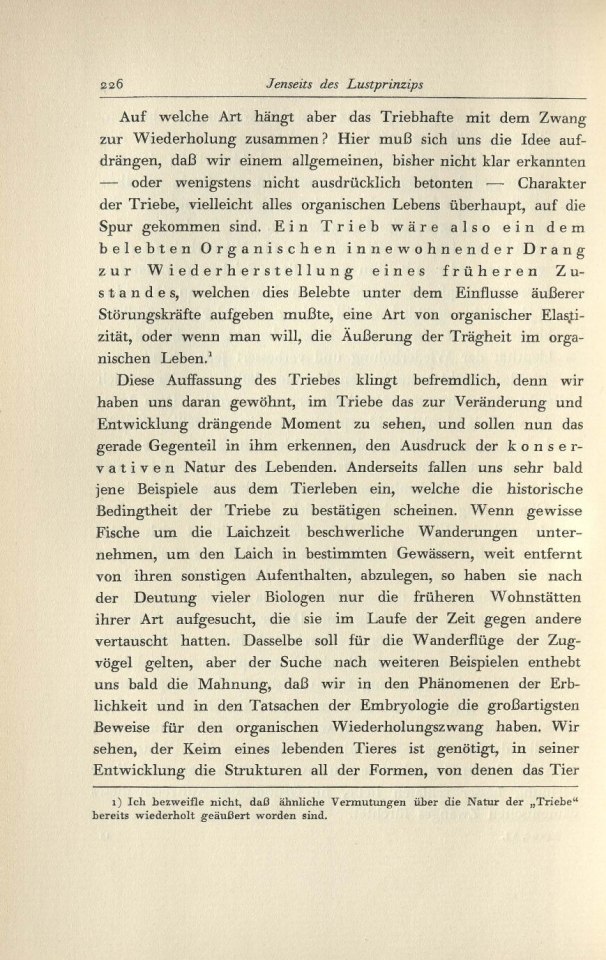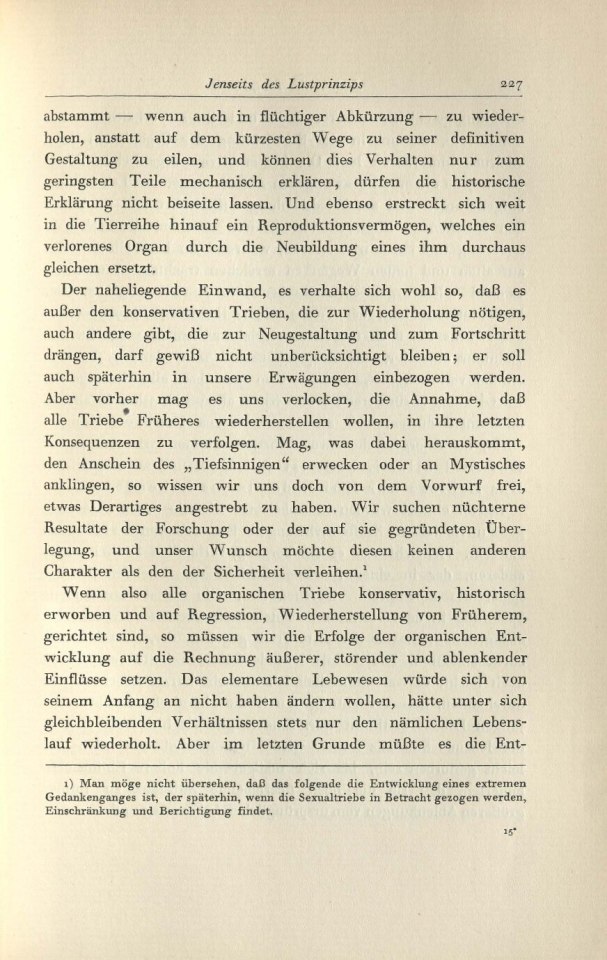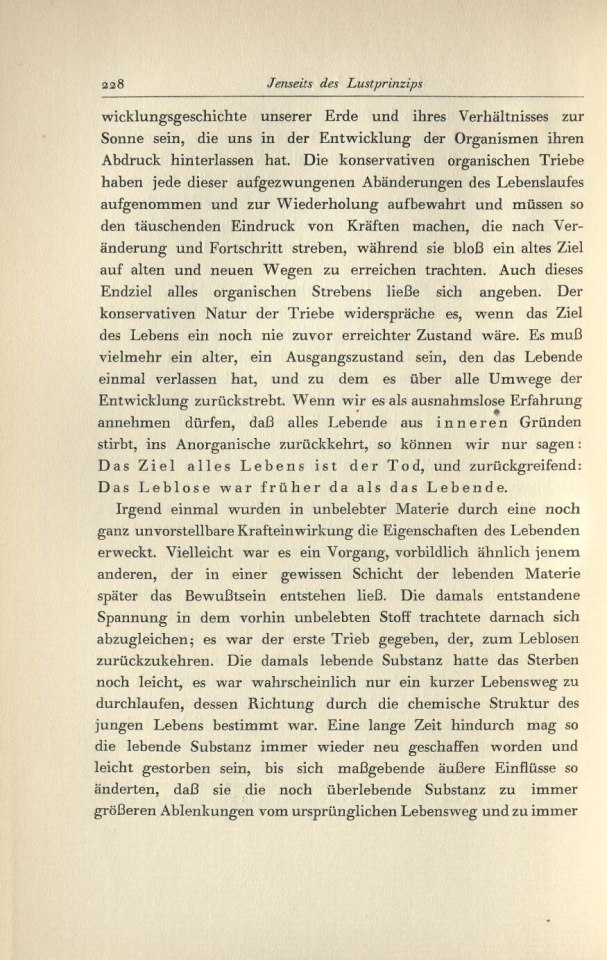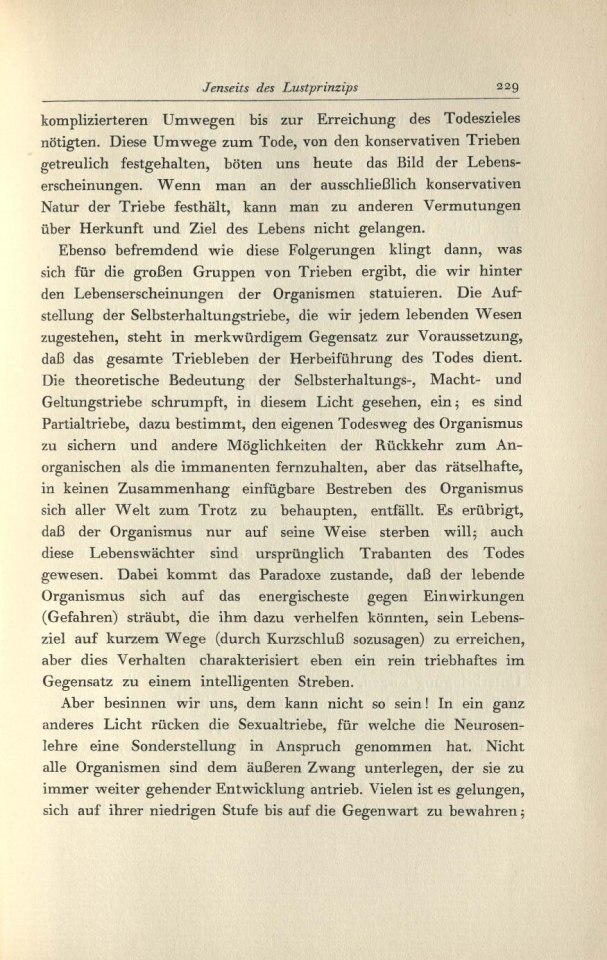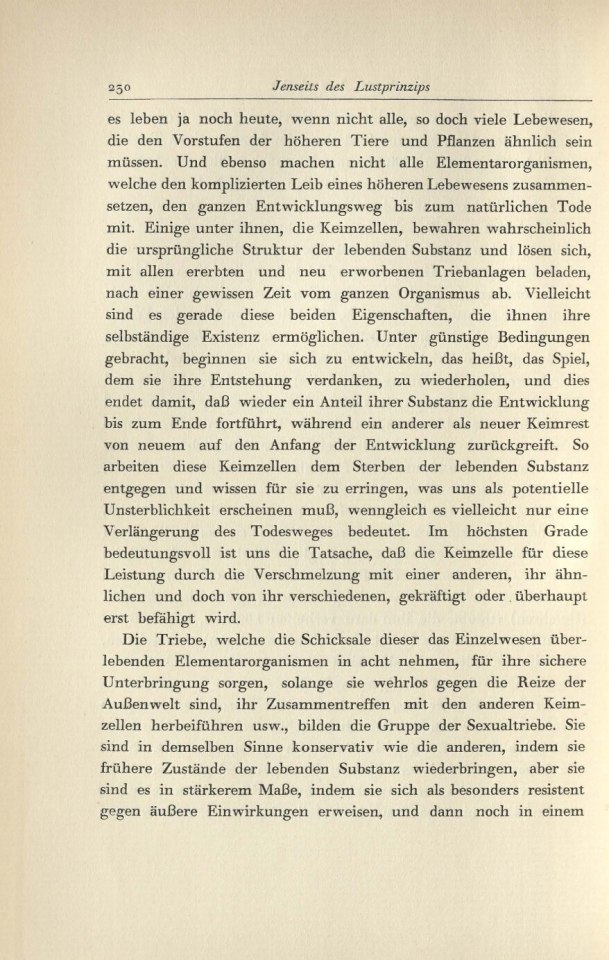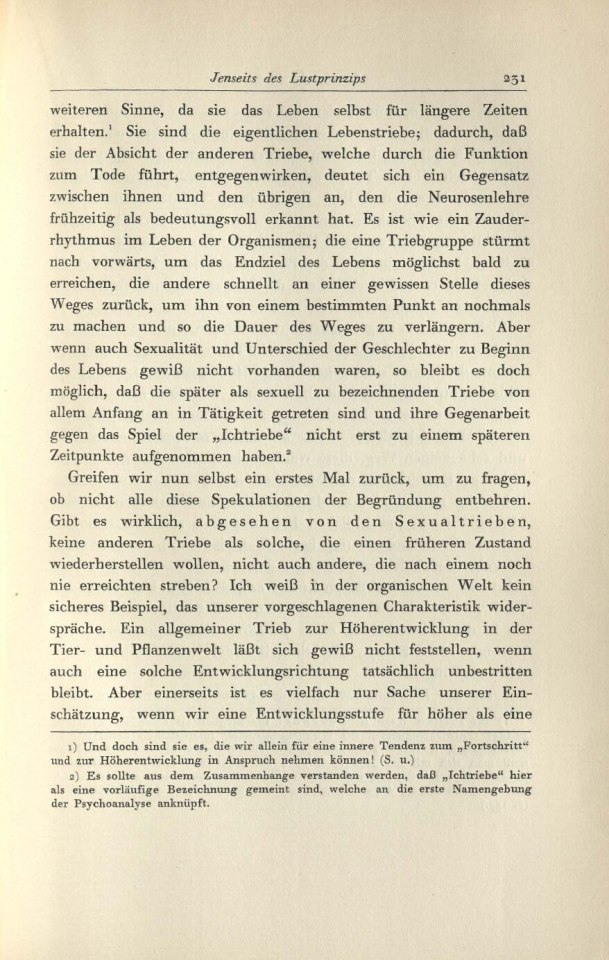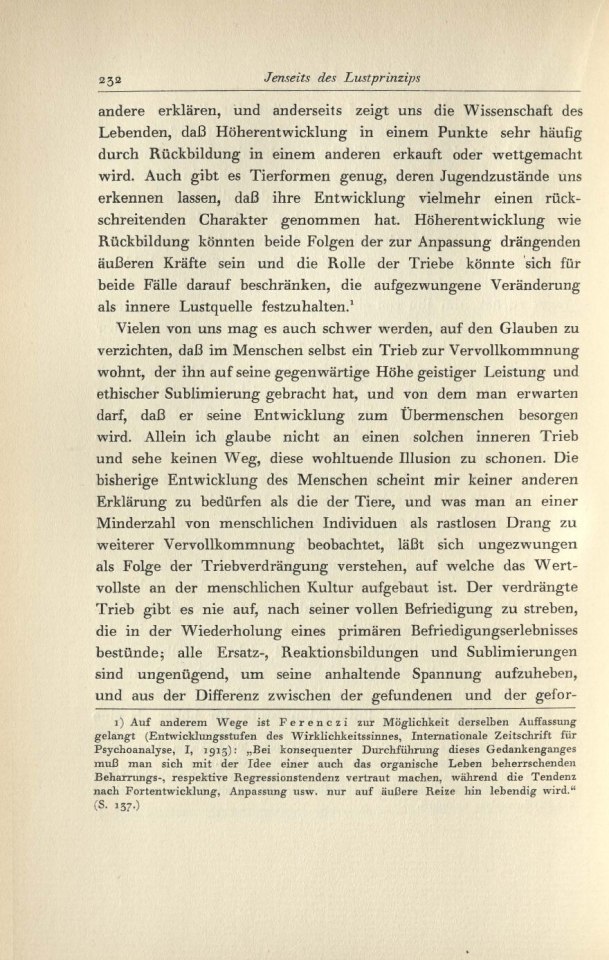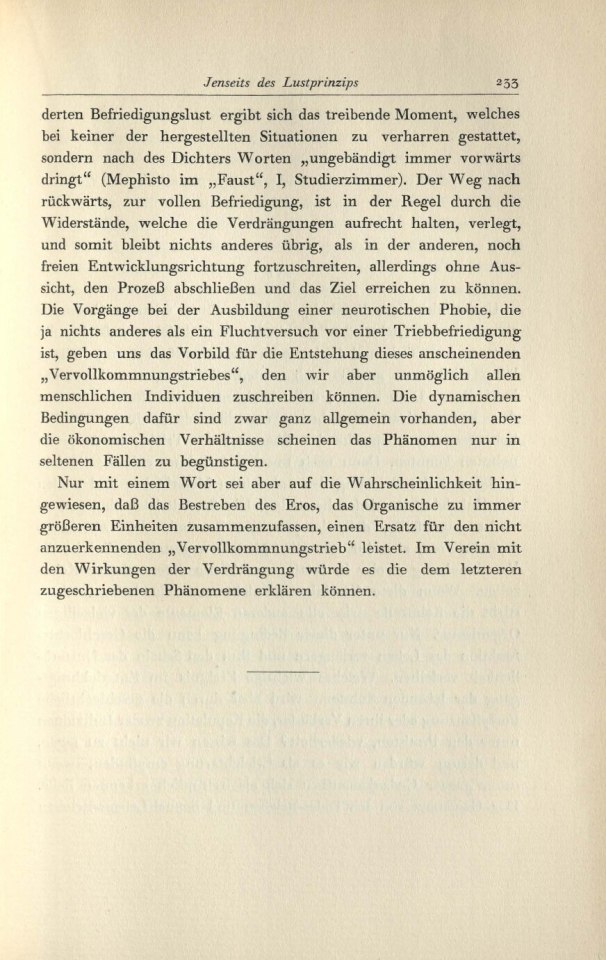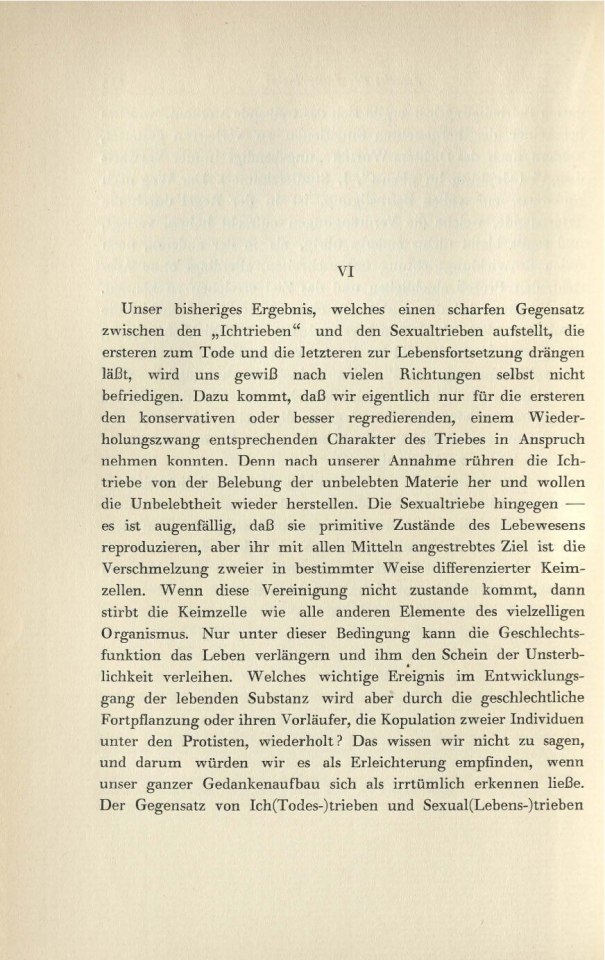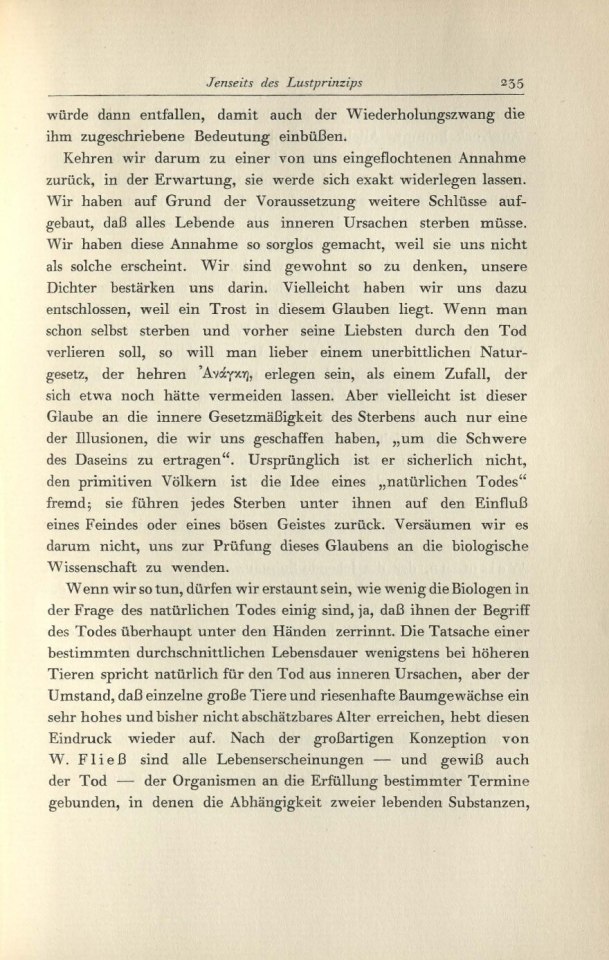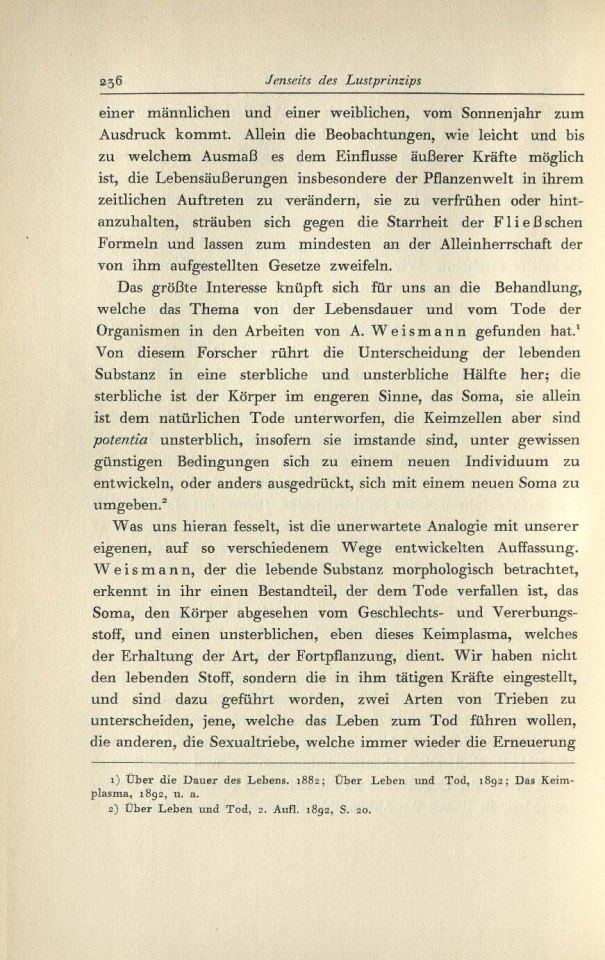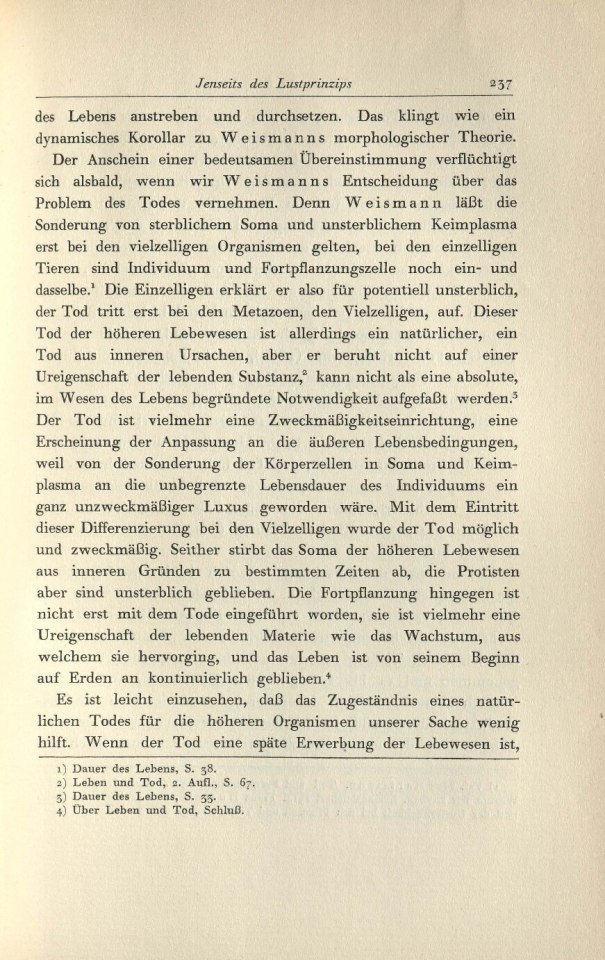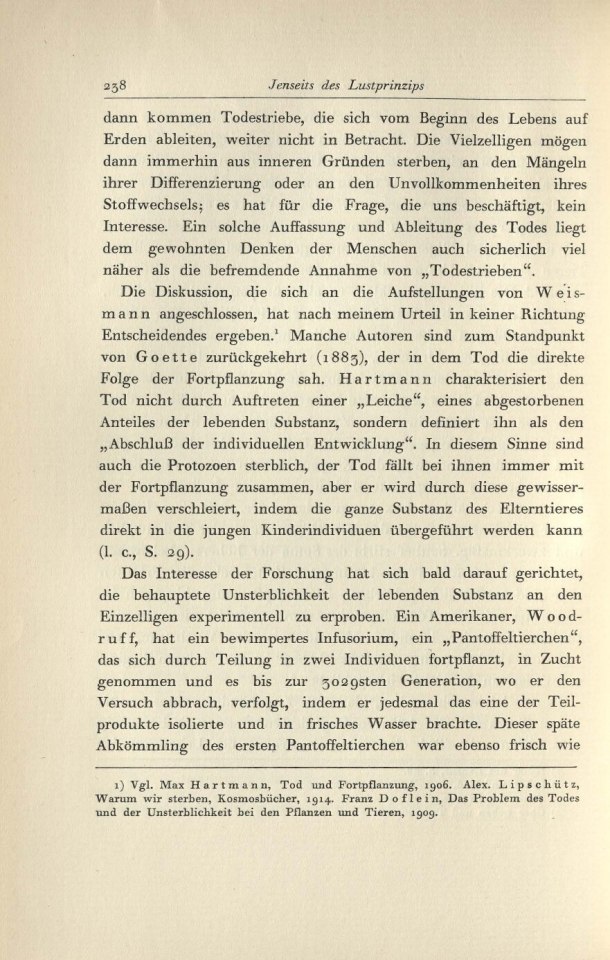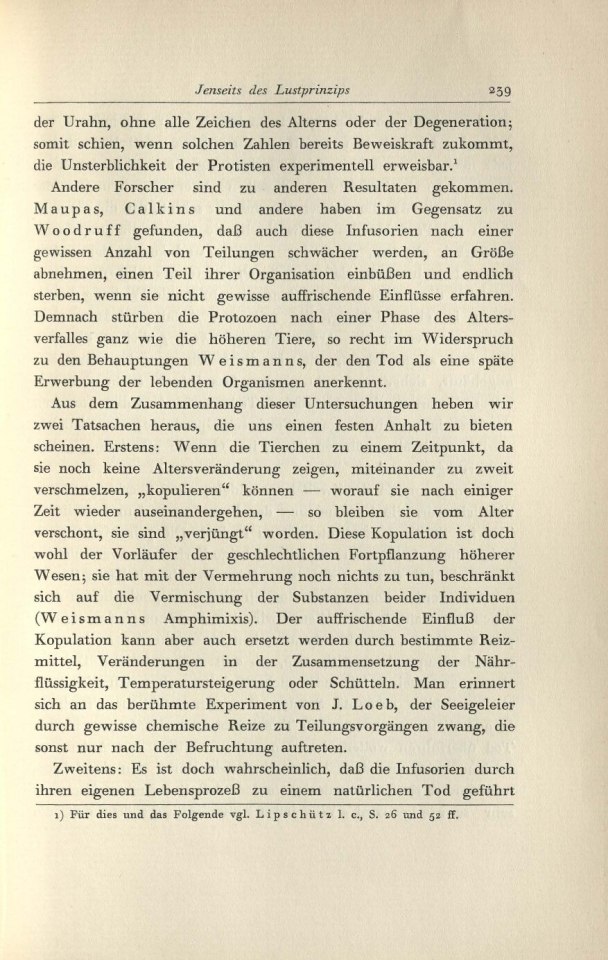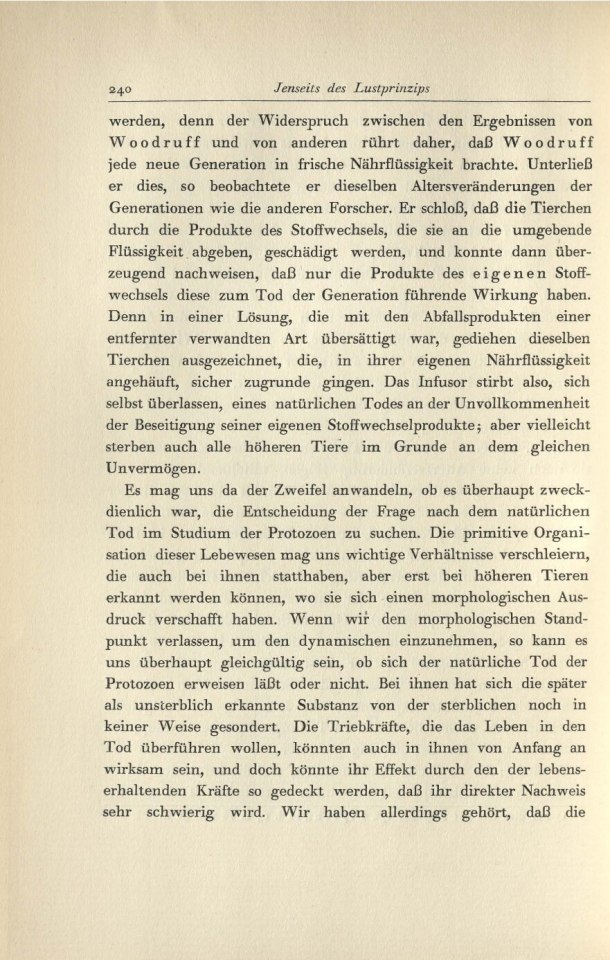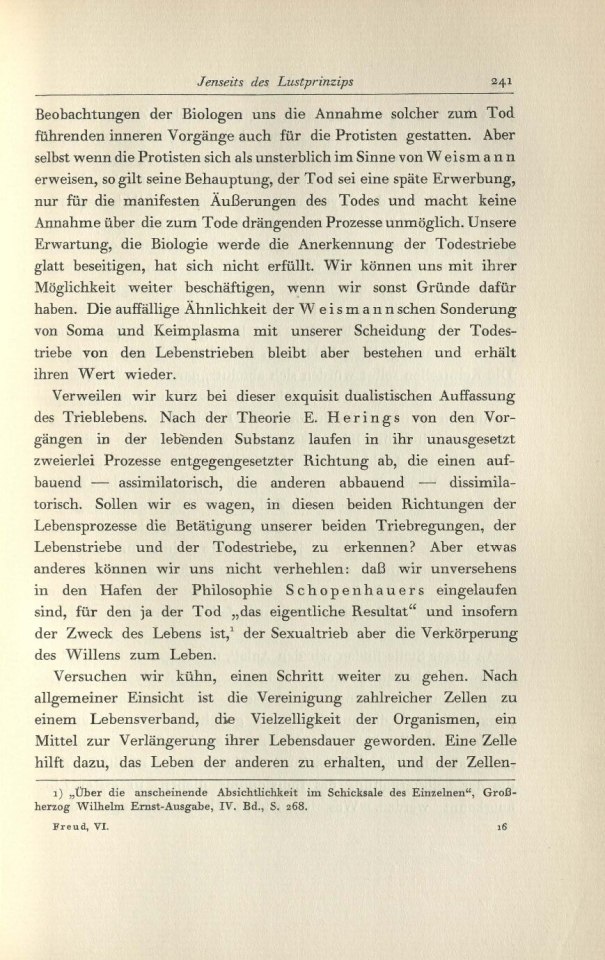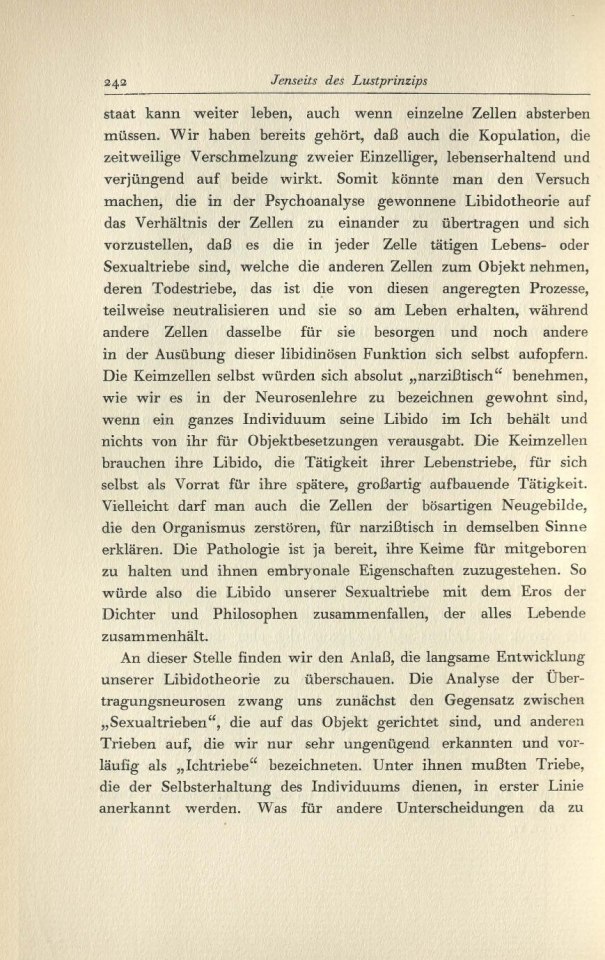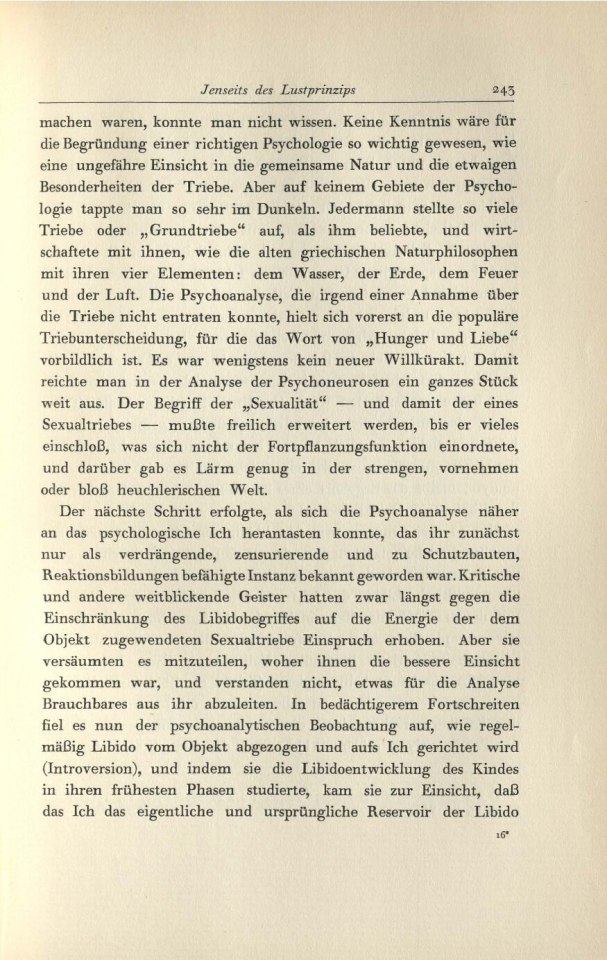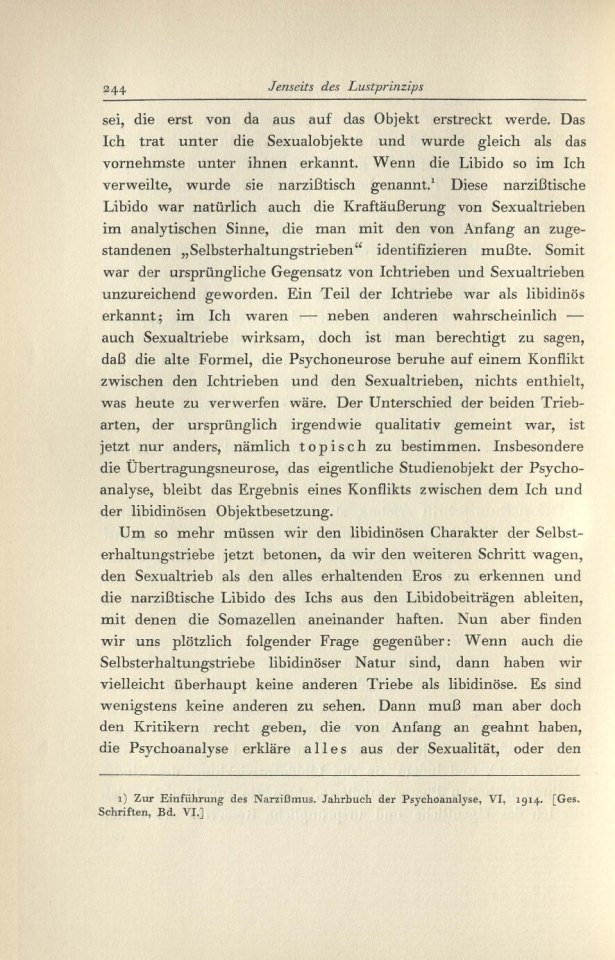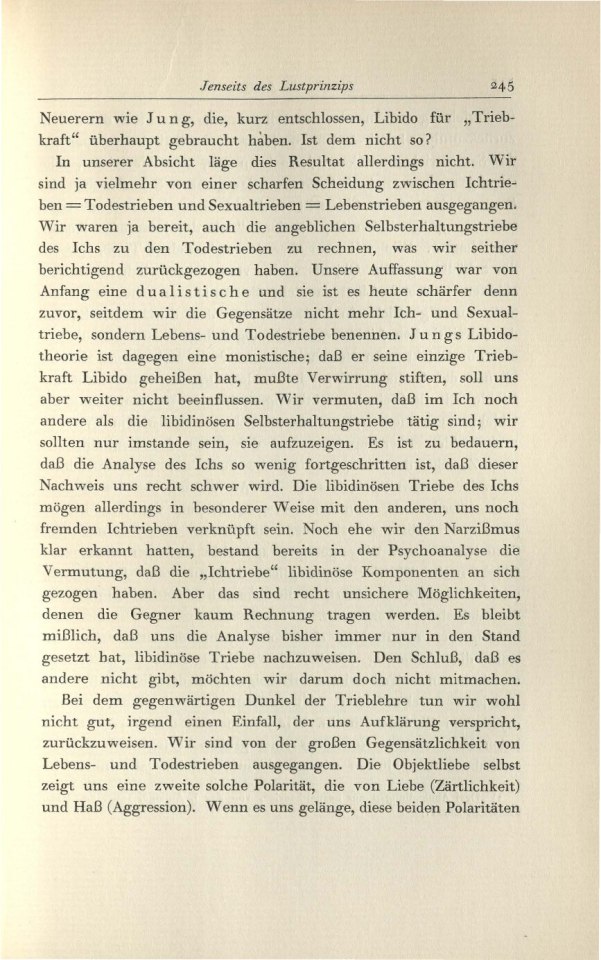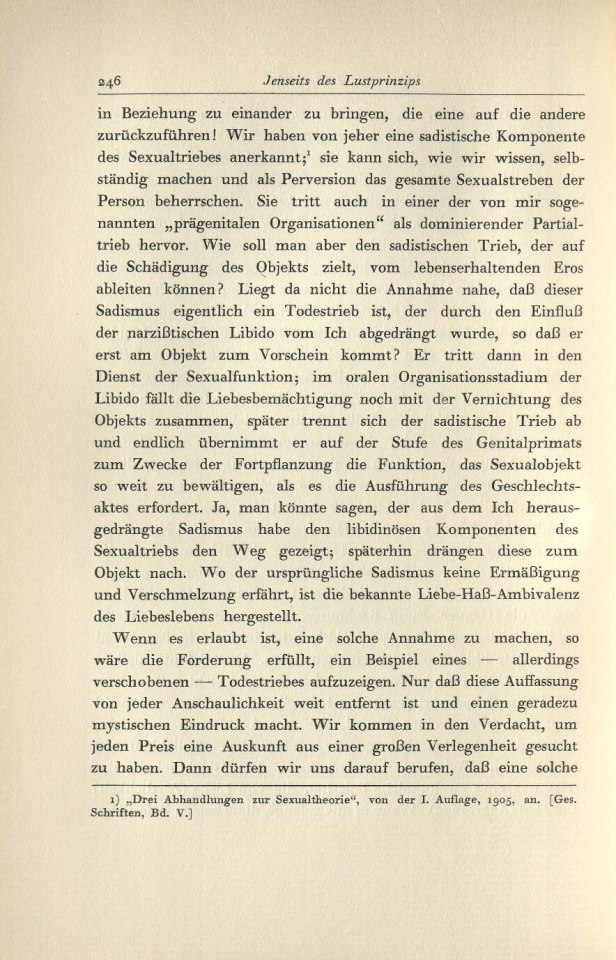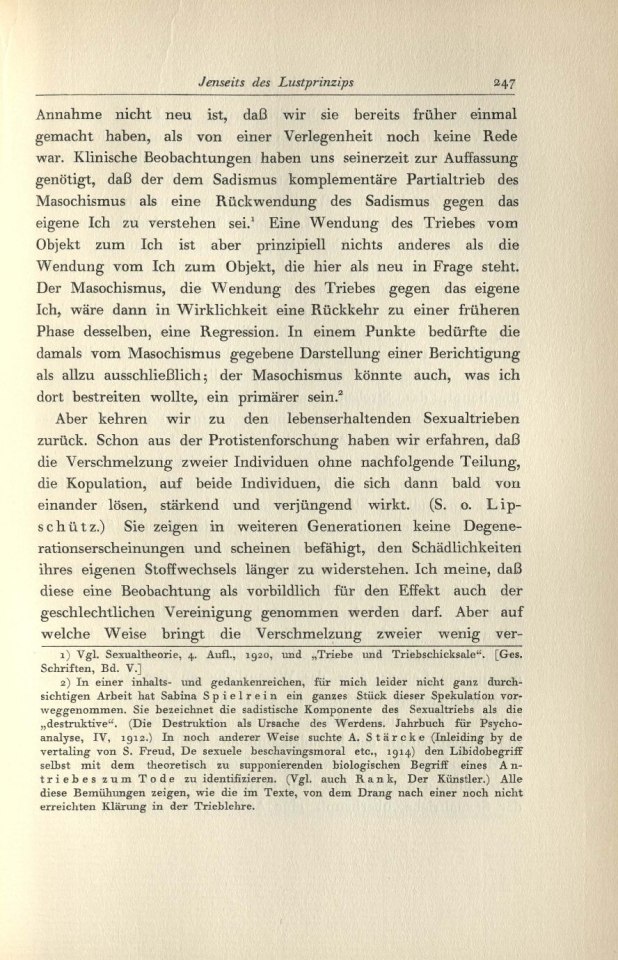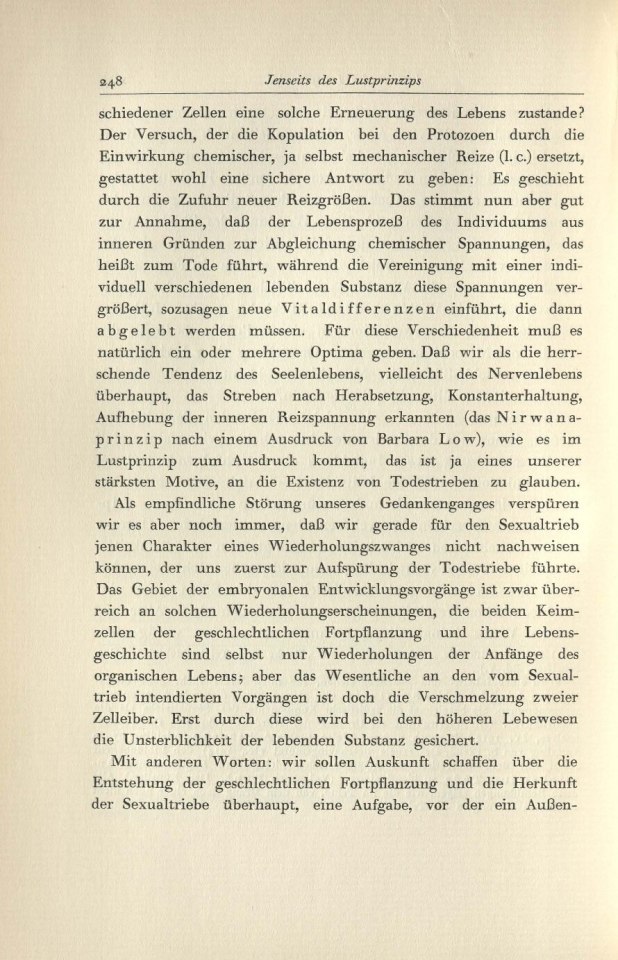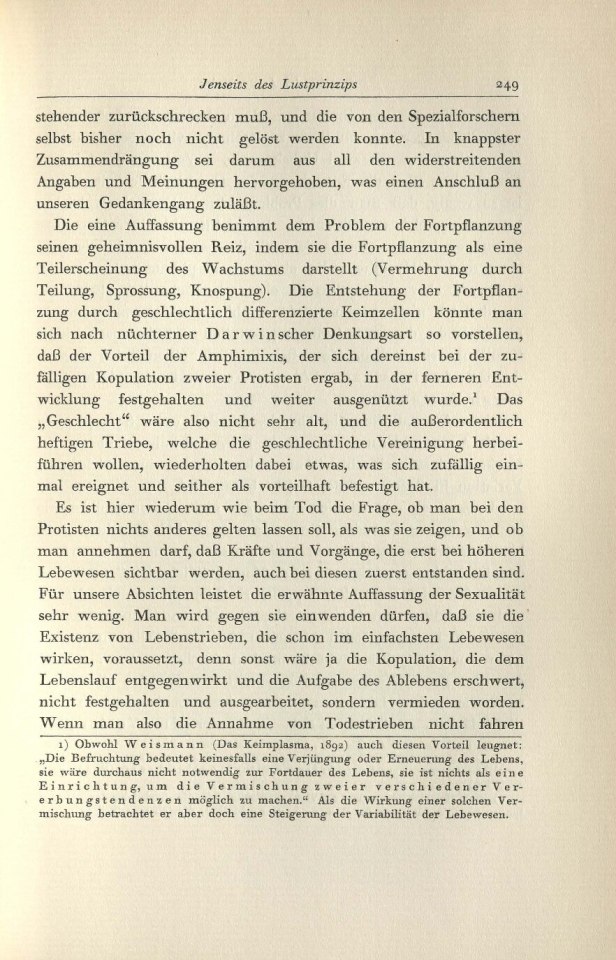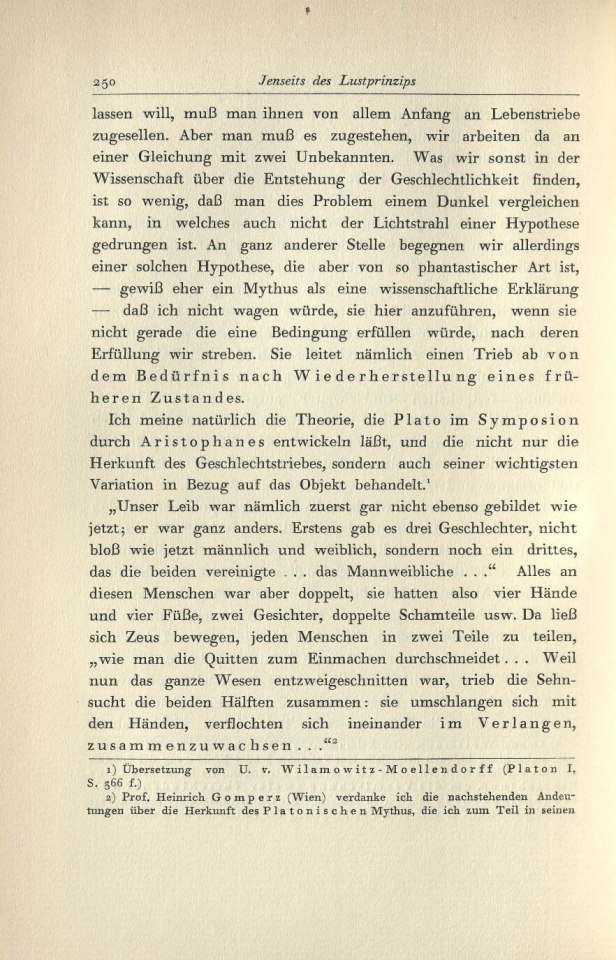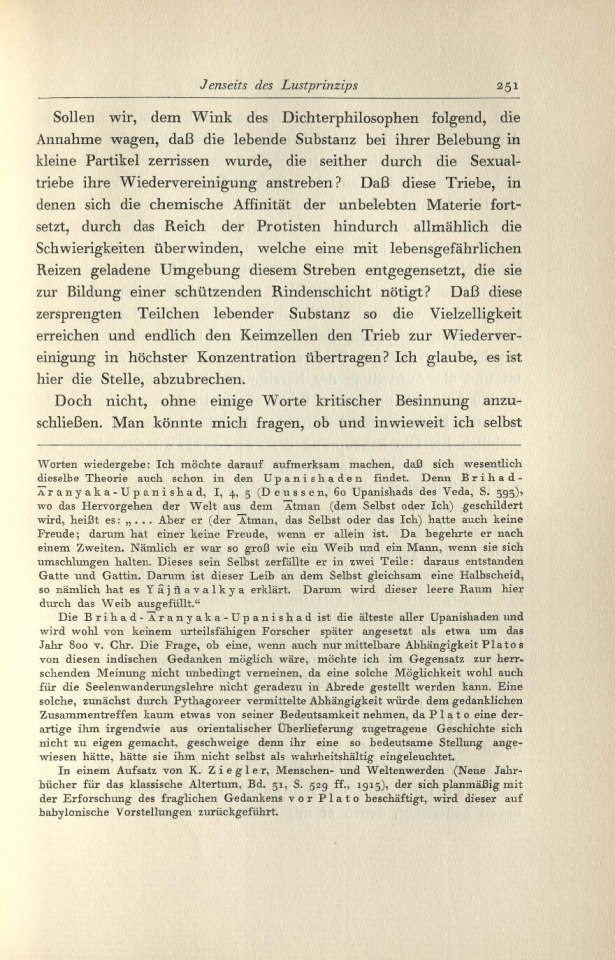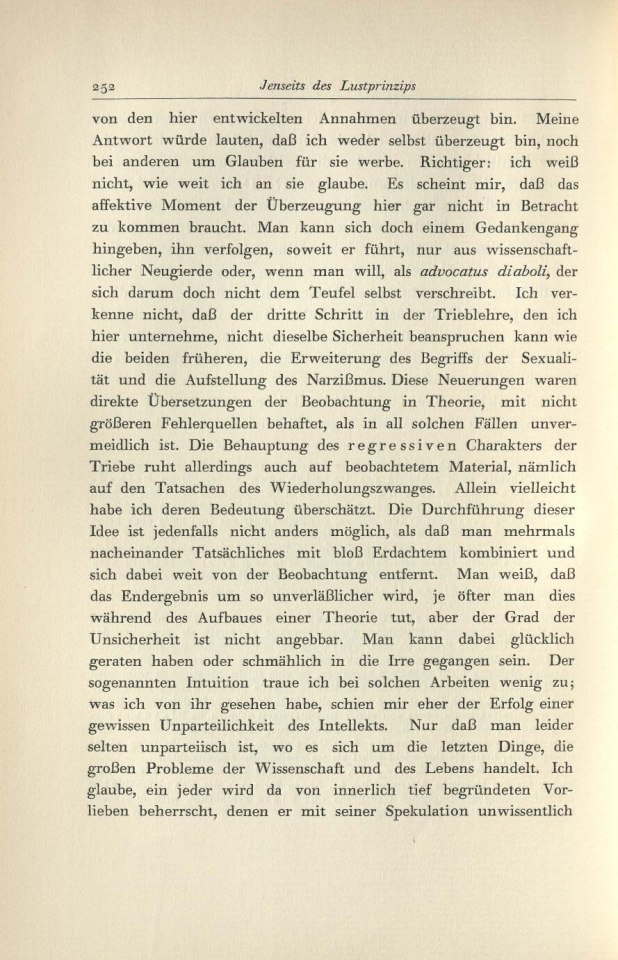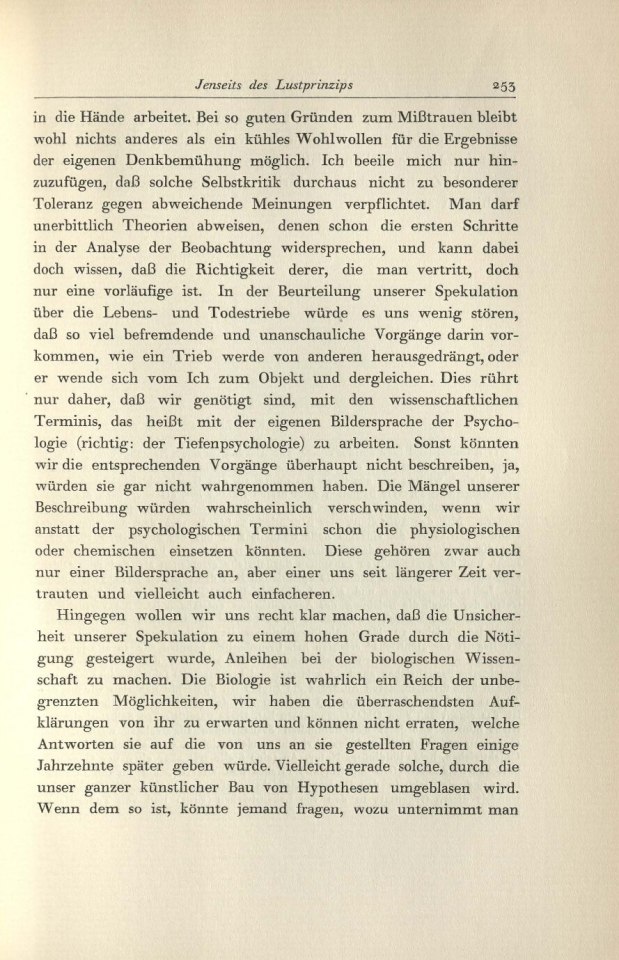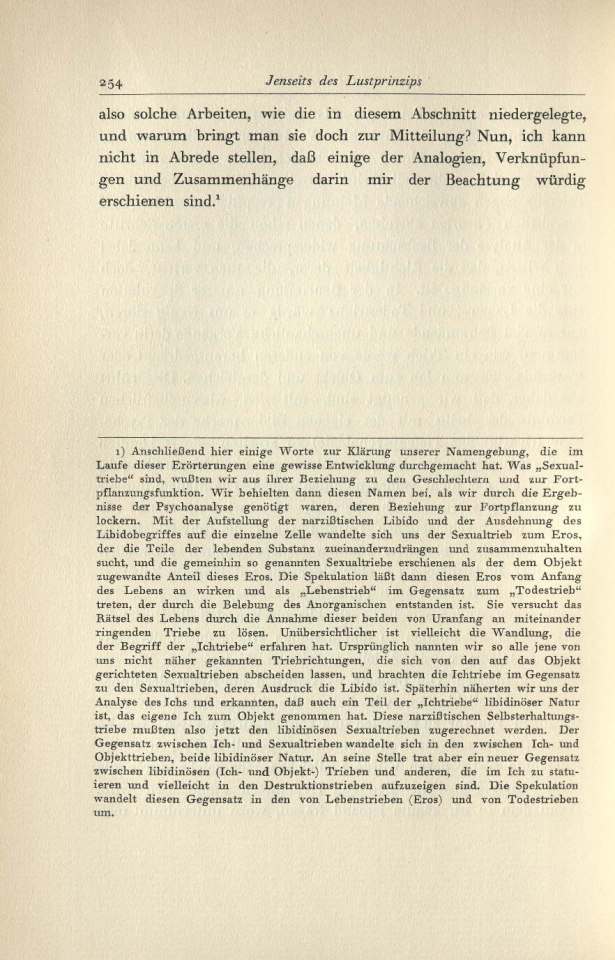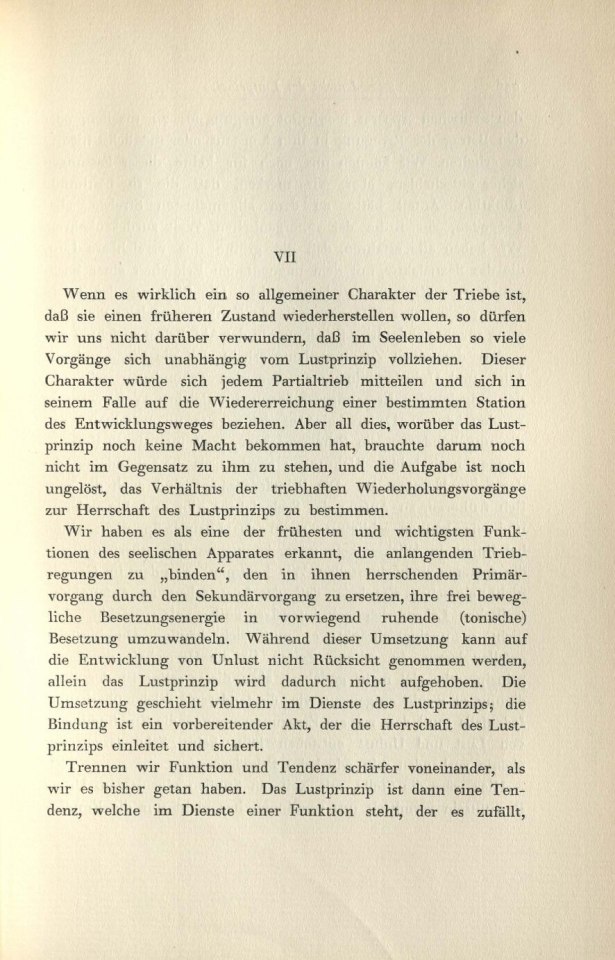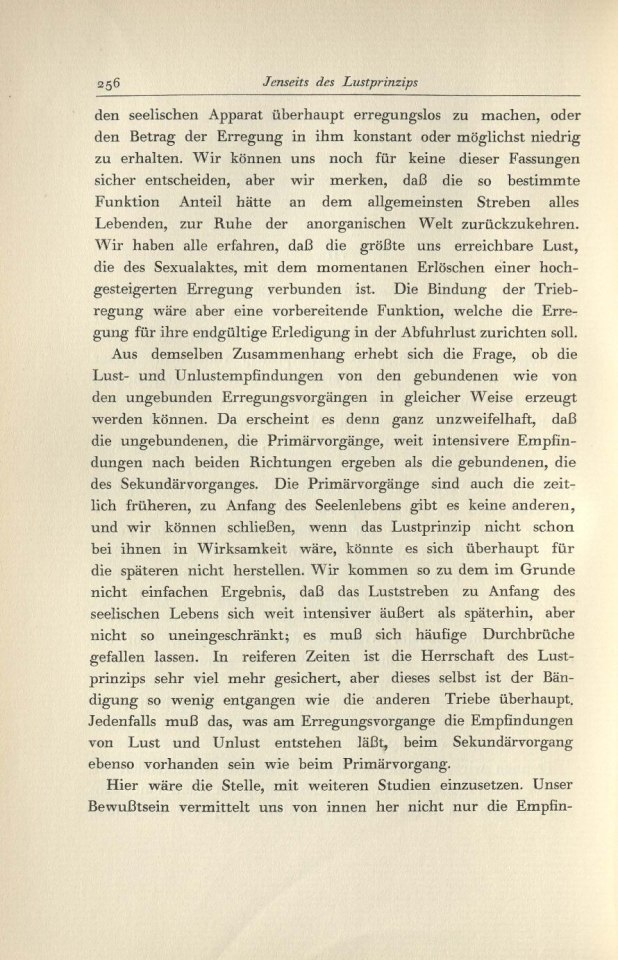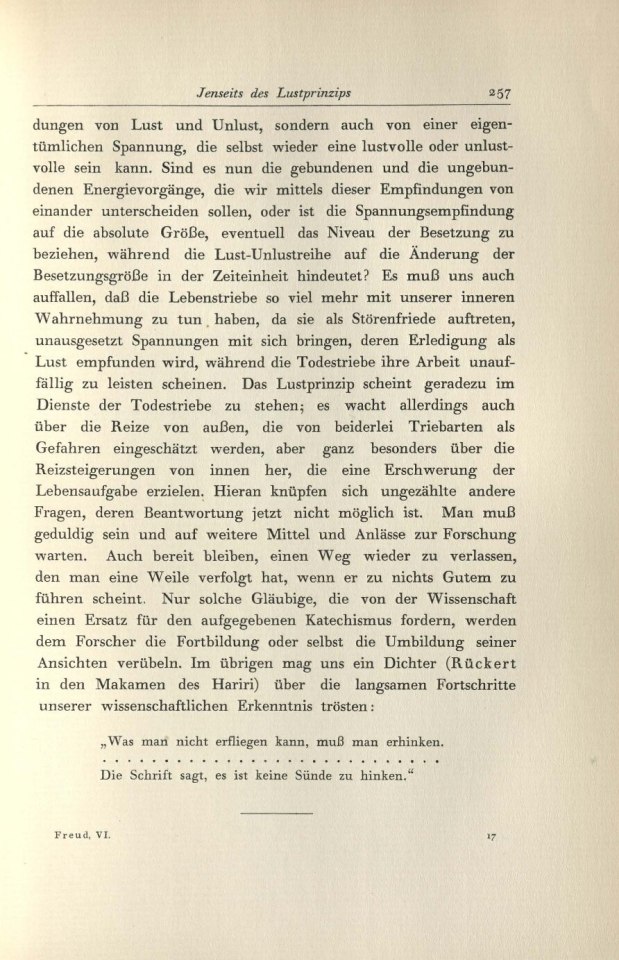S.
S.
190
„Jenseits des Lustprinzips“ erschien 1920 im Internationalen Psycho-
analytischen Verlag, Leipzig, Wien, Zürich; 2. Auflage (2.‑4. Tausend) 1921,
3. Auflage (5.‑9. Auflage) 1924.
Es erschienen autorisierte Übersetzungen:
in englischer Sprache (übersetzt von C. J. M. Hubback) London 1922;
in holländischer Sprache (Arie Querido) unter dem Titel „Het
Levensmysterie en de Psycho‑Analyse“, Amsterdam 1922;
in spanischer Sprache (Luis Lopez‑Ballesteros y de Torres) im II. Band
der „Obras Completas“, Madrid 1922, und
in ungarischer Sprache (Vilma Kovács) unter dem Titel „A halál-
ösztön és az életösztönök“, Budapest 1923.S.
191
I
In der psychoanalytischen Theorie nehmen wir unbedenklich
an, daß der Ablauf der seelischen Vorgänge automatisch durch
das Lustprinzip reguliert wird, das heißt, wir glauben, daß er
jedesmal durch eine unlustvolle Spannung angeregt wird und
dann eine solche Richtung einschlägt, daß sein Endergebnis mit
einer Herabsetzung dieser Spannung, also mit einer Vermeidung
von Unlust oder Erzeugung von Lust zusammenfällt. Wenn wir
die von uns studierten seelischen Prozesse mit Rücksicht auf
diesen Ablauf betrachten, führen wir den ökonomischen Gesichts-
punkt in unsere Arbeit ein. Wir meinen, eine Darstellung, die
neben dem topischen und dem dynamischen Moment noch dies
ökonomische zu würdigen versuche, sei die vollständigste, die
wir uns derzeit vorstellen können, und verdiene es, durch den
Namen einer metapsychologischen hervorgehoben zu werden.Es hat dabei für uns kein Interesse, zu untersuchen, inwieweit
wir uns mit der Aufstellung des Lustprinzips einem bestimmten,
historisch festgelegten, philosophischen System angenähert oder
angeschlossen haben. Wir gelangen zu solchen spekulativen An-
nahmen bei dem Bemühen, von den Tatsachen der täglichen
Beobachtung auf unserem Gebiete Beschreibung und Rechenschaft
zu geben. Priorität und Originalität gehören nicht zu den Zielen,
die der psychoanalytischen Arbeit gesetzt sind, und die Eindrücke,
welche der Aufstellung dieses Prinzips zugrunde liegen, sind so
augenfällig, daß es kaum möglich ist, sie zu übersehen. Dagegen
würden wir uns gerne zur Dankbarkeit gegen eine philosophischeS.
192
oder psychologische Theorie bekennen, die uns zu sagen wüßte,
was die Bedeutungen der für uns so imperativen Lust‑ und
Unlustempfindungen sind. Leider wird uns hier nichts Brauch-
bares geboten. Es ist das dunkelste und unzugänglichste Gebiet
des Seelenlebens, und wenn wir unmöglich vermeiden können,
es zu berühren, so wird die lockerste Annahme darüber, meine
ich, die beste sein. Wir haben uns entschlossen, Lust und Unlust
mit der Quantität der im Seelenleben vorhandenen – und nicht
irgendwie gebundenen – Erregung in Beziehung zu bringen,
solcher Art, daß Unlust einer Steigerung, Lust einer Verringerung
dieser Quantität entspricht. Wir denken dabei nicht an ein ein-
faches Verhältnis zwischen der Stärke der Empfindungen und den
Veränderungen, auf die sie bezogen werden; am wenigsten –
nach allen Erfahrungen der Psychophysiologie – an direkte Pro-
portionalität; wahrscheinlich ist das Maß der Verringerung oder
Vermehrung in der Zeit das für die Empfindung entscheidende
Moment. Das Experiment fände hier möglicherweise Zutritt, für
uns Analytiker ist weiteres Eingehen in diese Probleme nicht
geraten, solange nicht ganz bestimmte Beobachtungen uns leiten
können.Es kann uns aber nicht gleichgültig lassen, wenn wir finden,
daß ein so tiefblickender Forscher wie G. Th. Fechner eine
Auffassung von Lust und Unlust vertreten hat, welche im wesent-
lichen mit der zusammenfällt, die uns von der psychoanalytischen
Arbeit aufgedrängt wird. Die Äußerung Fechners ist in seiner
kleinen Schrift: Einige Ideen zur Schöpfungs‑ und Entwicklungs-
geschichte der Organismen, 1873 (Abschnitt XI, Zusatz, p. 94),
enthalten und lautet wie folgt: „Insofern bewußte Antriebe
immer mit Lust oder Unlust in Beziehung stehen, kann auch
Lust oder Unlust mit Stabilitäts‑ und Instabilitätsverhältnissen in
psychophysischer Beziehung gedacht werden, und es läßt sich
hierauf die anderwärts von mir näher zu entwickelnde Hypothese
begründen, daß jede die Schwelle des Bewußtseins übersteigendeS.
193
psychophysische Bewegung nach Maßgabe mit Lust behaftet sei,
als sie sich der vollen Stabilität über eine gewisse Grenze hinaus
nähert, mit Unlust nach Maßgabe, als sie über eine gewisse
Grenze davon abweicht, indes zwischen beiden, als qualitative
Schwelle der Lust und Unlust zu bezeichnenden Grenzen eine
gewisse Breite ästhetischer Indifferenz besteht …“Die Tatsachen, die uns veranlaßt haben, an die Herrschaft des
Lustprinzips im Seelenleben zu glauben, finden auch ihren Aus-
druck in der Annahme, daß es ein Bestreben des seelischen
Apparates sei, die in ihm vorhandene Quantität von Erregung
möglichst niedrig oder wenigstens konstant zu erhalten. Es ist
dasselbe, nur in andere Fassung gebracht, denn wenn die Arbeit
des seelischen Apparates dahin geht, die Erregungsquantität
niedrig zu halten, so muß alles, was dieselbe zu steigern geeignet
ist, als funktionswidrig, das heißt als unlustvoll empfunden
werden. Das Lustprinzip leitet sich aus dem Konstanzprinzip ab;
in Wirklichkeit wurde das Konstanzprinzip aus den Tatsachen
erschlossen, die uns die Annahme des Lustprinzips aufnötigten.
Bei eingehenderer Diskussion werden wir auch finden, daß dies
von uns angenommene Bestreben des seelischen Apparates sich
als spezieller Fall dem Fechnerschen Prinzip der Tendenz
zur Stabilität unterordnet, zu dem er die Lust‑Unlust-
empfindungen in Beziehung gebracht hat.Dann müssen wir aber sagen, es sei eigentlich unrichtig, von
einer Herrschaft des Lustprinzips über den Ablauf der seelischen
Prozesse zu reden. Wenn eine solche bestände, müßte die über-
große Mehrheit unserer Seelenvorgänge von Lust begleitet sein
oder zur Lust führen, während doch die allgemeinste Erfahrung
dieser Folgerung energisch widerspricht. Es kann also nur so
sein, daß eine starke Tendenz zum Lustprinzip in der Seele
besteht, der sich aber gewisse andere Kräfte oder Verhältnisse
widersetzen, so daß der Endausgang nicht immer der Lusttendenz
entsprechen kann. Vergleiche die Bemerkung Fechners beiS.
194
ähnlichem Anlasse (ebenda, p. 90): „Damit aber, daß die Tendenz
zum Ziele noch nicht die Erreichung des Zieles bedeutet und
das Ziel überhaupt nur in Approximationen erreichbar ist …“
Wenn wir uns nun der Frage zuwenden, welche Umstände die
Durchsetzung des Lustprinzips zu vereiteln vermögen, dann
betreten wir wieder sicheren und bekannten Boden und können
unsere analytischen Erfahrungen in reichem Ausmaße zur Beant-
wortung heranziehen.Der erste Fall einer solchen Hemmung des Lustprinzips ist
uns als ein gesetzmäßiger vertraut. Wir wissen, daß das Lust-
prinzip einer primären Arbeitsweise des seelischen Apparates eignet,
und daß es für die Selbstbehauptung des Organismus unter den
Schwierigkeiten der Außenwelt so recht von Anfang an unbrauchbar,
ja in hohem Grade gefährlich ist. Unter dem Einflusse der Selbst-
erhaltungstriebe des Ichs wird es vom Realitätsprinzip
abgelöst, welches, ohne die Absicht endlicher Lustgewinnung auf-
zugeben, doch den Aufschub der Befriedigung, den Verzicht auf
mancherlei Möglichkeiten einer solchen und die zeitweilige
Duldung der Unlust auf dem langen Umwege zur Lust fordert
und durchsetzt. Das Lustprinzip bleibt dann noch lange Zeit die
Arbeitsweise der schwerer „erziehbaren“ Sexualtriebe, und es
kommt immer wieder vor, daß es, sei es von diesen letzteren aus,
sei es im Ich selbst, das Realitätsprinzip zum Schaden des ganzen
Organismus überwältigt.Es ist indes unzweifelhaft, daß die Ablösung des Lustprinzips
durch das Realitätsprinzip nur für einen geringen und nicht für
den intensivsten Teil der Unlusterfahrungen verantwortlich
gemacht werden kann. Eine andere, nicht weniger gesetzmäßige
Quelle der Unlustentbindung ergibt sich aus den Konflikten und
Spaltungen im seelischen Apparat, während das Ich seine Ent-
wicklung zu höher zusammengesetzten Organisationen durchmacht.
Fast alle Energie, die den Apparat erfüllt, stammt aus den mit-
gebrachten Triebregungen, aber diese werden nicht alle zu denS.
195
gleichen Entwicklungsphasen zugelassen. Unterwegs geschieht es
immer wieder, daß einzelne Triebe oder Triebanteile sich in ihren
Zielen oder Ansprüchen als unverträglich mit den übrigen er-
weisen, die sich zu der umfassenden Einheit des Ichs zusammen-
schließen können. Sie werden dann von dieser Einheit durch
den Prozeß der Verdrängung abgespalten, auf niedrigeren Stufen
der psychischen Entwicklung zurückgehalten und zunächst von
der Möglichkeit einer Befriedigung abgeschnitten. Gelingt es
ihnen dann, was bei den verdrängten Sexualtrieben so leicht
geschieht, sich auf Umwegen zu einer direkten oder Ersatz-
befriedigung durchzuringen, so wird dieser Erfolg, der sonst
eine Lustmöglichkeit gewesen wäre, vom Ich als Unlust empfunden.
Infolge des alten, in die Verdrängung auslaufenden Konfliktes hat
das Lustprinzip einen neuerlichen Durchbruch erfahren, gerade
während gewisse Triebe am Werke waren, in Befolgung des
Prinzips neue Lust zu gewinnen. Die Einzelheiten des Vor-
ganges, durch welchen die Verdrängung eine Lustmöglichkeit
in eine Unlustquelle verwandelt, sind noch nicht gut verstanden
oder nicht klar darstellbar, aber sicherlich ist alle neurotische
Unlust von solcher Art, ist Lust, die nicht als solche empfunden
werden kann.1Die beiden hier angezeigten Quellen der Unlust decken noch
lange nicht die Mehrzahl unserer Unlusterlebnisse, aber vom
Rest wird man mit einem Anschein von gutem Recht behaupten,
daß sein Vorhandensein der Herrschaft des Lustprinzips nicht
widerspricht. Die meiste Unlust, die wir verspüren, ist ja Wahr-
nehmungsunlust, entweder Wahrnehmung des Drängens unbe-
friedigter Triebe oder äußere Wahrnehmung, sei es, daß diese
an sich peinlich ist, oder daß sie unlustvolle Erwartungen im
seelischen Apparat erregt, von ihm als „Gefahr“ erkannt wird.
Die Reaktion auf diese Triebansprüche und Gefahrdrohungen, in1) Das wesentliche ist wohl, daß Lust und Unlust als bewußte Empfindungen an
das Ich gebunden sind.S.
196
der sich die eigentliche Tätigkeit des seelischen Apparates äußert,
kann dann in korrekter Weise vom Lustprinzip oder dem es
modifizierenden Realitätsprinzip geleitet werden. Somit scheint es
nicht notwendig, eine weitergehende Einschränkung des Lust-
prinzips anzuerkennen, und doch kann gerade die Untersuchung
der seelischen Reaktion auf die äußerliche Gefahr neuen Stoff
und neue Fragestellungen zu dem hier behandelten Problem
liefern.S.
197
II
Nach schweren mechanischen Erschütterungen, Eisenbahn-
zusammenstößen und anderen, mit Lebensgefahr verbundenen
Unfällen ist seit langem ein Zustand beschrieben worden, dem
dann der Name „traumatische Neurose“ verblieben ist. Der
schreckliche, eben jetzt abgelaufene Krieg hat eine große Anzahl
solcher Erkrankungen entstehen lassen und wenigstens der Ver-
suchung ein Ende gesetzt, sie auf organische Schädigung des
Nervensystems durch Einwirkung mechanischer Gewalt zurück-
zuführen.1 Das Zustandsbild der traumatischen Neurose nähert
sich der Hysterie durch seinen Reichtum an ähnlichen motorischen
Symptomen, übertrifft diese aber in der Regel durch die stark
ausgebildeten Anzeichen subjektiven Leidens, etwa wie bei einer
Hypochondrie oder Melancholie, und durch die Beweise einer
weit umfassenderen allgemeinen Schwächung und Zerrüttung der
seelischen Leistungen. Ein volles Verständnis ist bisher weder
für die Kriegsneurosen noch für die traumatischen Neurosen des
Friedens erzielt worden. Bei den Kriegsneurosen wirkte es einer-
seits aufklärend, aber doch wiederum verwirrend, daß dasselbe
Krankheitsbild gelegentlich ohne Mithilfe einer groben mechanischen
Gewalt zustande kam; an der gemeinen traumatischen Neurose
heben sich zwei Züge hervor, an welche die Überlegung anknüpfen
konnte, erstens, daß das Hauptgewicht der Verursachung auf das1) Vgl. Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen. Mit Beiträgen von Ferenczi,
Abraham, Simmel und E. Jones. Band I der Internationalen Psychoanalytischen
Bibliothek, 1919.S.
198
Moment der Überraschung, auf den Schreck, zu fallen schien,
und zweitens, daß eine gleichzeitig erlittene Verletzung oder
Wunde zumeist der Entstehung der Neurose entgegenwirkte.
Schreck, Furcht, Angst werden mit Unrecht wie synonyme Aus-
drücke gebraucht; sie lassen sich in ihrer Beziehung zur Gefahr
gut auseinanderhalten. Angst bezeichnet einen gewissen Zustand
wie Erwartung der Gefahr und Vorbereitung auf dieselbe, mag
sie auch eine unbekannte sein; Furcht verlangt ein bestimmtes
Objekt, vor dem man sich fürchtet; Schreck aber benennt den
Zustand, in den man gerät, wenn man in Gefahr kommt, ohne
auf sie vorbereitet zu sein, betont das Moment der Überraschung.
Ich glaube nicht, daß die Angst eine traumatische Neurose
erzeugen kann; an der Angst ist etwas, was gegen den Schreck
und also auch gegen die Schreckneurose schützt. Wir werden auf
diesen Satz später zurückkommen.Das Studium des Traumes dürfen wir als den zuverlässigsten
Weg zur Erforschung der seelischen Tiefenvorgänge betrachten.
Nun zeigt das Traumleben der traumatischen Neurose den
Charakter, daß es den Kranken immer wieder in die Situation seines
Unfalles zurückführt, aus der er mit neuem Schrecken erwacht.
Darüber verwundert man sich viel zu wenig. Man meint, es sei
eben ein Beweis für die Stärke des Eindruckes, den das trauma-
tische Erlebnis gemacht hat, daß es sich dem Kranken sogar im
Schlaf immer wieder aufdrängt. Der Kranke sei an das Trauma
sozusagen psychisch fixiert. Solche Fixierungen an das Erlebnis,
welches die Erkrankung ausgelöst hat, sind uns seit langem bei
der Hysterie bekannt. Breuer und Freud äußerten 1893: Die
Hysterischen leiden großenteils an Reminiszenzen. Auch bei den
Kriegsneurosen haben Beobachter wie Ferenczi und Simmel
manche motorische Symptome durch Fixierung an den Moment
des Traumas erklären können.Allein es ist mir nicht bekannt, daß die an traumatischer
Neurose Krankenden sich im Wachleben viel mit der ErinnerungS.
199
an ihren Unfall beschäftigen. Vielleicht bemühen sie sich eher,
nicht an ihn zu denken. Wenn man es als selbstverständlich hin-
nimmt, daß der nächtliche Traum sie wieder in die krank-
machende Situation versetzt, so verkennt man die Natur des
Traumes. Dieser würde es eher entsprechen, dem Kranken Bilder
aus der Zeit der Gesundheit oder der erhofften Genesung vor-
zuführen. Sollen wir durch die Träume der Unfallsneurotiker
nicht an der wunscherfüllenden Tendenz des Traumes irre
werden, so bleibt uns etwa noch die Auskunft, bei diesem
Zustand sei wie so vieles andere auch die Traumfunktion
erschüttert und von ihren Absichten abgelenkt worden, oder wir
müßten der rätselhaften masochistischen Tendenzen des Ichs
gedenken.Ich mache nun den Vorschlag, das dunkle und düstere Thema
der traumatischen Neurose zu verlassen und die Arbeitsweise des
seelischen Apparates an einer seiner frühzeitigsten normalen
Betätigungen zu studieren. Ich meine das Kinderspiel.Die verschiedenen Theorien des Kinderspieles sind erst kürzlich
von S. Pfeifer in der „Imago“ (V/4) zusammengestellt und
analytisch gewürdigt worden; ich kann hier auf diese Arbeit
verweisen. Diese Theorien bemühen sich, die Motive des Spielens
der Kinder zu erraten, ohne daß dabei der ökonomische Gesichts-
punkt, die Rücksicht auf Lustgewinn, in den Vordergrund
gerückt würde. Ich habe, ohne das Ganze dieser Erscheinungen
umfassen zu wollen, eine Gelegenheit ausgenützt, die sich mir
bot, um das erste selbstgeschaffene Spiel eines Knaben im Alter
von 1½Jahren aufzuklären. Es war mehr als eine flüchtige
Beobachtung, denn ich lebte durch einige Wochen mit dem
Kinde und dessen Eltern unter einem Dach, und es dauerte
ziemlich lange, bis das rätselhafte und andauernd wiederholte Tun
mir seinen Sinn verriet.Das Kind war in seiner intellektuellen Entwicklung keineswegs
voreilig, es sprach mit 1½ Jahren erst wenige verständlicheS.
200
Worte und verfügte außerdem über mehrere bedeutungsvolle
Laute, die von der Umgebung verstanden wurden. Aber es war
in gutem Rapport mit den Eltern und dem einzigen Dienst-
mädchen und wurde wegen seines „anständigen“ Charakters
gelobt. Es störte die Eltern nicht zur Nachtzeit, befolgte gewissen-
haft die Verbote, manche Gegenstände zu berühren und in
gewisse Räume zu gehen, und vor allem anderen, es weinte nie,
wenn die Mutter es für Stunden verließ, obwohl es dieser
Mutter zärtlich anhing, die das Kind nicht nur selbst genährt,
sondern auch ohne jede fremde Beihilfe gepflegt und betreut
hatte. Dieses brave Kind zeigte nun die gelegentlich störende
Gewohnheit, alle kleinen Gegenstände, deren es habhaft wurde,
weit weg von sich in eine Zimmerecke, unter ein Bett usw. zu
schleudern, so daß das Zusammensuchen seines Spielzeuges oft
keine leichte Arbeit war. Dabei brachte es mit dem Aus-
druck von Interesse und Befriedigung ein lautes, langgezogenes
o‑o‑o‑o hervor, das nach dem übereinstimmenden Urteil der
Mutter und des Beobachters keine Interjektion war, sondern
„Fort“ bedeutete. Ich merkte endlich, daß das ein Spiel sei,
und daß das Kind alle seine Spielsachen nur dazu benütze, mit
ihnen „fortsein“ zu spielen. Eines Tages machte ich dann die
Beobachtung, die meine Auffassung bestätigte. Das Kind hatte
eine Holzspule, die mit einem Bindfaden umwickelt war. Es
fiel ihm nie ein, sie zum Beispiel am Boden hinter sich her-
zuziehen, also Wagen mit ihr zu spielen, sondern es warf die
am Faden gehaltene Spule mit großem Geschick über den Rand
seines verhängten Bettchens, so daß sie darin verschwand, sagte
dazu sein bedeutungsvolles o‑o‑o‑o und zog dann die Spule
am Faden wieder aus dem Bett heraus, begrüßte aber deren
Erscheinen jetzt mit einem freudigen „Da“. Das war also das
komplette Spiel, Verschwinden und Wiederkommen, wovon
man zumeist nur den ersten Akt zu sehen bekam, und
dieser wurde für sich allein unermüdlich als Spiel wiederholt,S.
201
obwohl die größere Lust unzweifelhaft dem zweiten
Akt anhing.1Die Deutung des Spieles lag dann nahe. Es war im Zusammen-
hang mit der großen kulturellen Leistung des Kindes, mit dem
von ihm zustande gebrachten Triebverzicht (Verzicht auf Trieb-
befriedigung), das Fortgehen der Mutter ohne Sträuben zu
gestatten. Es entschädigte sich gleichsam dafür, indem es dasselbe
Verschwinden und Wiederkommen mit den ihm erreichbaren
Gegenständen selbst in Szene setzte. Für die affektive Einschätzung
dieses Spieles ist es natürlich gleichgültig, ob das Kind es selbst
erfunden oder sich infolge einer Anregung zu eigen gemacht
hatte. Unser Interesse wird sich einem anderen Punkte zuwenden.
Das Fortgehen der Mutter kann dem Kinde unmöglich angenehm
oder auch nur gleichgültig gewesen sein. Wie stimmt es also
zum Lustprinzip, daß es dieses ihm peinliche Erlebnis als Spiel
wiederholt? Man wird vielleicht antworten wollen, das Fortgehen
müßte als Vorbedingung des erfreulichen Wiedererscheinens
gespielt werden, im letzteren sei die eigentliche Spielabsicht
gelegen. Dem würde die Beobachtung widersprechen, daß der
erste Akt, das Fortgehen, für sich allein als Spiel inszeniert
wurde, und zwar ungleich häufiger als das zum lustvollen Ende
fortgeführte Ganze.Die Analyse eines solchen einzelnen Falles ergibt keine sichere
Entscheidung; bei unbefangener Betrachtung gewinnt man den
Eindruck, daß das Kind das Erlebnis aus einem anderen Motiv
zum Spiel gemacht hat. Es war dabei passiv, wurde vom Erlebnis
betroffen und bringt sich nun in eine aktive Rolle, indem es
dasselbe, trotzdem es unlustvoll war, als Spiel wiederholt. Dieses1) Diese Deutung wurde dann durch eine weitere Beobachtung völlig gesichert.
Als eines Tages die Mutter über viele Stunden abwesend gewesen war, wurde sie
beim Wiederkommen mit der Mitteilung begrüßt: Bebi o‑o‑o‑o!, die zunächst
unverständlich blieb. Es ergab sich aber bald, daß das Kind während dieses langen
Alleinseins ein Mittel gefunden hatte, sich selbst verschwinden zu lassen. Es hatte
sein Bild in dem fast bis zum Boden reichenden Standspiegel entdeckt und sich dann
niedergekauert, so daß das Spiegelbild „fort“ war.S.
202
Bestreben könnte man einem Bemächtigungstrieb zurechnen, der
sich davon unabhängig macht, ob die Erinnerung an sich lustvoll
war oder nicht. Man kann aber auch eine andere Deutung
versuchen. Das Wegwerfen des Gegenstandes, so daß er fort ist,
könnte die Befriedigung eines im Leben unterdrückten Rache-
impulses gegen die Mutter sein, weil sie vom Kinde fort-
gegangen ist, und dann die trotzige Bedeutung haben: Ja, geh’
nur fort, ich brauch’ dich nicht, ich schick’ dich selber weg.
Dasselbe Kind, das ich mit 1½ Jahren bei seinem ersten Spiel
beobachtete, pflegte ein Jahr später ein Spielzeug, über das es
sich geärgert hatte, auf den Boden zu werfen und dabei zu
sagen: Geh’ in K(r)ieg! Man hatte ihm damals erzählt, der
abwesende Vater befinde sich im Krieg, und es vermißte den
Vater gar nicht, sondern gab die deutlichsten Anzeichen von sich,
daß es im Alleinbesitz der Mutter nicht gestört werden wolle.1
Wir wissen auch von anderen Kindern, daß sie ähnliche feind-
selige Regungen durch das Wegschleudern von Gegenständen an
Stelle der Personen auszudrücken vermögen.2 Man gerät so in
Zweifel, ob der Drang, etwas Eindrucksvolles psychisch zu ver-
arbeiten, sich seiner voll zu bemächtigen, sich primär und
unabhängig vom Lustprinzip äußern kann. Im hier diskutierten
Falle könnte er einen unangenehmen Eindruck doch nur darum
im Spiel wiederholen, weil mit dieser Wiederholung ein anders-
artiger, aber direkter Lustgewinn verbunden ist.Auch die weitere Verfolgung des Kinderspieles hilft diesem
unserem Schwanken zwischen zwei Auffassungen nicht ab. Man
sieht, daß die Kinder alles im Spiele wiederholen, was ihnen im
Leben großen Eindruck gemacht hat, daß sie dabei die Stärke
des Eindruckes abreagieren und sich sozusagen zu Herren der1) Als das Kind fünfdreiviertel Jahre alt war, starb die Mutter. Jetzt, da sie wirklich
„fort“ (o‑o‑o) war, zeigte der Knabe keine Trauer um sie. Allerdings war inzwischen
ein zweites Kind geboren worden, das seine stärkste Eifersucht erweckt hatte.2) Vgl. Eine Kindheitserinnerung aus „Dichtung und Wahrheit“. Imago, V, 1917.
[Ges. Schriften, Bd. V.]S.
203
Situation machen. Aber anderseits ist es klar genug, daß all
ihr Spielen unter dem Einflusse des Wunsches steht, der diese
ihre Zeit dominiert, des Wunsches: groß zu sein und so tun zu
können wie die Großen. Man macht auch die Beobachtung, daß
der Unlustcharakter des Erlebnisses es nicht immer für das Spiel
unbrauchbar macht. Wenn der Doktor dem Kinde in den Hals
geschaut oder eine kleine Operation an ihm ausgeführt hat, so
wird dies erschreckende Erlebnis ganz gewiß zum Inhalt des
nächsten Spieles werden, aber der Lustgewinn aus anderer Quelle
ist dabei nicht zu übersehen. Indem das Kind aus der Passivität
des Erlebens in die Aktivität des Spielens übergeht, fügt es einem
Spielgefährten das Unangenehme zu, das ihm selbst widerfahren
war, und rächt sich so an der Person dieses Stellvertreters.Aus diesen Erörterungen geht immerhin hervor, daß die An-
nahme eines besonderen Nachahmungstriebes als Motiv des
Spielens überflüssig ist. Schließen wir noch die Mahnungen an,
daß das künstlerische Spielen und Nachahmen der Erwachsenen,
das zum Unterschied vom Verhalten des Kindes auf die Person
des Zuschauers zielt, diesem die schmerzlichsten Eindrücke zum
Beispiel in der Tragödie nicht erspart und doch von ihm als
hoher Genuß empfunden werden kann. Wir werden so davon
überzeugt, daß es auch unter der Herrschaft des Lustprinzips
Mittel und Wege genug gibt, um das an sich Unlustvolle zum
Gegenstand der Erinnerung und seelischen Bearbeitung zu machen.
Mag sich mit diesen, in endlichen Lustgewinn auslaufenden
Fällen und Situationen eine ökonomisch gerichtete Ästhetik
befassen; für unsere Absichten leisten sie nichts, denn sie setzen
Existenz und Herrschaft des Lustprinzips voraus und zeugen nicht
für die Wirksamkeit von Tendenzen jenseits des Lustprinzips,
das heißt solcher, die ursprünglicher als dies und von ihm
unabhängig wären.S.
204
III
Fünfundzwanzig Jahre intensiver Arbeit haben es mit sich
gebracht, daß die nächsten Ziele der psychoanalytischen Technik
heute ganz andere sind als zu Anfang. Zuerst konnte der ana-
lysierende Arzt nichts anderes anstreben, als das dem Kranken
verborgene Unbewußte zu erraten, zusammenzusetzen und zur
rechten Zeit mitzuteilen. Die Psychoanalyse war vor allem eine
Deutungskunst. Da die therapeutische Aufgabe dadurch nicht
gelöst war, trat sofort die nächste Absicht auf, den Kranken zur
Bestätigung der Konstruktion durch seine eigene Erinnerung zu
nötigen. Bei diesem Bemühen fiel das Hauptgewicht auf die
Widerstände des Kranken; die Kunst war jetzt, diese baldigst
aufzudecken, dem Kranken zu zeigen und ihn durch menschliche
Beeinflussung (hier die Stelle für die als „Übertragung“ wirkende
Suggestion) zum Aufgeben der Widerstände zu bewegen.Dann aber wurde es immer deutlicher, daß das gesteckte Ziel,
die Bewußtwerdung des Unbewußten, auch auf diesem Wege
nicht voll erreichbar ist. Der Kranke kann von dem in ihm
Verdrängten nicht alles erinnern, vielleicht gerade das Wesentliche
nicht, und erwirbt so keine Überzeugung von der Richtigkeit der ihm
mitgeteilten Konstruktion. Er ist vielmehr genötigt, das Verdrängte
als gegenwärtiges Erlebnis zu wiederholen, anstatt es, wie der
Arzt es lieber sähe, als ein Stück der Vergangenheit zu erinnern.1
Diese mit unerwünschter Treue auftretende Reproduktion hat1) S. Weitere Ratschläge zur Technik der Psychoanalyse. II. Erinnern, Wieder-
holen und Durcharbeiten. [Ges. Schriften, Bd. VI.]S.
205
immer ein Stück des infantilen Sexuallebens, also des Ödipus-
komplexes und seiner Ausläufer, zum Inhalt und spielt sich
regelmäßig auf dem Gebiete der Übertragung, das heißt der
Beziehung zum Arzt ab. Hat man es in der Behandlung so weit
gebracht, so kann man sagen, die frühere Neurose sei nun durch
eine frische Übertragungsneurose ersetzt. Der Arzt hat sich bemüht,
den Bereich dieser Übertragungsneurose möglichst einzuschränken,
möglichst viel in die Erinnerung zu drängen und möglichst wenig
zur Wiederholung zuzulassen. Das Verhältnis, das sich zwischen
Erinnerung und Reproduktion herstellt, ist für jeden Fall ein
anderes. In der Regel kann der Arzt dem Analysierten diese
Phase der Kur nicht ersparen; er muß ihn ein gewisses Stück
seines vergessenen Lebens wiedererleben lassen und hat dafür zu
sorgen, daß ein Maß von Überlegenheit erhalten bleibt, kraft
dessen die anscheinende Realität doch immer wieder als Spiegelung
einer vergessenen Vergangenheit erkannt wird. Gelingt dies, so
ist die Überzeugung des Kranken und der von ihr abhängige
therapeutische Erfolg gewonnen.Um diesen „Wiederholungszwang“, der sich während
der psychoanalytischen Behandlung der Neurotiker äußert,
begreiflicher zu finden, muß man sich vor allem von dem Irr-
tum frei machen, man habe es bei der Bekämpfung der Wider-
stände mit dem Widerstand des „Unbewußten“ zu tun. Das
Unbewußte, das heißt das „Verdrängte“, leistet den Bemühungen
der Kur überhaupt keinen Widerstand, es strebt ja selbst nichts
anderes an, als gegen den auf ihm lastenden Druck zum Bewußt-
sein oder zur Abfuhr durch die reale Tat durchzudringen. Der
Widerstand in der Kur geht von denselben höheren Schichten
und Systemen des Seelenlebens aus, die seinerzeit die Verdrän-
gung durchgeführt haben. Da aber die Motive der Widerstände,
ja diese selbst erfahrungsgemäß in der Kur zunächst unbewußt
sind, werden wir gemahnt, eine Unzweckmäßigkeit unserer Aus-
drucksweise zu verbessern. Wir entgehen der Unklarheit, wennS.
206
wir nicht das Bewußte und das Unbewußte, sondern das
zusammenhängende Ich und das Verdrängte in Gegensatz
zueinander bringen. Vieles am Ich ist sicherlich selbst unbewußt,
gerade das, was man den Kern des Ichs nennen darf; nur einen
geringen Teil davon decken wir mit dem Namen des Vorbe-
wußten. Nach dieser Ersetzung einer bloß deskriptiven Aus-
drucksweise durch eine systematische oder dynamische können
wir sagen, der Widerstand der Analysierten gehe von ihrem Ich
aus, und dann erfassen wir sofort, der Wiederholungszwang ist
dem unbewußten Verdrängten zuzuschreiben. Er konnte sich
wahrscheinlich nicht eher äußern, als bis die entgegenkommende
Arbeit der Kur die Verdrängung gelockert hatte.1Es ist kein Zweifel, daß der Widerstand des bewußten und
vorbewußten Ichs im Dienste des Lustprinzips steht, er will ja
die Unlust ersparen, die durch das Freiwerden des Verdrängten
erregt würde, und unsere Bemühung geht dahin, solcher Unlust
unter Berufung auf das Realitätsprinzip Zulassung zu erwirken.
In welcher Beziehung zum Lustprinzip steht aber der Wieder-
holungszwang, die Kraftäußerung des Verdrängten? Es ist klar,
daß das meiste, was der Wiederholungszwang wiedererleben läßt,
dem Ich Unlust bringen muß, denn er fördert ja Leistungen
verdrängter Triebregungen zutage, aber das ist Unlust, die wir
schon gewürdigt haben, die dem Lustprinzip nicht widerspricht,
Unlust für das eine System und gleichzeitig Befriedigung für das
andere. Die neue und merkwürdige Tatsache aber, die wir jetzt
zu beschreiben haben, ist, daß der Wiederholungszwang auch
solche Erlebnisse der Vergangenheit wiederbringt, die keine Lust-
möglichkeit enthalten, die auch damals nicht Befriedigungen,
selbst nicht von seither verdrängten Triebregungen, gewesen sein
können.1) Ich setze an anderer Stelle auseinander, daß es die „Suggestionswirkung“ der
Kur ist, welche hier dem Wiederholungszwang zu Hilfe kommt, also die tief im
unbewußten Elternkomplex begründete Gefügigkeit gegen den Arzt.S.
207
Die Frühblüte des infantilen Sexuallebens war infolge der
Unverträglichkeit ihrer Wünsche mit der Realität und der Unzu-
länglichkeit der kindlichen Entwicklungsstufe zum Untergang
bestimmt. Sie ging bei den peinlichsten Anlässen unter tief
schmerzlichen Empfindungen zugrunde. Der Liebesverlust und das
Mißlingen hinterließen eine dauernde Beeinträchtigung des
Selbstgefühls als narzißtische Narbe, nach meinen Erfahrungen
wie nach den Ausführungen Marcinowskis1 den stärksten
Beitrag zu dem häufigen „Minderwertigkeitsgefühl“ der Neu-
rotiker. Die Sexualforschung, der durch die körperliche Entwick-
lung des Kindes Schranken gesetzt werden, brachte es zu keinem
befriedigenden Abschluß; daher die spätere Klage: Ich kann
nichts fertig bringen, mir kann nichts gelingen. Die zärtliche
Bindung, meist an den gegengeschlechtlichen Elternteil, erlag der
Enttäuschung, dem vergeblichen Warten auf Befriedigung, der
Eifersucht bei der Geburt eines neuen Kindes, die unzweideutig
die Untreue des oder der Geliebten erwies; der eigene mit
tragischem Ernst unternommene Versuch, selbst ein solches Kind
zu schaffen, mißlang in beschämender Weise; die Abnahme der
dem Kleinen gespendeten Zärtlichkeit, der gesteigerte Anspruch
der Erziehung, ernste Worte und eine gelegentliche Bestrafung
hatten endlich den ganzen Umfang der ihm zugefallenen Ver-
schmähung enthüllt. Es gibt hier einige wenige Typen, die
regelmäßig wiederkehren, wie der typischen Liebe dieser Kinderzeit
ein Ende gesetzt wird.Alle diese unerwünschten Anlässe und schmerzlichen Affekt-
lagen werden nun vom Neurotiker in der Übertragung wieder
holt und mit großem Geschick neu belebt. Sie streben den
Abbruch der unvollendeten Kur an, sie wissen sich den Ein-
druck der Verschmähung wieder zu verschaffen, den Arzt zu
harten Worten und kühlem Benehmen gegen sie zu nötigen, sie1) Marcinowski, Die erotischen Quellen der Minderwertigkeitsgefühle. Zeit-
schrift für Sexualwissenschaft, IV. 1918.S.
208
finden die geeigneten Objekte für ihre Eifersucht, sie ersetzen
das heiß begehrte Kind der Urzeit durch den Vorsatz oder das
Versprechen eines großen Geschenkes, das meist ebensowenig real
wird wie jenes. Nichts von alledem konnte damals lustbringend
sein; man sollte meinen, es müßte heute die geringere Unlust
bringen, wenn es als Erinnerung oder in Träumen auftauchte,
als wenn es sich zu neuem Erlebnis gestaltete. Es handelt sich
natürlich um die Aktion von Trieben, die zur Befriedigung
führen sollten, allein die Erfahrung, daß sie anstatt dessen auch
damals nur Unlust brachten, hat nichts gefruchtet. Sie wird
trotzdem wiederholt; ein Zwang drängt dazu.Dasselbe, was die Psychoanalyse an den Übertragungsphäno-
menen der Neurotiker aufzeigt, kann man auch im Leben nicht
neurotischer Personen wiederfinden. Es macht bei diesen den
Eindruck eines sie verfolgenden Schicksals, eines dämonischen
Zuges in ihrem Erleben, und die Psychoanalyse hat vom Anfang
an solches Schicksal für zum großen Teil selbstbereitet und durch
frühinfantile Einflüsse determiniert gehalten. Der Zwang, der
sich dabei äußert, ist vom Wiederholungszwang der Neurotiker
nicht verschieden, wenngleich diese Personen niemals die Zeichen
eines durch Symptombildung erledigten neurotischen Konflikts
geboten haben. So kennt man Personen, bei denen jede mensch-
liche Beziehung den gleichen Ausgang nimmt: Wohltäter, die
von jedem ihrer Schützlinge nach einiger Zeit im Groll ver-
lassen werden, so verschieden diese sonst auch sein mögen, denen
also bestimmt scheint, alle Bitterkeit des Undankes auszukosten;
Männer, bei denen jede Freundschaft den Ausgang nimmt, daß
der Freund sie verrät; andere, die es unbestimmt oft in ihrem
Leben wiederholen, eine andere Person zur großen Autorität für
sich oder auch für die Öffentlichkeit zu erheben, und diese Auto-
rität dann nach abgemessener Zeit selbst stürzen, um sie durch
eine neue zu ersetzen; Liebende, bei denen jedes zärtliche Ver-
hältnis zum Weibe dieselben Phasen durchmacht und zumS.
209
gleichen Ende führt usw. Wir verwundern uns über diese „ewige
Wiederkehr des Gleichen“ nur wenig, wenn es sich um ein
aktives Verhalten des Betreffenden handelt, und wenn wir den
sich gleichbleibenden Charakterzug seines Wesens auffinden, der
sich in der Wiederholung der nämlichen Erlebnisse äußern muß.
Weit stärker wirken jene Fälle auf uns, bei denen die Person
etwas passiv zu erleben scheint, worauf ihr ein Einfluß nicht
zusteht, während sie doch immer nur die Wiederholung desselben
Schicksals erlebt. Man denke zum Beispiel an die Geschichte
jener Frau, die dreimal nacheinander Männer heiratete, die nach
kurzer Zeit erkrankten und von ihr zu Tode gepflegt werden
mußten.1 Die ergreifendste poetische Darstellung eines solchen
Schicksalszuges hat Tasso im romantischen Epos „Gerusalemme
liberata“ gegeben. Held Tankred hat unwissentlich die von ihm
geliebte Clorinda getötet, als sie in der Rüstung eines feindlichen
Ritters mit ihm kämpfte. Nach ihrem Begräbnis dringt er in
den unheimlichen Zauberwald ein, der das Heer der Kreuzfahrer
schreckt. Dort zerhaut er einen hohen Baum mit seinem Schwerte,
aber aus der Wunde des Baumes strömt Blut und die Stimme
Clorindas, deren Seele in diesem Baum gebannt war, klagt ihn
an, daß er wiederum die Geliebte geschädigt habe.Angesichts solcher Beobachtungen aus dem Verhalten in der
Übertragung und aus dem Schicksal der Menschen werden wir
den Mut zur Annahme finden, daß es im Seelenleben wirklich
einen Wiederholungszwang gibt, der sich über das Lustprinzip
hinaussetzt. Wir werden auch jetzt geneigt sein, die Träume der
Unfallsneurotiker und den Antrieb zum Spiel des Kindes auf
diesen Zwang zu beziehen. Allerdings müssen wir uns sagen, daß
wir die Wirkungen des Wiederholungszwanges nur in seltenen
Fällen rein, ohne Mithilfe anderer Motive, erfassen können. Beim1) Vgl. hiezu die treffenden Bemerkungen in dem Aufsatz von C. G. Jung. Die
Bedeutung des Vaters für das Schicksal des Einzelnen. Jahrbuch für Psychoanalyse,
I. 1909.S.
210
Kinderspiel haben wir bereits hervorgehoben, welche andere Deu-
tungen seine Entstehung zuläßt. Wiederholungszwang und direkte
lustvolle Triebbefriedigung scheinen sich dabei zu intimer Gemein-
samkeit zu verschränken. Die Phänomene der Übertragung stehen
offenkundig im Dienste des Widerstandes von seiten des auf der
Verdrängung beharrenden Ichs; der Wiederholungszwang, den sich
die Kur dienstbar machen wollte, wird gleichsam vom Ich, das
am Lustprinzip festhalten will, auf seine Seite gezogen. An dem,
was man den Schicksalszwang nennen könnte, scheint uns vieles
durch die rationelle Erwägung verständlich, so daß man ein
Bedürfnis nach der Aufstellung eines neuen geheimnisvollen
Motivs nicht verspürt. Am unverdächtigsten ist vielleicht der Fall
der Unfallsträume, aber bei näherer Überlegung muß man doch
zugestehen, daß auch in den anderen Beispielen der Sachverhalt
durch die Leistung der uns bekannten Motive nicht gedeckt
wird. Es bleibt genug übrig, was die Annahme des Wieder-
holungszwanges rechtfertigt, und dieser erscheint uns ursprüng-
licher, elementarer, triebhafter als das von ihm zur Seite
geschobene Lustprinzip. Wenn es aber einen solchen Wieder-
holungszwang im Seelischen gibt, so möchten wir gerne etwas
darüber wissen, welcher Funktion er entspricht, unter welchen
Bedingungen er hervortreten kann, und in welcher Beziehung
er zum Lustprinzip steht, dem wir doch bisher die Herrschaft
über den Ablauf der Erregungsvorgänge im Seelenleben zuge-
traut haben.S.
211
IV
Was nun folgt, ist Spekulation, oft weitausholende Spekulation,
die ein jeder nach seiner besonderen Einstellung würdigen oder
vernachlässigen wird. Im weiteren ein Versuch zur konsequenten
Ausbeutung einer Idee, aus Neugierde, wohin dies führen wird.Die psychoanalytische Spekulation knüpft an den bei der
Untersuchung unbewußter Vorgänge empfangenen Eindruck an,
daß das Bewußtsein nicht der allgemeinste Charakter der seeli-
schen Vorgänge, sondern nur eine besondere Funktion derselben
sein könne. In metapsychologischer Ausdrucksweise behauptet sie,
das Bewußtsein sei die Leistung eines besonderen Systems, das
sie Bw benennt. Da das Bewußtsein im wesentlichen Wahr-
nehmungen von Erregungen liefert, die aus der Außenwelt
kommen, und Empfindungen von Lust und Unlust, die nur aus
dem Innern des seelischen Apparates stammen können, kann dem
System W‑Bw eine räumliche Stellung zugewiesen werden. Es
muß an der Grenze von außen und innen liegen, der Außen-
welt zugekehrt sein und die anderen psychischen Systeme
umhüllen. Wir bemerken dann, daß wir mit diesen Annahmen
nichts Neues gewagt, sondern uns der lokalisierenden Hirnana-
tomie angeschlossen haben, welche den „Sitz“ des Bewußtseins
in die Hirnrinde, in die äußerste, umhüllende Schicht des Zentral-
organs verlegt. Die Hirnanatomie braucht sich keine Gedanken
darüber zu machen, warum – anatomisch gesprochen – das
Bewußtsein gerade an der Oberfläche des Gehirns untergebracht
ist, anstatt wohlverwahrt irgendwo im innersten Innern desselbenS.
212
zu hausen. Vielleicht bringen wir es in der Ableitung einer
solchen Lage für unser System W‑Bw weiter.Das Bewußtsein ist nicht die einzige Eigentümlichkeit, die wir
den Vorgängen in diesem System zuschreiben. Wir stützen uns
auf die Eindrücke unserer psychoanalytischen Erfahrung, wenn
wir annehmen, daß alle Erregungsvorgänge in den anderen
Systemen Dauerspuren als Grundlage des Gedächtnisses in diesen
hinterlassen, Erinnerungsreste also, die nichts mit dem Bewußt-
werden zu tun haben. Sie sind oft am stärksten und haltbarsten,
wenn der sie zurücklassende Vorgang niemals zum Bewußtsein
gekommen ist. Wir finden es aber beschwerlich zu glauben, daß
solche Dauerspuren der Erregung auch im System W‑Bw zustande
kommen. Sie würden die Eignung des Systems zur Aufnahme
neuer Erregungen sehr bald einschränken,1 wenn sie immer
bewußt blieben; im anderen Falle, wenn sie unbewußt würden,
stellten sie uns vor die Aufgabe, die Existenz unbewußter Vor-
gänge in einem System zu erklären, dessen Funktionieren sonst
vom Phänomen des Bewußtseins begleitet wird. Wir hätten
sozusagen durch unsere Annahme, welche das Bewußtwerden in
ein besonderes System verweist, nichts verändert und nichts
gewonnen. Wenn dies auch keine absolut verbindliche Erwägung
sein mag, so kann sie uns doch zur Vermutung bewegen, daß
Bewußtwerden und Hinterlassung einer Gedächtnisspur für das-
selbe System miteinander unverträglich sind. Wir würden so
sagen können, im System Bw werde der Erregungsvorgang
bewußt, hinterlasse aber keine Dauerspur; alle die Spuren des-
selben, auf welche sich die Erinnerung stützt, kämen bei der
Fortpflanzung der Erregung auf die nächsten inneren Systeme in
diesen zustande. In diesem Sinne ist auch das Schema entworfen,
welches ich dem spekulativen Abschnitt meiner „Traumdeutung“
1900 eingefügt habe. Wenn man bedenkt, wie wenig wir aus1) Dies durchaus nach J. Breuers Auseinandersetzung im theoretischen
Abschnitt der „Studien über Hysterie“, 1895.S.
213
anderen Quellen über die Entstehung des Bewußtseins wissen,
wird man dem Satze, das Bewußtsein entstehe an Stelle
der Erinnerungsspur, wenigstens die Bedeutung einer
irgendwie bestimmten Behauptung einräumen müssen.Das System Bw wäre also durch die Besonderheit ausgezeich-
net, daß der Erregungsvorgang in ihm nicht wie in allen anderen
psychischen Systemen eine dauernde Veränderung seiner Elemente
hinterläßt, sondern gleichsam im Phänomen des Bewußtwerdens
verpufft. Eine solche Abweichung von der allgemeinen Regel
fordert eine Erklärung durch ein Moment, welches ausschließlich
bei diesem einen System in Betracht kommt, und dies den
anderen Systemen abzusprechende Moment könnte leicht die
exponierte Lage des Systems Bw sein, sein unmittelbares
Anstoßen an die Außenwelt.Stellen wir uns den lebenden Organismus in seiner größt-
möglichen Vereinfachung als undifferenziertes Bläschen reizbarer
Substanz vor; dann ist seine der Außenwelt zugekehrte Ober-
fläche durch ihre Lage selbst differenziert und dient als reiz-
aufnehmendes Organ. Die Embryologie als Wiederholung der
Entwicklungsgeschichte zeigt auch wirklich, daß das Zentral-
nervensystem aus dem Ektoderm hervorgeht, und die graue
Hirnrinde ist noch immer ein Abkömmling der primitiven Ober-
fläche und könnte wesentliche Eigenschaften derselben durch
Erbschaft übernommen haben. Es wäre dann leicht denkbar, daß
durch unausgesetzten Anprall der äußeren Reize an die Ober-
fläche des Bläschens dessen Substanz bis in eine gewisse Tiefe
dauernd verändert wird, so daß ihr Erregungsvorgang anders
abläuft als in tieferen Schichten. Es bildete sich so eine Rinde,
die endlich durch die Reizwirkung so durchgebrannt ist, daß sie
der Reizaufnahme die günstigsten Verhältnisse entgegenbringt
und einer weiteren Modifikation nicht fähig ist. Auf das System Bw
übertragen, würde dies meinen, daß dessen Elemente keine
Dauerveränderung beim Durchgang der Erregung mehr annehmenS.
214
können, weil sie bereits aufs äußerste im Sinne dieser Wirkung
modifiziert sind. Dann sind sie aber befähigt, das Bewußtsein
entstehen zu lassen. Worin diese Modifikation der Substanz und
des Erregungsvorganges in ihr besteht, darüber kann man sich
mancherlei Vorstellungen machen, die sich derzeit der Prüfung
entziehen. Man kann annehmen, die Erregung habe bei ihrem
Fortgang von einem Element zum anderen einen Widerstand zu
überwinden und diese Verringerung des Widerstandes setze eben
die Dauerspur der Erregung (Bahnung); im System Bw bestünde
also ein solcher Übergangswiderstand von einem Element zum
anderen nicht mehr. Man kann mit dieser Vorstellung die
Breuersche Unterscheidung von ruhender (gebundener) und
frei beweglicher Besetzungsenergie in den Elementen der psy-
chischen Systeme zusammenbringen;1 die Elemente des Systems Bw
würden dann keine gebundene und nur frei abfuhrfähige Energie
führen. Aber ich meine, vorläufig ist es besser, wenn man sich
über diese Verhältnisse möglichst unbestimmt äußert. Immerhin
hätten wir durch diese Spekulation die Entstehung des Bewußt-
seins in einen gewissen Zusammenhang mit der Lage des
Systems Bw und den ihm zuzuschreibenden Besonderheiten des
Erregungsvorganges verflochten.An dem lebenden Bläschen mit seiner reizaufnehmenden
Rindenschichte haben wir noch anderes zu erörtern. Dieses
Stückchen lebender Substanz schwebt inmitten einer mit den
stärksten Energien geladenen Außenwelt und würde von den
Reizwirkungen derselben erschlagen werden, wenn es nicht mit
einem Reizschutz versehen wäre. Es bekommt ihn dadurch,
daß seine äußerste Oberfläche die dem Lebenden zukommende
Struktur aufgibt, gewissermaßen anorganisch wird und nun als
eine besondere Hülle oder Membran reizabhaltend wirkt, das
heißt, veranlaßt, daß die Energien der Außenwelt sich nun mit1) Studien über Hysterie von J. Breuer und Freud, 4. unveränderte Auflage,
1922. [Ges. Schriften, Bd. I.]S.
215
einem Bruchteil ihrer Intensität auf die nächsten lebend
gebliebenen Schichten fortsetzen können. Diese können nun hinter
dem Reizschutz sich der Aufnahme der durchgelassenen Reiz-
mengen widmen. Die Außenschicht hat aber durch ihr Absterben
alle tieferen vor dem gleichen Schicksal bewahrt, wenigstens so
lange, bis nicht Reize von solcher Stärke herankommen, daß sie
den Reizschutz durchbrechen. Für den lebenden Organismus ist
der Reizschutz eine beinahe wichtigere Aufgabe als die Reiz-
aufnahme; er ist mit einem eigenen Energievorrat ausgestattet und
muß vor allem bestrebt sein, die besonderen Formen der Energie-
umsetzung, die in ihm spielen, vor dem gleichmachenden, also
zerstörenden Einfluß der übergroßen, draußen arbeitenden Energien
zu bewahren. Die Reizaufnahme dient vor allem der Absicht,
Richtung und Art der äußeren Reize zu erfahren und dazu muß
es genügen, der Außenwelt kleine Proben zu entnehmen, sie in
geringen Quantitäten zu verkosten. Bei den hochentwickelten
Organismen hat sich die reizaufnehmende Rindenschicht des
einstigen Bläschens längst in die Tiefe des Körperinnern zurück-
gezogen, aber Anteile von ihr sind an der Oberfläche unmittel-
bar unter dem allgemeinen Reizschutz zurückgelassen. Dies sind
die Sinnesorgane, die im wesentlichen Einrichtungen zur Auf-
nahme spezifischer Reizeinwirkungen enthalten, aber außerdem
besondere Vorrichtungen zu neuerlichem Schutz gegen übergroße
Reizmengen und zur Abhaltung unangemessener Reizarten. Es
ist für sie charakteristisch, daß sie nur sehr geringe Quantitäten
des äußeren Reizes verarbeiten, sie nehmen nur Stichproben der
Außenwelt vor; vielleicht darf man sie Fühlern vergleichen, die
sich an die Außenwelt herantasten und dann immer wieder von
ihr zurückziehen.Ich gestatte mir an dieser Stelle ein Thema flüchtig zu
berühren, welches die gründlichste Behandlung verdienen würde.
Der Kantsche Satz, daß Zeit und Raum notwendige Formen
unseres Denkens sind, kann heute infolge gewisser psychoanalytischerS.
216
Erkenntnisse einer Diskussion unterzogen werden. Wir
haben erfahren, daß die unbewußten Seelenvorgänge an sich
„zeitlos“ sind. Das heißt zunächst, daß sie nicht zeitlich geordnet
werden, daß die Zeit nichts von ihnen verändert, daß man die
Zeitvorstellung nicht an sie heranbringen kann. Es sind dies
negative Charaktere, die man sich nur durch Vergleichung mit
den bewußten seelischen Prozessen deutlich machen kann. Unsere
abstrakte Zeitvorstellung scheint vielmehr durchaus von der
Arbeitsweise des Systems W‑Bw hergeholt zu sein und einer
Selbstwahrnehmung derselben zu entsprechen. Bei dieser
Funktionsweise des Systems dürfte ein anderer Weg des Reiz-
schutzes beschritten werden. Ich weiß, daß diese Behauptungen
sehr dunkel klingen, muß mich aber auf solche Andeutungen
beschränken.Wir haben bisher ausgeführt, daß das lebende Bläschen mit
einem Reizschutz gegen die Außenwelt ausgestattet ist. Vorhin
hatten wir festgelegt, daß die nächste Rindenschicht desselben als
Organ zur Reizaufnahme von außen differenziert sein muß. Diese
empfindliche Rindenschicht, das spätere System Bw, empfängt
aber auch Erregungen von innen her; die Stellung des Systems
zwischen außen und innen und die Verschiedenheit der Bedin-
gungen für die Einwirkung von der einen und der anderen
Seite werden maßgebend für die Leistung des Systems und des
ganzen seelischen Apparates. Gegen außen gibt es einen Reiz-
schutz, die ankommenden Erregungsgrößen werden nur in ver-
kleinertem Maßstab wirken; nach innen zu ist der Reizschutz
unmöglich, die Erregungen der tieferen Schichten setzen sich
direkt und in unverringertem Maße auf das System fort, indem
gewisse Charaktere ihres Ablaufes die Reihe der Lust‑Unlust-
empfindungen erzeugen. Allerdings werden die von innen
kommenden Erregungen nach ihrer Intensität und nach anderen
qualitativen Charakteren (eventuell nach ihrer Amplitude) der
Arbeitsweise des Systems adaequater sein als die von der AußenweltS.
217
zuströmenden Reize. Aber zweierlei ist durch diese Ver-
hältnisse entscheidend bestimmt, erstens die Praevalenz der Lust‑
und Unlustempfindungen, die ein Index für Vorgänge im Innern
des Apparates sind, über alle äußeren Reize, und zweitens eine
Richtung des Verhaltens gegen solche innere Erregungen, welche
allzu große Unlustvermehrung herbeiführen. Es wird sich die
Neigung ergeben, sie so zu behandeln, als ob sie nicht von innen,
sondern von außen her einwirkten, um die Abwehrmittel des
Reizschutzes gegen sie in Anwendung bringen zu können. Dies
ist die Herkunft der Projektion, der eine so große Rolle bei
der Verursachung pathologischer Prozesse vorbehalten ist.Ich habe den Eindruck, daß wir durch die letzten Über-
legungen die Herrschaft des Lustprinzips unserem Verständnis
angenähert haben; eine Aufklärung jener Fälle, die sich ihm
widersetzen, haben wir aber nicht erreicht. Gehen wir darum
einen Schritt weiter. Solche Erregungen von außen, die stark
genug sind, den Reizschutz zu durchbrechen, heißen wir
traumatische. Ich glaube, daß der Begriff des Traumas eine
solche Beziehung auf eine sonst wirksame Reizabhaltung erfordert.
Ein Vorkommnis wie das äußere Trauma wird gewiß eine groß-
artige Störung im Energiebetrieb des Organismus hervorrufen
und alle Abwehrmittel in Bewegung setzen. Aber das Lust-
prinzip ist dabei zunächst außer Kraft gesetzt. Die Über-
schwemmung des seelischen Apparates mit großen Reizmengen
ist nicht mehr hintanzuhalten; es ergibt sich vielmehr eine
andere Aufgabe, den Reiz zu bewältigen, die hereingebrochenen
Reizmengen psychisch zu binden, um sie dann der Erledigung
zuzuführen.Wahrscheinlich ist die spezifische Unlust des körperlichen
Schmerzes der Erfolg davon, daß der Reizschutz in beschränktem
Umfange durchbrochen wurde. Von dieser Stelle der Peripherie
strömen dann dem seelischen Zentralapparat kontinuierliche
Erregungen zu, wie sie sonst nur aus dem Innern des ApparatesS.
218
kommen konnten.1 Und was können wir als die Reaktion des
Seelenlebens auf diesen Einbruch erwarten? Von allen Seiten her
wird die Besetzungsenergie aufgeboten, um in der Umgebung
der Einbruchstelle entsprechend hohe Energiebesetzungen zu
schaffen. Es wird eine großartige „Gegenbesetzung“ hergestellt,
zu deren Gunsten alle anderen psychischen Systeme verarmen,
so daß eine ausgedehnte Lähmung oder Herabsetzung der
sonstigen psychischen Leistung erfolgt. Wir suchen aus solchen
Beispielen zu lernen, unsere metapsychologischen Vermutungen
an solche Vorbilder anzulehnen. Wir ziehen also aus diesem
Verhalten den Schluß, daß ein selbst hochbesetztes System
imstande ist, neu hinzukommende strömende Energie aufzu-
nehmen, sie in ruhende Besetzung umzuwandeln, also sie psychisch
zu „binden“. Je höher die eigene ruhende Besetzung ist, desto
größer wäre auch ihre bindende Kraft; umgekehrt also, je
niedriger seine Besetzung ist, desto weniger wird das System
für die Aufnahme zuströmender Energie befähigt sein, desto
gewaltsamer müssen dann die Folgen eines solchen Durchbruches
des Reizschutzes sein. Man wird gegen diese Auffassung nicht
mit Recht einwenden, daß die Erhöhung der Besetzung um die
Einbruchsstelle sich weit einfacher aus der direkten Fortleitung
der ankommenden Erregungsmengen erkläre. Wenn dem so
wäre, so würde der seelische Apparat ja nur eine Vermehrung
seiner Energiebesetzungen erfahren, und der lähmende Charakter
des Schmerzes, die Verarmung aller anderen Systeme bliebe
unaufgeklärt. Auch die sehr heftigen Abfuhrwirkungen des
Schmerzes stören unsere Erklärung nicht, denn sie gehen reflek-
torisch vor sich, das heißt, sie erfolgen ohne Vermittlung des
seelischen Apparats. Die Unbestimmtheit all unserer Erörterungen,
die wir metapsychologische heißen, rührt natürlich daher, daß
wir nichts über die Natur des Erregungsvorganges in den Ele-
menten der psychischen Systeme wissen und uns zu keiner1) Vgl. Triebe und Triebschicksale. [Ges. Schriften. Bd. V.]
S.
219
Annahme darüber berechtigt fühlen. So operieren wir also stets
mit einem großen X, welches wir in jede neue Formel mit
hinübernehmen. Daß dieser Vorgang sich mit quantitativ ver-
schiedenen Energien vollzieht, ist eine leicht zulässige Forderung,
daß er auch mehr als eine Qualität (zum Beispiel in der Art
einer Amplitude) hat, mag uns wahrscheinlich sein; als neu haben
wir die Aufstellung Breuers in Betracht gezogen, daß es sich
um zweierlei Formen der Energieerfüllung handelt, so daß eine
freiströmende, nach Abfuhr drängende, und eine ruhende
Besetzung der psychischen Systeme (oder ihrer Elemente) zu
unterscheiden ist. Vielleicht geben wir der Vermutung Raum,
daß die „Bindung“ der in den seelischen Apparat einströmenden
Energie in einer Überführung aus dem frei strömenden in den
ruhenden Zustand besteht.Ich glaube, man darf den Versuch wagen, die gemeine
traumatische Neurose als die Folge eines ausgiebigen Durchbruchs
des Reizschutzes aufzufassen. Damit wäre die alte, naive Lehre
vom Schock in ihre Rechte eingesetzt, anscheinend im Gegen-
satz zu einer späteren und psychologisch anspruchsvolleren, welche
nicht der mechanischen Gewalteinwirkung, sondern dem Schreck
und der Lebensbedrohung die ätiologische Bedeutung zuspricht.
Allein diese Gegensätze sind nicht unversöhnlich, und die psycho-
analytische Auffassung der traumatischen Neurose ist mit der
rohesten Form der Schocktheorie nicht identisch. Versetzt letztere
das Wesen des Schocks in die direkte Schädigung der molekularen
Struktur, oder selbst der histologischen Struktur der nervösen
Elemente, so suchen wir dessen Wirkung aus der Durchbrechung
des Reizschutzes für das Seelenorgan und aus den daraus sich
ergebenden Aufgaben zu verstehen. Der Schreck behält seine
Bedeutung auch für uns. Seine Bedingung ist das Fehlen der
Angstbereitschaft, welche die Überbesetzung der den Reiz zunächst
aufnehmenden Systeme miteinschließt. Infolge dieser niedrigeren
Besetzung sind die Systeme dann nicht gut imstande, dieS.
220
ankommenden Erregungsmengen zu binden, die Folgen der Durch-
brechung des Reizschutzes stellen sich um so vieles leichter ein.
Wir finden so, daß die Angstbereitschaft mit der Überbesetzung
der aufnehmenden Systeme die letzte Linie des Reizschutzes
darstellt. Für eine ganze Anzahl von Traumen mag der Unter-
schied zwischen den unvorbereiteten und den durch Über-
besetzung vorbereiteten Systemen das für den Ausgang entschei-
dende Moment sein; von einer gewissen Stärke des Traumas an
wird er wohl nicht mehr ins Gewicht fallen. Wenn die Träume
der Unfallsneurotiker die Kranken so regelmäßig in die Situation
des Unfalles zurückführen, so dienen sie damit allerdings nicht
der Wunscherfüllung, deren halluzinatorische Herbeiführung ihnen
unter der Herrschaft des Lustprinzips zur Funktion geworden
ist. Aber wir dürfen annehmen, daß sie sich dadurch einer
anderen Aufgabe zur Verfügung stellen, deren Lösung voran-
gehen muß, ehe das Lustprinzip seine Herrschaft beginnen kann.
Diese Träume suchen die Reizbewältigung unter Angstentwick-
lung nachzuholen, deren Unterlassung die Ursache der trauma-
tischen Neurose geworden ist. Sie geben uns so einen Ausblick
auf eine Funktion des seelischen Apparats, welche, ohne dem
Lustprinzip zu widersprechen, doch unabhängig von ihm ist und
ursprünglicher scheint als die Absicht des Lustgewinns und der
Unlustvermeidung.Hier wäre also die Stelle, zuerst eine Ausnahme von dem
Satze, der Traum ist eine Wunscherfüllung, zuzugestehen. Die
Angstträume sind keine solche Ausnahme, wie ich wiederholt
und eingehend gezeigt habe, auch die „Strafträume“ nicht, denn
diese setzen nur an die Stelle der verpönten Wunscherfüllung
die dafür gebührende Strafe, sind also die Wunscherfüllung des
auf den verworfenen Trieb reagierenden Schuldbewußtseins.
Aber die obenerwähnten Träume der Unfallsneurotiker lassen
sich nicht mehr unter den Gesichtspunkt der Wunscherfüllung
bringen, und ebensowenig die in den Psychoanalysen vorfallendenS.
221
Träume, die uns die Erinnerung der psychischen Traumen der
Kindheit wiederbringen. Sie gehorchen vielmehr dem Wieder-
holungszwang, der in der Analyse allerdings durch den von der
„Suggestion“ geförderten Wunsch, das Vergessene und Verdrängte
heraufzubeschwören, unterstützt wird. So wäre also auch die
Funktion des Traumes, Motive zur Unterbrechung des Schlafes
durch Wunscherfüllung der störenden Regungen zu beseitigen,
nicht seine ursprüngliche; er konnte sich ihrer erst bemächtigen,
nachdem das gesamte Seelenleben die Herrschaft des Lustprinzips
angenommen hatte. Gibt es ein „Jenseits des Lustprinzips“, so
ist es folgerichtig, auch für die wunscherfüllende Tendenz des
Traumes eine Vorzeit zuzulassen. Damit wird seiner späteren
Funktion nicht widersprochen. Nur erhebt sich, wenn diese
Tendenz einmal durchbrochen ist, die weitere Frage: Sind
solche Träume, welche im Interesse der psychischen Bindung
traumatischer Eindrücke dem Wiederholungszwange folgen, nicht
auch außerhalb der Analyse möglich? Dies ist durchaus zu
bejahen.Von den „Kriegsneurosen“, soweit diese Bezeichnung mehr als
die Beziehung zur Veranlassung des Leidens bedeutet, habe ich
an anderer Stelle ausgeführt, daß sie sehr wohl traumatische
Neurosen sein könnten, die durch einen Ichkonflikt erleichtert
worden sind.1 Die auf Seite 198 erwähnte Tatsache, daß eine
gleichzeitige grobe Verletzung durch das Trauma die Chance für
die Entstehung einer Neurose verringert, ist nicht mehr unver-
ständlich, wenn man zweier von der psychoanalytischen Forschung
betonter Verhältnisse gedenkt. Erstens, daß mechanische Erschütte-
rung als eine der Quellen der Sexualerregung anerkannt werden muß
(vgl. die Bemerkungen über die Wirkung des Schaukelns und
Eisenbahnfahrens in „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“
Ges. Schriften, Bd. V), und zweitens, daß dem schmerzhaften1) Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen. Einleitung. Internationale Psychoana-
lytische Bibliothek, Nr. 1, 1919. [Ges. Schriften, Bd. IX.]S.
222
und fieberhaften Kranksein während seiner Dauer ein mächtiger
Einfluß auf die Verteilung der Libido zukommt. So würde also
die mechanische Gewalt des Traumas das Quantum Sexual-
erregung frei machen, welches infolge der mangelnden Angst-
vorbereitung traumatisch wirkt, die gleichzeitige Körperverletzung
würde aber durch die Anspruchnahme einer narzißtischen Über-
besetzung des leidenden Organs den Überschuß an Erregung
binden (s. „Zur Einführung des Narzißmus“, Ges. Schriften,
Bd. VI). Es ist auch bekannt, aber für die Libidotheorie nicht
genügend verwertet worden, daß so schwere Störungen in der
Libidoverteilung wie die einer Melancholie durch eine inter-
kurrente organische Erkrankung zeitweilig aufgehoben werden,
ja, daß sogar der Zustand einer voll entwickelten Dementia
praecox unter der nämlichen Bedingung einer vorübergehenden
Rückbildung fähig ist.S.
223
V
Der Mangel eines Reizschutzes für die reizaufnehmende
Rindenschicht gegen Erregungen von innen her wird die Folge
haben müssen, daß diese Reizübertragungen die größere ökonomische
Bedeutung gewinnen und häufig zu ökonomischen Störungen
Anlaß geben, die den traumatischen Neurosen gleichzustellen
sind. Die ausgiebigsten Quellen solch innerer Erregung sind die
sogenannten Triebe des Organismus, die Repräsentanten aller aus
dem Körperinnern stammenden, auf den seelischen Apparat über-
tragenen Kraftwirkungen, selbst das wichtigste wie das dunkelste
Element der psychologischen Forschung.Vielleicht finden wir die Annahme nicht zu gewagt, daß die
von den Trieben ausgehenden Regungen nicht den Typus des
gebundenen, sondern den des frei beweglichen, nach Abfuhr
drängenden Nervenvorganges einhalten. Das Beste, was wir über
diese Vorgänge wissen, rührt aus dem Studium der Traumarbeit
her. Dabei fanden wir, daß die Prozesse in den unbewußten
Systemen von denen in den (vor‑)bewußten gründlich verschieden
sind, daß im Unbewußten Besetzungen leicht vollständig über-
tragen, verschoben, verdichtet werden können, was nur fehler-
hafte Resultate ergeben könnte, wenn es an vorbewußtem Material
geschähe, und was darum auch die bekannten Sonderbarkeiten
des manifesten Traums ergibt, nachdem die vorbewußten Tages-
reste die Bearbeitung nach den Gesetzen des Unbewußten
erfahren haben. Ich nannte die Art dieser Prozesse im Unbe-
wußten den psychischen „Primärvorgang“ zum Unterschied vonS.
224
dem für unser normales Wachleben gültigen Sekundärvorgang.
Da die Triebregungen alle an den unbewußten Systemen
angreifen, ist es kaum eine Neuerung, zu sagen, daß sie dem
Primärvorgang folgen, und anderseits gehört wenig dazu, um
den psychischen Primärvorgang mit der frei beweglichen
Besetzung, den Sekundärvorgang mit den Veränderungen an der
gebundenen oder tonischen Besetzung Breuers zu identifizieren.1
Es wäre dann die Aufgabe der höheren Schichten des seelischen
Apparates, die im Primärvorgang anlangende Erregung der Triebe
zu binden. Das Mißglücken dieser Bindung würde eine der
traumatischen Neurose analoge Störung hervorrufen; erst nach
erfolgter Bindung könnte sich die Herrschaft des Lustprinzips
(und seiner Modifikation zum Realitätsprinzip) ungehemmt durch-
setzen. Bis dahin aber würde die andere Aufgabe des Seelen-
apparates, die Erregung zu bewältigen oder zu binden,
voranstehen, zwar nicht im Gegensatz zum Lustprinzip, aber
unabhängig von ihm und zum Teil ohne Rücksicht auf dieses.Die Äußerungen eines Wiederholungszwanges, die wir an den
frühen Tätigkeiten des kindlichen Seelenlebens wie an den
Erlebnissen der psychoanalytischen Kur beschrieben haben, zeigen
im hohen Grade den triebhaften, und wo sie sich im Gegensatz
zum Lustprinzip befinden, den dämonischen Charakter. Beim
Kinderspiel glauben wir es zu begreifen, daß das Kind auch das
unlustvolle Erlebnis darum wiederholt, weil es sich durch seine
Aktivität eine weit gründlichere Bewältigung des starken Ein-
druckes erwirbt, als beim bloß passiven Erleben möglich war.
Jede neuerliche Wiederholung scheint diese angestrebte Beherr-
schung zu verbessern, und auch bei lustvollen Erlebnissen kann
sich das Kind an Wiederholungen nicht genug tun und wird
unerbittlich auf der Identität des Eindruckes bestehen. Dieser
Charakterzug ist dazu bestimmt, späterhin zu verschwinden. Ein1) Vgl. den Abschnitt VII, Psychologie der Traumvorgänge in meiner „Traum-
deutung“. [Ges. Schriften, Bd. II.]S.
225
zum zweitenmal angehörter Witz wird fast wirkungslos bleiben,
eine Theateraufführung wird nie mehr zum zweitenmal den
Eindruck erreichen, denn sie das erstemal hinterließ; ja, der
Erwachsene wird schwer zu bewegen sein, ein Buch, das ihm
sehr gefallen hat, sobald nochmals durchzulesen. Immer wird die
Neuheit die Bedingung des Genusses sein. Das Kind aber wird
nicht müde werden, vom Erwachsenen die Wiederholung eines
ihm gezeigten oder mit ihm angestellten Spieles zu verlangen,
bis dieser erschöpft es verweigert, und wenn man ihm eine
schöne Geschichte erzählt hat, will es immer wieder die nämliche
Geschichte, anstatt einer neuen hören, besteht unerbittlich auf
der Identität der Wiederholung und verbessert jede Abänderung,
die sich der Erzähler zuschulden kommen läßt, mit der er sich
vielleicht sogar ein neues Verdienst erwerben wollte. Dem Lust-
prinzip wird dabei nicht widersprochen; es ist sinnfällig, daß die
Wiederholung, das Wiederfinden der Identität, selbst eine Lust-
quelle bedeutet. Beim Analysierten hingegen wird es klar, daß
der Zwang, die Begebenheiten seiner infantilen Lebensperiode in
der Übertragung zu wiederholen, sich in jeder Weise über
das Lustprinzip hinaussetzt. Der Kranke benimmt sich dabei
völlig wie infantil und zeigt uns so, daß die verdrängten
Erinnerungsspuren seiner urzeitlichen Erlebnisse nicht im gebun-
denen Zustande in ihm vorhanden, ja gewissermaßen des
Sekundärvorganges nicht fähig sind. Dieser Ungebundenheit ver-
danken sie auch ihr Vermögen, durch Anheftung an die Tages-
reste eine im Traum darzustellende Wunschphantasie zu bilden.
Derselbe Wiederholungszwang tritt uns so oft als therapeutisches
Hindernis entgegen, wenn wir zu Ende der Kur die völlige
Ablösung vom Arzte durchsetzen wollen, und es ist anzunehmen,
daß die dunkle Angst der mit der Analyse nicht Vertrauten,
die sich scheuen irgend etwas aufzuwecken, was man nach ihrer
Meinung besser schlafen ließe, im Grunde das Auftreten dieses
dämonischen Zwanges fürchtet.S.
226
Auf welche Art hängt aber das Triebhafte mit dem Zwang
zur Wiederholung zusammen? Hier muß sich uns die Idee auf-
drängen, daß wir einem allgemeinen, bisher nicht klar erkannten
– oder wenigstens nicht ausdrücklich betonten – Charakter
der Triebe, vielleicht alles organischen Lebens überhaupt, auf die
Spur gekommen sind. Ein Trieb wäre also ein dem
belebten Organischen innewohnender Drang
zur Wiederherstellung eines früheren Zu-
standes, welchen dies Belebte unter dem Einflusse äußerer
Störungskräfte aufgeben mußte, eine Art von organischer Elasti-
zität, oder wenn man will, die Äußerung der Trägheit im orga-
nischen Leben.1Diese Auffassung des Triebes klingt befremdlich, denn wir
haben uns daran gewöhnt, im Triebe das zur Veränderung und
Entwicklung drängende Moment zu sehen, und sollen nun das
gerade Gegenteil in ihm erkennen, den Ausdruck der konser-
vativen Natur des Lebenden. Anderseits fallen uns sehr bald
jene Beispiele aus dem Tierleben ein, welche die historische
Bedingtheit der Triebe zu bestätigen scheinen. Wenn gewisse
Fische um die Laichzeit beschwerliche Wanderungen unter-
nehmen, um den Laich in bestimmten Gewässern, weit entfernt
von ihren sonstigen Aufenthalten, abzulegen, so haben sie nach
der Deutung vieler Biologen nur die früheren Wohnstätten
ihrer Art aufgesucht, die sie im Laufe der Zeit gegen andere
vertauscht hatten. Dasselbe soll für die Wanderflüge der Zug-
vögel gelten, aber der Suche nach weiteren Beispielen enthebt
uns bald die Mahnung, daß wir in den Phänomenen der Erb-
lichkeit und in den Tatsachen der Embryologie die großartigsten
Beweise für den organischen Wiederholungszwang haben. Wir
sehen, der Keim eines lebenden Tieres ist genötigt, in seiner
Entwicklung die Strukturen all der Formen, von denen das Tier1) Ich bezweifle nicht, daß ähnliche Vermutungen über die Natur der „Triebe“
bereits wiederholt geäußert worden sind.S.
227
abstammt – wenn auch in flüchtiger Abkürzung – zu wieder-
holen, anstatt auf dem kürzesten Wege zu seiner definitiven
Gestaltung zu eilen, und können dies Verhalten nur zum
geringsten Teile mechanisch erklären, dürfen die historische
Erklärung nicht beiseite lassen. Und ebenso erstreckt sich weit
in die Tierreihe hinauf ein Reproduktionsvermögen, welches ein
verlorenes Organ durch die Neubildung eines ihm durchaus
gleichen ersetzt.Der naheliegende Einwand, es verhalte sich wohl so, daß es
außer den konservativen Trieben, die zur Wiederholung nötigen,
auch andere gibt, die zur Neugestaltung und zum Fortschritt
drängen, darf gewiß nicht unberücksichtigt bleiben; er soll
auch späterhin in unsere Erwägungen einbezogen werden.
Aber vorher mag es uns verlocken, die Annahme, daß
alle Triebe Früheres wiederherstellen wollen, in ihre letzten
Konsequenzen zu verfolgen. Mag, was dabei herauskommt,
den Anschein des „Tiefsinnigen“ erwecken oder an Mystisches
anklingen, so wissen wir uns doch von dem Vorwurf frei,
etwas Derartiges angestrebt zu haben. Wir suchen nüchterne
Resultate der Forschung oder der auf sie gegründeten Über-
legung, und unser Wunsch möchte diesen keinen anderen
Charakter als den der Sicherheit verleihen.1Wenn also alle organischen Triebe konservativ, historisch
erworben und auf Regression, Wiederherstellung von Früherem,
gerichtet sind, so müssen wir die Erfolge der organischen Ent-
wicklung auf die Rechnung äußerer, störender und ablenkender
Einflüsse setzen. Das elementare Lebewesen würde sich von
seinem Anfang an nicht haben ändern wollen, hätte unter sich
gleichbleibenden Verhältnissen stets nur den nämlichen Lebens-
lauf wiederholt. Aber im letzten Grunde müßte es die Entwicklungsgeschichte1) Man möge nicht übersehen, daß das folgende die Entwicklung eines extremen
Gedankenganges ist, der späterhin, wenn die Sexualtriebe in Betracht gezogen werden,
Einschränkung und Berichtigung findet.S.
228
unserer Erde und ihres Verhältnisses zur
Sonne sein, die uns in der Entwicklung der Organismen ihren
Abdruck hinterlassen hat. Die konservativen organischen Triebe
haben jede dieser aufgezwungenen Abänderungen des Lebenslaufes
aufgenommen und zur Wiederholung aufbewahrt und müssen so
den täuschenden Eindruck von Kräften machen, die nach Ver-
änderung und Fortschritt streben, während sie bloß ein altes Ziel
auf alten und neuen Wegen zu erreichen trachten. Auch dieses
Endziel alles organischen Strebens ließe sich angeben. Der
konservativen Natur der Triebe widerspräche es, wenn das Ziel
des Lebens ein noch nie zuvor erreichter Zustand wäre. Es muß
vielmehr ein alter, ein Ausgangszustand sein, den das Lebende
einmal verlassen hat, und zu dem es über alle Umwege der
Entwicklung zurückstrebt. Wenn wir es als ausnahmslose Erfahrung
annehmen dürfen, daß alles Lebende aus inneren Gründen
stirbt, ins Anorganische zurückkehrt, so können wir nur sagen:
Das Ziel alles Lebens ist der Tod, und zurückgreifend:
Das Leblose war früher da als das Lebende.Irgend einmal wurden in unbelebter Materie durch eine noch
ganz unvorstellbare Krafteinwirkung die Eigenschaften des Lebenden
erweckt. Vielleicht war es ein Vorgang, vorbildlich ähnlich jenem
anderen, der in einer gewissen Schicht der lebenden Materie
später das Bewußtsein entstehen ließ. Die damals entstandene
Spannung in dem vorhin unbelebten Stoff trachtete darnach sich
abzugleichen; es war der erste Trieb gegeben, der, zum Leblosen
zurückzukehren. Die damals lebende Substanz hatte das Sterben
noch leicht, es war wahrscheinlich nur ein kurzer Lebensweg zu
durchlaufen, dessen Richtung durch die chemische Struktur des
jungen Lebens bestimmt war. Eine lange Zeit hindurch mag so
die lebende Substanz immer wieder neu geschaffen worden und
leicht gestorben sein, bis sich maßgebende äußere Einflüsse so
änderten, daß sie die noch überlebende Substanz zu immer
größeren Ablenkungen vom ursprünglichen Lebensweg und zu immerS.
229
komplizierteren Umwegen bis zur Erreichung des Todeszieles
nötigten. Diese Umwege zum Tode, von den konservativen Trieben
getreulich festgehalten, böten uns heute das Bild der Lebens-
erscheinungen. Wenn man an der ausschließlich konservativen
Natur der Triebe festhält, kann man zu anderen Vermutungen
über Herkunft und Ziel des Lebens nicht gelangen.Ebenso befremdend wie diese Folgerungen klingt dann, was
sich für die großen Gruppen von Trieben ergibt, die wir hinter
den Lebenserscheinungen der Organismen statuieren. Die Auf-
stellung der Selbsterhaltungstriebe, die wir jedem lebenden Wesen
zugestehen, steht in merkwürdigem Gegensatz zur Voraussetzung,
daß das gesamte Triebleben der Herbeiführung des Todes dient.
Die theoretische Bedeutung der Selbsterhaltungs‑, Macht‑ und
Geltungstriebe schrumpft, in diesem Licht gesehen, ein; es sind
Partialtriebe, dazu bestimmt, den eigenen Todesweg des Organismus
zu sichern und andere Möglichkeiten der Rückkehr zum An-
organischen als die immanenten fernzuhalten, aber das rätselhafte,
in keinen Zusammenhang einfügbare Bestreben des Organismus
sich aller Welt zum Trotz zu behaupten, entfällt. Es erübrigt,
daß der Organismus nur auf seine Weise sterben will; auch
diese Lebenswächter sind ursprünglich Trabanten des Todes
gewesen. Dabei kommt das Paradoxe zustande, daß der lebende
Organismus sich auf das energischeste gegen Einwirkungen
(Gefahren) sträubt, die ihm dazu verhelfen könnten, sein Lebens-
ziel auf kurzem Wege (durch Kurzschluß sozusagen) zu erreichen,
aber dies Verhalten charakterisiert eben ein rein triebhaftes im
Gegensatz zu einem intelligenten Streben.Aber besinnen wir uns, dem kann nicht so sein! In ein ganz
anderes Licht rücken die Sexualtriebe, für welche die Neurosen-
lehre eine Sonderstellung in Anspruch genommen hat. Nicht
alle Organismen sind dem äußeren Zwang unterlegen, der sie zu
immer weiter gehender Entwicklung antrieb. Vielen ist es gelungen,
sich auf ihrer niedrigen Stufe bis auf die Gegenwart zu bewahren;S.
230
es leben ja noch heute, wenn nicht alle, so doch viele Lebewesen,
die den Vorstufen der höheren Tiere und Pflanzen ähnlich sein
müssen. Und ebenso machen nicht alle Elementarorganismen,
welche den komplizierten Leib eines höheren Lebewesens zusammen-
setzen, den ganzen Entwicklungsweg bis zum natürlichen Tode
mit. Einige unter ihnen, die Keimzellen, bewahren wahrscheinlich
die ursprüngliche Struktur der lebenden Substanz und lösen sich,
mit allen ererbten und neu erworbenen Triebanlagen beladen,
nach einer gewissen Zeit vom ganzen Organismus ab. Vielleicht
sind es gerade diese beiden Eigenschaften, die ihnen ihre
selbständige Existenz ermöglichen. Unter günstige Bedingungen
gebracht, beginnen sie sich zu entwickeln, das heißt, das Spiel,
dem sie ihre Entstehung verdanken, zu wiederholen, und dies
endet damit, daß wieder ein Anteil ihrer Substanz die Entwicklung
bis zum Ende fortführt, während ein anderer als neuer Keimrest
von neuem auf den Anfang der Entwicklung zurückgreift. So
arbeiten diese Keimzellen dem Sterben der lebenden Substanz
entgegen und wissen für sie zu erringen, was uns als potentielle
Unsterblichkeit erscheinen muß, wenngleich es vielleicht nur eine
Verlängerung des Todesweges bedeutet. Im höchsten Grade
bedeutungsvoll ist uns die Tatsache, daß die Keimzelle für diese
Leistung durch die Verschmelzung mit einer anderen, ihr ähn-
lichen und doch von ihr verschiedenen, gekräftigt oder überhaupt
erst befähigt wird.Die Triebe, welche die Schicksale dieser das Einzelwesen über-
lebenden Elementarorganismen in acht nehmen, für ihre sichere
Unterbringung sorgen, solange sie wehrlos gegen die Reize der
Außenwelt sind, ihr Zusammentreffen mit den anderen Keim-
zellen herbeiführen usw., bilden die Gruppe der Sexualtriebe. Sie
sind in demselben Sinne konservativ wie die anderen, indem sie
frühere Zustände der lebenden Substanz wiederbringen, aber sie
sind es in stärkerem Maße, indem sie sich als besonders resistent
gegen äußere Einwirkungen erweisen, und dann noch in einemS.
231
weiteren Sinne, da sie das Leben selbst für längere Zeiten
erhalten.1 Sie sind die eigentlichen Lebenstriebe; dadurch, daß
sie der Absicht der anderen Triebe, welche durch die Funktion
zum Tode führt, entgegenwirken, deutet sich ein Gegensatz
zwischen ihnen und den übrigen an, den die Neurosenlehre
frühzeitig als bedeutungsvoll erkannt hat. Es ist wie ein Zauder-
rhythmus im Leben der Organismen; die eine Triebgruppe stürmt
nach vorwärts, um das Endziel des Lebens möglichst bald zu
erreichen, die andere schnellt an einer gewissen Stelle dieses
Weges zurück, um ihn von einem bestimmten Punkt an nochmals
zu machen und so die Dauer des Weges zu verlängern. Aber
wenn auch Sexualität und Unterschied der Geschlechter zu Beginn
des Lebens gewiß nicht vorhanden waren, so bleibt es doch
möglich, daß die später als sexuell zu bezeichnenden Triebe von
allem Anfang an in Tätigkeit getreten sind und ihre Gegenarbeit
gegen das Spiel der „Ichtriebe“ nicht erst zu einem späteren
Zeitpunkte aufgenommen haben.2Greifen wir nun selbst ein erstes Mal zurück, um zu fragen,
ob nicht alle diese Spekulationen der Begründung entbehren.
Gibt es wirklich, abgesehen von den Sexualtrieben,
keine anderen Triebe als solche, die einen früheren Zustand
wiederherstellen wollen, nicht auch andere, die nach einem noch
nie erreichten streben? Ich weiß in der organischen Welt kein
sicheres Beispiel, das unserer vorgeschlagenen Charakteristik wider-
spräche. Ein allgemeiner Trieb zur Höherentwicklung in der
Tier‑ und Pflanzenwelt läßt sich gewiß nicht feststellen, wenn
auch eine solche Entwicklungsrichtung tatsächlich unbestritten
bleibt. Aber einerseits ist es vielfach nur Sache unserer Ein-
schätzung, wenn wir eine Entwicklungsstufe für höher als eine1) Und doch sind sie es, die wir allein für eine innere Tendenz zum „Fortschritt“
und zur Höherentwicklung in Anspruch nehmen können! (S. u.)2) Es sollte aus dem Zusammenhange verstanden werden, daß „Ichtriebe“ hier
als eine vorläufige Bezeichnung gemeint sind, welche an die erste Namengebung
der Psychoanalyse anknüpft.S.
232
andere erklären, und anderseits zeigt uns die Wissenschaft des
Lebenden, daß Höherentwicklung in einem Punkte sehr häufig
durch Rückbildung in einem anderen erkauft oder wettgemacht
wird. Auch gibt es Tierformen genug, deren Jugendzustände uns
erkennen lassen, daß ihre Entwicklung vielmehr einen rück-
schreitenden Charakter genommen hat. Höherentwicklung wie
Rückbildung könnten beide Folgen der zur Anpassung drängenden
äußeren Kräfte sein und die Rolle der Triebe könnte sich für
beide Fälle darauf beschränken, die aufgezwungene Veränderung
als innere Lustquelle festzuhalten.1Vielen von uns mag es auch schwer werden, auf den Glauben zu
verzichten, daß im Menschen selbst ein Trieb zur Vervollkommnung
wohnt, der ihn auf seine gegenwärtige Höhe geistiger Leistung und
ethischer Sublimierung gebracht hat, und von dem man erwarten
darf, daß er seine Entwicklung zum Übermenschen besorgen
wird. Allein ich glaube nicht an einen solchen inneren Trieb
und sehe keinen Weg, diese wohltuende Illusion zu schonen. Die
bisherige Entwicklung des Menschen scheint mir keiner anderen
Erklärung zu bedürfen als die der Tiere, und was man an einer
Minderzahl von menschlichen Individuen als rastlosen Drang zu
weiterer Vervollkommnung beobachtet, läßt sich ungezwungen
als Folge der Triebverdrängung verstehen, auf welche das Wert-
vollste an der menschlichen Kultur aufgebaut ist. Der verdrängte
Trieb gibt es nie auf, nach seiner vollen Befriedigung zu streben,
die in der Wiederholung eines primären Befriedigungserlebnisses
bestünde; alle Ersatz‑, Reaktionsbildungen und Sublimierungen
sind ungenügend, um seine anhaltende Spannung aufzuheben,
und aus der Differenz zwischen der gefundenen und der geforderten1) Auf anderem Wege ist Ferenczi zur Möglichkeit derselben Auffassung
gelangt (Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes, Internationale Zeitschrift für
Psychoanalyse, I, 1913): „Bei konsequenter Durchführung dieses Gedankenganges
muß man sich mit der Idee einer auch das organische Leben beherrschenden
Beharrungs‑, respektive Regressionstendenz vertraut machen, während die Tendenz
nach Fortentwicklung, Anpassung usw. nur auf äußere Reize hin lebendig wird.“
(S. 137.)S.
233
Befriedigungslust ergibt sich das treibende Moment, welches
bei keiner der hergestellten Situationen zu verharren gestattet,
sondern nach des Dichters Worten „ungebändigt immer vorwärts
dringt“ (Mephisto im „Faust“, I, Studierzimmer). Der Weg nach
rückwärts, zur vollen Befriedigung, ist in der Regel durch die
Widerstände, welche die Verdrängungen aufrecht halten, verlegt,
und somit bleibt nichts anderes übrig, als in der anderen, noch
freien Entwicklungsrichtung fortzuschreiten, allerdings ohne Aus-
sicht, den Prozeß abschließen und das Ziel erreichen zu können.
Die Vorgänge bei der Ausbildung einer neurotischen Phobie, die
ja nichts anderes als ein Fluchtversuch vor einer Triebbefriedigung
ist, geben uns das Vorbild für die Entstehung dieses anscheinenden
„Vervollkommnungstriebes“, den wir aber unmöglich allen
menschlichen Individuen zuschreiben können. Die dynamischen
Bedingungen dafür sind zwar ganz allgemein vorhanden, aber
die ökonomischen Verhältnisse scheinen das Phänomen nur in
seltenen Fällen zu begünstigen.Nur mit einem Wort sei aber auf die Wahrscheinlichkeit hin-
gewiesen, daß das Bestreben des Eros, das Organische zu immer
größeren Einheiten zusammenzufassen, einen Ersatz für den nicht
anzuerkennenden „Vervollkommnungstrieb“ leistet. Im Verein mit
den Wirkungen der Verdrängung würde es die dem letzteren
zugeschriebenen Phänomene erklären können.S.
234
VI
Unser bisheriges Ergebnis, welches einen scharfen Gegensatz
zwischen den „Ichtrieben“ und den Sexualtrieben aufstellt, die
ersteren zum Tode und die letzteren zur Lebensfortsetzung drängen
läßt, wird uns gewiß nach vielen Richtungen selbst nicht
befriedigen. Dazu kommt, daß wir eigentlich nur für die ersteren
den konservativen oder besser regredierenden, einem Wieder-
holungszwang entsprechenden Charakter des Triebes in Anspruch
nehmen konnten. Denn nach unserer Annahme rühren die Ich-
triebe von der Belebung der unbelebten Materie her und wollen
die Unbelebtheit wieder herstellen. Die Sexualtriebe hingegen –
es ist augenfällig, daß sie primitive Zustände des Lebewesens
reproduzieren, aber ihr mit allen Mitteln angestrebtes Ziel ist die
Verschmelzung zweier in bestimmter Weise differenzierter Keim-
zellen. Wenn diese Vereinigung nicht zustande kommt, dann
stirbt die Keimzelle wie alle anderen Elemente des vielzelligen
Organismus. Nur unter dieser Bedingung kann die Geschlechts-
funktion das Leben verlängern und ihm den Schein der Unsterb-
lichkeit verleihen. Welches wichtige Ereignis im Entwicklungs-
gang der lebenden Substanz wird aber durch die geschlechtliche
Fortpflanzung oder ihren Vorläufer, die Kopulation zweier Individuen
unter den Protisten, wiederholt? Das wissen wir nicht zu sagen,
und darum würden wir es als Erleichterung empfinden, wenn
unser ganzer Gedankenaufbau sich als irrtümlich erkennen ließe.
Der Gegensatz von Ich(Todes‑)trieben und Sexual(Lebens‑)triebenS.
235
würde dann entfallen, damit auch der Wiederholungszwang die
ihm zugeschriebene Bedeutung einbüßen.Kehren wir darum zu einer von uns eingeflochtenen Annahme
zurück, in der Erwartung, sie werde sich exakt widerlegen lassen.
Wir haben auf Grund der Voraussetzung weitere Schlüsse auf-
gebaut, daß alles Lebende aus inneren Ursachen sterben müsse.
Wir haben diese Annahme so sorglos gemacht, weil sie uns nicht
als solche erscheint. Wir sind gewohnt so zu denken, unsere
Dichter bestärken uns darin. Vielleicht haben wir uns dazu
entschlossen, weil ein Trost in diesem Glauben liegt. Wenn man
schon selbst sterben und vorher seine Liebsten durch den Tod
verlieren soll, so will man lieber einem unerbittlichen Natur-
gesetz, der hehren ’Ανάγκη‚ erlegen sein, als einem Zufall, der
sich etwa noch hätte vermeiden lassen. Aber vielleicht ist dieser
Glaube an die innere Gesetzmäßigkeit des Sterbens auch nur eine
der Illusionen, die wir uns geschaffen haben, „um die Schwere
des Daseins zu ertragen“. Ursprünglich ist er sicherlich nicht,
den primitiven Völkern ist die Idee eines „natürlichen Todes“
fremd; sie führen jedes Sterben unter ihnen auf den Einfluß
eines Feindes oder eines bösen Geistes zurück. Versäumen wir es
darum nicht, uns zur Prüfung dieses Glaubens an die biologische
Wissenschaft zu wenden.Wenn wir so tun, dürfen wir erstaunt sein, wie wenig die Biologen in
der Frage des natürlichen Todes einig sind, ja, daß ihnen der Begriff
des Todes überhaupt unter den Händen zerrinnt. Die Tatsache einer
bestimmten durchschnittlichen Lebensdauer wenigstens bei höheren
Tieren spricht natürlich für den Tod aus inneren Ursachen, aber der
Umstand, daß einzelne große Tiere und riesenhafte Baumgewächse ein
sehr hohes und bisher nicht abschätzbares Alter erreichen, hebt diesen
Eindruck wieder auf. Nach der großartigen Konzeption von
W. Fließ sind alle Lebenserscheinungen – und gewiß auch
der Tod – der Organismen an die Erfüllung bestimmter Termine
gebunden, in denen die Abhängigkeit zweier lebenden Substanzen,S.
236
einer männlichen und einer weiblichen, vom Sonnenjahr zum
Ausdruck kommt. Allein die Beobachtungen, wie leicht und bis
zu welchem Ausmaß es dem Einflusse äußerer Kräfte möglich
ist, die Lebensäußerungen insbesondere der Pflanzenwelt in ihrem
zeitlichen Auftreten zu verändern, sie zu verfrühen oder hint-
anzuhalten, sträuben sich gegen die Starrheit der Fließschen
Formeln und lassen zum mindesten an der Alleinherrschaft der
von ihm aufgestellten Gesetze zweifeln.Das größte Interesse knüpft sich für uns an die Behandlung,
welche das Thema von der Lebensdauer und vom Tode der
Organismen in den Arbeiten von A. Weismann gefunden hat.1
Von diesem Forscher rührt die Unterscheidung der lebenden
Substanz in eine sterbliche und unsterbliche Hälfte her; die
sterbliche ist der Körper im engeren Sinne, das Soma, sie allein
ist dem natürlichen Tode unterworfen, die Keimzellen aber sind
potentia unsterblich, insofern sie imstande sind, unter gewissen
günstigen Bedingungen sich zu einem neuen Individuum zu
entwickeln, oder anders ausgedrückt, sich mit einem neuen Soma zu
umgeben.2Was uns hieran fesselt, ist die unerwartete Analogie mit unserer
eigenen, auf so verschiedenem Wege entwickelten Auffassung.
Weismann, der die lebende Substanz morphologisch betrachtet,
erkennt in ihr einen Bestandteil, der dem Tode verfallen ist, das
Soma, den Körper abgesehen vom Geschlechts‑ und Vererbungs-
stoff, und einen unsterblichen, eben dieses Keimplasma, welches
der Erhaltung der Art, der Fortpflanzung, dient. Wir haben nicht
den lebenden Stoff, sondern die in ihm tätigen Kräfte eingestellt,
und sind dazu geführt worden, zwei Arten von Trieben zu
unterscheiden, jene, welche das Leben zum Tod führen wollen,
die anderen, die Sexualtriebe, welche immer wieder die Erneuerung1) Über die Dauer des Lebens. 1882; Über Leben und Tod, 1892; Das Keim-
plasma, 1892, u. a.2) Über Leben und Tod, 2. Aufl. 1892, S. 20.
S.
237
des Lebens anstreben und durchsetzen. Das klingt wie ein
dynamisches Korollar zu Weismanns morphologischer Theorie.Der Anschein einer bedeutsamen Übereinstimmung verflüchtigt
sich alsbald, wenn wir Weismanns Entscheidung über das
Problem des Todes vernehmen. Denn Weismann läßt die
Sonderung von sterblichem Soma und unsterblichem Keimplasma
erst bei den vielzelligen Organismen gelten, bei den einzelligen
Tieren sind Individuum und Fortpflanzungszelle noch ein‑ und
dasselbe.1 Die Einzelligen erklärt er also für potentiell unsterblich,
der Tod tritt erst bei den Metazoen, den Vielzelligen, auf. Dieser
Tod der höheren Lebewesen ist allerdings ein natürlicher, ein
Tod aus inneren Ursachen, aber er beruht nicht auf einer
Ureigenschaft der lebenden Substanz,2 kann nicht als eine absolute,
im Wesen des Lebens begründete Notwendigkeit aufgefaßt werden.3
Der Tod ist vielmehr eine Zweckmäßigkeitseinrichtung, eine
Erscheinung der Anpassung an die äußeren Lebensbedingungen,
weil von der Sonderung der Körperzellen in Soma und Keim-
plasma an die unbegrenzte Lebensdauer des Individuums ein
ganz unzweckmäßiger Luxus geworden wäre. Mit dem Eintritt
dieser Differenzierung bei den Vielzelligen wurde der Tod möglich
und zweckmäßig. Seither stirbt das Soma der höheren Lebewesen
aus inneren Gründen zu bestimmten Zeiten ab, die Protisten
aber sind unsterblich geblieben. Die Fortpflanzung hingegen ist
nicht erst mit dem Tode eingeführt worden, sie ist vielmehr eine
Ureigenschaft der lebenden Materie wie das Wachstum, aus
welchem sie hervorging, und das Leben ist von seinem Beginn
auf Erden an kontinuierlich geblieben.4Es ist leicht einzusehen, daß das Zugeständnis eines natür-
lichen Todes für die höheren Organismen unserer Sache wenig
hilft. Wenn der Tod eine späte Erwerbung der Lebewesen ist,1) Dauer des Lebens, S. 38.
2) Leben und Tod, 2. Aufl., S. 67.
3) Dauer des Lebens, S. 33.
4) Über Leben und Tod, Schluß.
S.
238
dann kommen Todestriebe, die sich vom Beginn des Lebens auf
Erden ableiten, weiter nicht in Betracht. Die Vielzelligen mögen
dann immerhin aus inneren Gründen sterben, an den Mängeln
ihrer Differenzierung oder an den Unvollkommenheiten ihres
Stoffwechsels; es hat für die Frage, die uns beschäftigt, kein
Interesse. Ein solche Auffassung und Ableitung des Todes liegt
dem gewohnten Denken der Menschen auch sicherlich viel
näher als die befremdende Annahme von „Todestrieben“.Die Diskussion, die sich an die Aufstellungen von Weis-
mann angeschlossen, hat nach meinem Urteil in keiner Richtung
Entscheidendes ergeben.1 Manche Autoren sind zum Standpunkt
von Goette zurückgekehrt (1883), der in dem Tod die direkte
Folge der Fortpflanzung sah. Hartmann charakterisiert den
Tod nicht durch Auftreten einer „Leiche“, eines abgestorbenen
Anteiles der lebenden Substanz, sondern definiert ihn als den
„Abschluß der individuellen Entwicklung“. In diesem Sinne sind
auch die Protozoen sterblich, der Tod fällt bei ihnen immer mit
der Fortpflanzung zusammen, aber er wird durch diese gewisser-
maßen verschleiert, indem die ganze Substanz des Elterntieres
direkt in die jungen Kinderindividuen übergeführt werden kann
(l. c., S. 29).Das Interesse der Forschung hat sich bald darauf gerichtet,
die behauptete Unsterblichkeit der lebenden Substanz an den
Einzelligen experimentell zu erproben. Ein Amerikaner, Wood-
ruff, hat ein bewimpertes Infusorium, ein „Pantoffeltierchen“,
das sich durch Teilung in zwei Individuen fortpflanzt, in Zucht
genommen und es bis zur 3029sten Generation, wo er den
Versuch abbrach, verfolgt, indem er jedesmal das eine der Teil-
produkte isolierte und in frisches Wasser brachte. Dieser späte
Abkömmling des ersten Pantoffeltierchen war ebenso frisch wie1) Vgl. Max Hartmann, Tod und Fortpflanzung, 1906. Alex. Lipschütz,
Warum wir sterben, Kosmosbücher, 1914. Franz Doflein, Das Problem des Todes
und der Unsterblichkeit bei den Pflanzen und Tieren, 1909.S.
239
der Urahn, ohne alle Zeichen des Alterns oder der Degeneration;
somit schien, wenn solchen Zahlen bereits Beweiskraft zukommt,
die Unsterblichkeit der Protisten experimentell erweisbar.1Andere Forscher sind zu anderen Resultaten gekommen.
Maupas, Calkins und andere haben im Gegensatz zu
Woodruff gefunden, daß auch diese Infusorien nach einer
gewissen Anzahl von Teilungen schwächer werden, an Größe
abnehmen, einen Teil ihrer Organisation einbüßen und endlich
sterben, wenn sie nicht gewisse auffrischende Einflüsse erfahren.
Demnach stürben die Protozoen nach einer Phase des Alters-
verfalles ganz wie die höheren Tiere, so recht im Widerspruch
zu den Behauptungen Weismanns, der den Tod als eine späte
Erwerbung der lebenden Organismen anerkennt.Aus dem Zusammenhang dieser Untersuchungen heben wir
zwei Tatsachen heraus, die uns einen festen Anhalt zu bieten
scheinen. Erstens: Wenn die Tierchen zu einem Zeitpunkt, da
sie noch keine Altersveränderung zeigen, miteinander zu zweit
verschmelzen, „kopulieren“ können – worauf sie nach einiger
Zeit wieder auseinandergehen, – so bleiben sie vom Alter
verschont, sie sind „verjüngt“ worden. Diese Kopulation ist doch
wohl der Vorläufer der geschlechtlichen Fortpflanzung höherer
Wesen; sie hat mit der Vermehrung noch nichts zu tun, beschränkt
sich auf die Vermischung der Substanzen beider Individuen
(Weismanns Amphimixis). Der auffrischende Einfluß der
Kopulation kann aber auch ersetzt werden durch bestimmte Reiz-
mittel, Veränderungen in der Zusammensetzung der Nähr-
flüssigkeit, Temperatursteigerung oder Schütteln. Man erinnert
sich an das berühmte Experiment von J. Loeb, der Seeigeleier
durch gewisse chemische Reize zu Teilungsvorgängen zwang, die
sonst nur nach der Befruchtung auftreten.Zweitens: Es ist doch wahrscheinlich, daß die Infusorien durch
ihren eigenen Lebensprozeß zu einem natürlichen Tod geführt1) Für dies und das Folgende vgl. Lipschütz l. c., S. 26 und 52 ff.
S.
240
werden, denn der Widerspruch zwischen den Ergebnissen von
Woodruff und von anderen rührt daher, daß Woodruff
jede neue Generation in frische Nährflüssigkeit brachte. Unterließ
er dies, so beobachtete er dieselben Altersveränderungen der
Generationen wie die anderen Forscher. Er schloß, daß die Tierchen
durch die Produkte des Stoffwechsels, die sie an die umgebende
Flüssigkeit abgeben, geschädigt werden, und konnte dann über-
zeugend nachweisen, daß nur die Produkte des eigenen Stoff-
wechsels diese zum Tod der Generation führende Wirkung haben.
Denn in einer Lösung, die mit den Abfallsprodukten einer
entfernter verwandten Art übersättigt war, gediehen dieselben
Tierchen ausgezeichnet, die, in ihrer eigenen Nährflüssigkeit
angehäuft, sicher zugrunde gingen. Das Infusor stirbt also, sich
selbst überlassen, eines natürlichen Todes an der Unvollkommenheit
der Beseitigung seiner eigenen Stoffwechselprodukte; aber vielleicht
sterben auch alle höheren Tiere im Grunde an dem gleichen
Unvermögen.Es mag uns da der Zweifel anwandeln, ob es überhaupt zweck-
dienlich war, die Entscheidung der Frage nach dem natürlichen
Tod im Studium der Protozoen zu suchen. Die primitive Organi-
sation dieser Lebewesen mag uns wichtige Verhältnisse verschleiern,
die auch bei ihnen statthaben, aber erst bei höheren Tieren
erkannt werden können, wo sie sich einen morphologischen Aus-
druck verschafft haben. Wenn wir den morphologischen Stand-
punkt verlassen, um den dynamischen einzunehmen, so kann es
uns überhaupt gleichgültig sein, ob sich der natürliche Tod der
Protozoen erweisen läßt oder nicht. Bei ihnen hat sich die später
als unsterblich erkannte Substanz von der sterblichen noch in
keiner Weise gesondert. Die Triebkräfte, die das Leben in den
Tod überführen wollen, könnten auch in ihnen von Anfang an
wirksam sein, und doch könnte ihr Effekt durch den der lebens-
erhaltenden Kräfte so gedeckt werden, daß ihr direkter Nachweis
sehr schwierig wird. Wir haben allerdings gehört, daß dieS.
241
Beobachtungen der Biologen uns die Annahme solcher zum Tod
führenden inneren Vorgänge auch für die Protisten gestatten. Aber
selbst wenn die Protisten sich als unsterblich im Sinne von Weismann
erweisen, so gilt seine Behauptung, der Tod sei eine späte Erwerbung,
nur für die manifesten Äußerungen des Todes und macht keine
Annahme über die zum Tode drängenden Prozesse unmöglich. Unsere
Erwartung, die Biologie werde die Anerkennung der Todestriebe
glatt beseitigen, hat sich nicht erfüllt. Wir können uns mit ihrer
Möglichkeit weiter beschäftigen, wenn wir sonst Gründe dafür
haben. Die auffällige Ähnlichkeit der Weismannschen Sonderung
von Soma und Keimplasma mit unserer Scheidung der Todes-
triebe von den Lebenstrieben bleibt aber bestehen und erhält
ihren Wert wieder.Verweilen wir kurz bei dieser exquisit dualistischen Auffassung
des Trieblebens. Nach der Theorie E. Herings von den Vor-
gängen in der lebenden Substanz laufen in ihr unausgesetzt
zweierlei Prozesse entgegengesetzter Richtung ab, die einen auf-
bauend – assimilatorisch, die anderen abbauend – dissimila-
torisch. Sollen wir es wagen, in diesen beiden Richtungen der
Lebensprozesse die Betätigung unserer beiden Triebregungen, der
Lebenstriebe und der Todestriebe, zu erkennen? Aber etwas
anderes können wir uns nicht verhehlen: daß wir unversehens
in den Hafen der Philosophie Schopenhauers eingelaufen
sind, für den ja der Tod „das eigentliche Resultat“ und insofern
der Zweck des Lebens ist,1 der Sexualtrieb aber die Verkörperung
des Willens zum Leben.Versuchen wir kühn, einen Schritt weiter zu gehen. Nach
allgemeiner Einsicht ist die Vereinigung zahlreicher Zellen zu
einem Lebensverband, die Vielzelligkeit der Organismen, ein
Mittel zur Verlängerung ihrer Lebensdauer geworden. Eine Zelle
hilft dazu, das Leben der anderen zu erhalten, und der Zellenstaat1) „Über die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen“, Groß-
herzog Wilhelm Ernst‑Ausgabe, IV. Bd., S. 268.S.
242
kann weiter leben, auch wenn einzelne Zellen absterben
müssen. Wir haben bereits gehört, daß auch die Kopulation, die
zeitweilige Verschmelzung zweier Einzelliger, lebenserhaltend und
verjüngend auf beide wirkt. Somit könnte man den Versuch
machen, die in der Psychoanalyse gewonnene Libidotheorie auf
das Verhältnis der Zellen zu einander zu übertragen und sich
vorzustellen, daß es die in jeder Zelle tätigen Lebens‑ oder
Sexualtriebe sind, welche die anderen Zellen zum Objekt nehmen,
deren Todestriebe, das ist die von diesen angeregten Prozesse,
teilweise neutralisieren und sie so am Leben erhalten, während
andere Zellen dasselbe für sie besorgen und noch andere
in der Ausübung dieser libidinösen Funktion sich selbst aufopfern.
Die Keimzellen selbst würden sich absolut „narzißtisch“ benehmen,
wie wir es in der Neurosenlehre zu bezeichnen gewohnt sind,
wenn ein ganzes Individuum seine Libido im Ich behält und
nichts von ihr für Objektbesetzungen verausgabt. Die Keimzellen
brauchen ihre Libido, die Tätigkeit ihrer Lebenstriebe, für sich
selbst als Vorrat für ihre spätere, großartig aufbauende Tätigkeit.
Vielleicht darf man auch die Zellen der bösartigen Neugebilde,
die den Organismus zerstören, für narzißtisch in demselben Sinne
erklären. Die Pathologie ist ja bereit, ihre Keime für mitgeboren
zu halten und ihnen embryonale Eigenschaften zuzugestehen. So
würde also die Libido unserer Sexualtriebe mit dem Eros der
Dichter und Philosophen zusammenfallen, der alles Lebende
zusammenhält.An dieser Stelle finden wir den Anlaß, die langsame Entwicklung
unserer Libidotheorie zu überschauen. Die Analyse der Über-
tragungsneurosen zwang uns zunächst den Gegensatz zwischen
„Sexualtrieben“, die auf das Objekt gerichtet sind, und anderen
Trieben auf, die wir nur sehr ungenügend erkannten und vor-
läufig als „Ichtriebe“ bezeichneten. Unter ihnen mußten Triebe,
die der Selbsterhaltung des Individuums dienen, in erster Linie
anerkannt werden. Was für andere Unterscheidungen da zuS.
243
machen waren, konnte man nicht wissen. Keine Kenntnis wäre für
die Begründung einer richtigen Psychologie so wichtig gewesen, wie
eine ungefähre Einsicht in die gemeinsame Natur und die etwaigen
Besonderheiten der Triebe. Aber auf keinem Gebiete der Psycho-
logie tappte man so sehr im Dunkeln. Jedermann stellte so viele
Triebe oder „Grundtriebe“ auf, als ihm beliebte, und wirt-
schaftete mit ihnen, wie die alten griechischen Naturphilosophen
mit ihren vier Elementen: dem Wasser, der Erde, dem Feuer
und der Luft. Die Psychoanalyse, die irgend einer Annahme über
die Triebe nicht entraten konnte, hielt sich vorerst an die populäre
Triebunterscheidung, für die das Wort von „Hunger und Liebe“
vorbildlich ist. Es war wenigstens kein neuer Willkürakt. Damit
reichte man in der Analyse der Psychoneurosen ein ganzes Stück
weit aus. Der Begriff der „Sexualität“ – und damit der eines
Sexualtriebes – mußte freilich erweitert werden, bis er vieles
einschloß, was sich nicht der Fortpflanzungsfunktion einordnete,
und darüber gab es Lärm genug in der strengen, vornehmen
oder bloß heuchlerischen Welt.Der nächste Schritt erfolgte, als sich die Psychoanalyse näher
an das psychologische Ich herantasten konnte, das ihr zunächst
nur als verdrängende, zensurierende und zu Schutzbauten,
Reaktionsbildungen befähigte Instanz bekannt geworden war. Kritische
und andere weitblickende Geister hatten zwar längst gegen die
Einschränkung des Libidobegriffes auf die Energie der dem
Objekt zugewendeten Sexualtriebe Einspruch erhoben. Aber sie
versäumten es mitzuteilen, woher ihnen die bessere Einsicht
gekommen war, und verstanden nicht, etwas für die Analyse
Brauchbares aus ihr abzuleiten. In bedächtigerem Fortschreiten
fiel es nun der psychoanalytischen Beobachtung auf, wie regel-
mäßig Libido vom Objekt abgezogen und aufs Ich gerichtet wird
(Introversion), und indem sie die Libidoentwicklung des Kindes
in ihren frühesten Phasen studierte, kam sie zur Einsicht, daß
das Ich das eigentliche und ursprüngliche Reservoir der LibidoS.
244
sei, die erst von da aus auf das Objekt erstreckt werde. Das
Ich trat unter die Sexualobjekte und wurde gleich als das
vornehmste unter ihnen erkannt. Wenn die Libido so im Ich
verweilte, wurde sie narzißtisch genannt.1 Diese narzißtische
Libido war natürlich auch die Kraftäußerung von Sexualtrieben
im analytischen Sinne, die man mit den von Anfang an zuge-
standenen „Selbsterhaltungstrieben“ identifizieren mußte. Somit
war der ursprüngliche Gegensatz von Ichtrieben und Sexualtrieben
unzureichend geworden. Ein Teil der Ichtriebe war als libidinös
erkannt; im Ich waren – neben anderen wahrscheinlich –
auch Sexualtriebe wirksam, doch ist man berechtigt zu sagen,
daß die alte Formel, die Psychoneurose beruhe auf einem Konflikt
zwischen den Ichtrieben und den Sexualtrieben, nichts enthielt,
was heute zu verwerfen wäre. Der Unterschied der beiden Trieb-
arten, der ursprünglich irgendwie qualitativ gemeint war, ist
jetzt nur anders, nämlich topisch zu bestimmen. Insbesondere
die Übertragungsneurose, das eigentliche Studienobjekt der Psycho-
analyse, bleibt das Ergebnis eines Konflikts zwischen dem Ich und
der libidinösen Objektbesetzung.Um so mehr müssen wir den libidinösen Charakter der Selbst-
erhaltungstriebe jetzt betonen, da wir den weiteren Schritt wagen,
den Sexualtrieb als den alles erhaltenden Eros zu erkennen und
die narzißtische Libido des Ichs aus den Libidobeiträgen ableiten,
mit denen die Somazellen aneinander haften. Nun aber finden
wir uns plötzlich folgender Frage gegenüber: Wenn auch die
Selbsterhaltungstriebe libidinöser Natur sind, dann haben wir
vielleicht überhaupt keine anderen Triebe als libidinöse. Es sind
wenigstens keine anderen zu sehen. Dann muß man aber doch
den Kritikern recht geben, die von Anfang an geahnt haben,
die Psychoanalyse erkläre alles aus der Sexualität, oder den1) Zur Einführung des Narzißmus. Jahrbuch der Psychoanalyse, VI, 1914. [Ges.
Schriften, Bd. VI.]S.
245
Neuerern wie Jung, die, kurz entschlossen, Libido für „Trieb-
kraft“ überhaupt gebraucht haben. Ist dem nicht so?In unserer Absicht läge dies Resultat allerdings nicht. Wir
sind ja vielmehr von einer scharfen Scheidung zwischen Ichtrie-
ben = Todestrieben und Sexualtrieben = Lebenstrieben ausgegangen.
Wir waren ja bereit, auch die angeblichen Selbsterhaltungstriebe
des Ichs zu den Todestrieben zu rechnen, was wir seither
berichtigend zurückgezogen haben. Unsere Auffassung war von
Anfang eine dualistische und sie ist es heute schärfer denn
zuvor, seitdem wir die Gegensätze nicht mehr Ich‑ und Sexual-
triebe, sondern Lebens‑ und Todestriebe benennen. Jungs Libido-
theorie ist dagegen eine monistische; daß er seine einzige Trieb-
kraft Libido geheißen hat, mußte Verwirrung stiften, soll uns
aber weiter nicht beeinflussen. Wir vermuten, daß im Ich noch
andere als die libidinösen Selbsterhaltungstriebe tätig sind; wir
sollten nur imstande sein, sie aufzuzeigen. Es ist zu bedauern,
daß die Analyse des Ichs so wenig fortgeschritten ist, daß dieser
Nachweis uns recht schwer wird. Die libidinösen Triebe des Ichs
mögen allerdings in besonderer Weise mit den anderen, uns noch
fremden Ichtrieben verknüpft sein. Noch ehe wir den Narzißmus
klar erkannt hatten, bestand bereits in der Psychoanalyse die
Vermutung, daß die „Ichtriebe“ libidinöse Komponenten an sich
gezogen haben. Aber das sind recht unsichere Möglichkeiten,
denen die Gegner kaum Rechnung tragen werden. Es bleibt
mißlich, daß uns die Analyse bisher immer nur in den Stand
gesetzt hat, libidinöse Triebe nachzuweisen. Den Schluß, daß es
andere nicht gibt, möchten wir darum doch nicht mitmachen.Bei dem gegenwärtigen Dunkel der Trieblehre tun wir wohl
nicht gut, irgend einen Einfall, der uns Aufklärung verspricht,
zurückzuweisen. Wir sind von der großen Gegensätzlichkeit von
Lebens‑ und Todestrieben ausgegangen. Die Objektliebe selbst
zeigt uns eine zweite solche Polarität, die von Liebe (Zärtlichkeit)
und Haß (Aggression). Wenn es uns gelänge, diese beiden PolaritätenS.
246
in Beziehung zu einander zu bringen, die eine auf die andere
zurückzuführen! Wir haben von jeher eine sadistische Komponente
des Sexualtriebes anerkannt;1 sie kann sich, wie wir wissen, selb-
ständig machen und als Perversion das gesamte Sexualstreben der
Person beherrschen. Sie tritt auch in einer der von mir soge-
nannten „prägenitalen Organisationen“ als dominierender Partial-
trieb hervor. Wie soll man aber den sadistischen Trieb, der auf
die Schädigung des Objekts zielt, vom lebenserhaltenden Eros
ableiten können? Liegt da nicht die Annahme nahe, daß dieser
Sadismus eigentlich ein Todestrieb ist, der durch den Einfluß
der narzißtischen Libido vom Ich abgedrängt wurde, so daß er
erst am Objekt zum Vorschein kommt? Er tritt dann in den
Dienst der Sexualfunktion; im oralen Organisationsstadium der
Libido fällt die Liebesbemächtigung noch mit der Vernichtung des
Objekts zusammen, später trennt sich der sadistische Trieb ab
und endlich übernimmt er auf der Stufe des Genitalprimats
zum Zwecke der Fortpflanzung die Funktion, das Sexualobjekt
so weit zu bewältigen, als es die Ausführung des Geschlechts-
aktes erfordert. Ja, man könnte sagen, der aus dem Ich heraus-
gedrängte Sadismus habe den libidinösen Komponenten des
Sexualtriebs den Weg gezeigt; späterhin drängen diese zum
Objekt nach. Wo der ursprüngliche Sadismus keine Ermäßigung
und Verschmelzung erfährt, ist die bekannte Liebe‑Haß‑Ambivalenz
des Liebeslebens hergestellt.Wenn es erlaubt ist, eine solche Annahme zu machen, so
wäre die Forderung erfüllt, ein Beispiel eines – allerdings
verschobenen – Todestriebes aufzuzeigen. Nur daß diese Auffassung
von jeder Anschaulichkeit weit entfernt ist und einen geradezu
mystischen Eindruck macht. Wir kommen in den Verdacht, um
jeden Preis eine Auskunft aus einer großen Verlegenheit gesucht
zu haben. Dann dürfen wir uns darauf berufen, daß eine solche1) „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“, von der I. Auflage, 1905, an. [Ges.
Schriften, Bd. V.]S.
247
Annahme nicht neu ist, daß wir sie bereits früher einmal
gemacht haben, als von einer Verlegenheit noch keine Rede
war. Klinische Beobachtungen haben uns seinerzeit zur Auffassung
genötigt, daß der dem Sadismus komplementäre Partialtrieb des
Masochismus als eine Rückwendung des Sadismus gegen das
eigene Ich zu verstehen sei.1 Eine Wendung des Triebes vom
Objekt zum Ich ist aber prinzipiell nichts anderes als die
Wendung vom Ich zum Objekt, die hier als neu in Frage steht.
Der Masochismus, die Wendung des Triebes gegen das eigene
Ich, wäre dann in Wirklichkeit eine Rückkehr zu einer früheren
Phase desselben, eine Regression. In einem Punkte bedürfte die
damals vom Masochismus gegebene Darstellung einer Berichtigung
als allzu ausschließlich; der Masochismus könnte auch, was ich
dort bestreiten wollte, ein primärer sein.2Aber kehren wir zu den lebenserhaltenden Sexualtrieben
zurück. Schon aus der Protistenforschung haben wir erfahren, daß
die Verschmelzung zweier Individuen ohne nachfolgende Teilung,
die Kopulation, auf beide Individuen, die sich dann bald von
einander lösen, stärkend und verjüngend wirkt. (S. o. Lip-
schütz.) Sie zeigen in weiteren Generationen keine Degene-
rationserscheinungen und scheinen befähigt, den Schädlichkeiten
ihres eigenen Stoffwechsels länger zu widerstehen. Ich meine, daß
diese eine Beobachtung als vorbildlich für den Effekt auch der
geschlechtlichen Vereinigung genommen werden darf. Aber auf
welche Weise bringt die Verschmelzung zweier wenig verschiedener1) Vgl. Sexualtheorie, 4. Aufl., 1920, und „Triebe und Triebschicksale“. [Ges.
Schriften, Bd. V.]2) In einer inhalts‑ und gedankenreichen, für mich leider nicht ganz durch-
sichtigen Arbeit hat Sabina Spielrein ein ganzes Stück dieser Spekulation vor-
weggenommen. Sie bezeichnet die sadistische Komponente des Sexualtriebs als die
„destruktive“. (Die Destruktion als Ursache des Werdens. Jahrbuch für Psycho-
analyse, IV, 1912.) In noch anderer Weise suchte A. Stärcke (Inleiding by de
vertaling von S. Freud, De sexuele beschavingsmoral etc., 1914) den Libidobegriff
selbst mit dem theoretisch zu supponierenden biologischen Begriff eines An-
triebes zum Tode zu identifizieren. (Vgl. auch Rank, Der Künstler.) Alle
diese Bemühungen zeigen, wie die im Texte, von dem Drang nach einer noch nicht
erreichten Klärung in der Trieblehre.S.
248
Zellen eine solche Erneuerung des Lebens zustande?
Der Versuch, der die Kopulation bei den Protozoen durch die
Einwirkung chemischer, ja selbst mechanischer Reize (l. c.) ersetzt,
gestattet wohl eine sichere Antwort zu geben: Es geschieht
durch die Zufuhr neuer Reizgrößen. Das stimmt nun aber gut
zur Annahme, daß der Lebensprozeß des Individuums aus
inneren Gründen zur Abgleichung chemischer Spannungen, das
heißt zum Tode führt, während die Vereinigung mit einer indi-
viduell verschiedenen lebenden Substanz diese Spannungen ver-
größert, sozusagen neue Vitaldifferenzen einführt, die dann
abgelebt werden müssen. Für diese Verschiedenheit muß es
natürlich ein oder mehrere Optima geben. Daß wir als die herr-
schende Tendenz des Seelenlebens, vielleicht des Nervenlebens
überhaupt, das Streben nach Herabsetzung, Konstanterhaltung,
Aufhebung der inneren Reizspannung erkannten (das Nirwana-
prinzip nach einem Ausdruck von Barbara Low), wie es im
Lustprinzip zum Ausdruck kommt, das ist ja eines unserer
stärksten Motive, an die Existenz von Todestrieben zu glauben.Als empfindliche Störung unseres Gedankenganges verspüren
wir es aber noch immer, daß wir gerade für den Sexualtrieb
jenen Charakter eines Wiederholungszwanges nicht nachweisen
können, der uns zuerst zur Aufspürung der Todestriebe führte.
Das Gebiet der embryonalen Entwicklungsvorgänge ist zwar über-
reich an solchen Wiederholungserscheinungen, die beiden Keim-
zellen der geschlechtlichen Fortpflanzung und ihre Lebens-
geschichte sind selbst nur Wiederholungen der Anfänge des
organischen Lebens; aber das Wesentliche an den vom Sexual-
trieb intendierten Vorgängen ist doch die Verschmelzung zweier
Zelleiber. Erst durch diese wird bei den höheren Lebewesen
die Unsterblichkeit der lebenden Substanz gesichert.Mit anderen Worten: wir sollen Auskunft schaffen über die
Entstehung der geschlechtlichen Fortpflanzung und die Herkunft
der Sexualtriebe überhaupt, eine Aufgabe, vor der ein AußenstehenderS.
249
zurückschrecken muß, und die von den Spezialforschern
selbst bisher noch nicht gelöst werden konnte. In knappster
Zusammendrängung sei darum aus all den widerstreitenden
Angaben und Meinungen hervorgehoben, was einen Anschluß an
unseren Gedankengang zuläßt.Die eine Auffassung benimmt dem Problem der Fortpflanzung
seinen geheimnisvollen Reiz, indem sie die Fortpflanzung als eine
Teilerscheinung des Wachstums darstellt (Vermehrung durch
Teilung, Sprossung, Knospung). Die Entstehung der Fortpflan-
zung durch geschlechtlich differenzierte Keimzellen könnte man
sich nach nüchterner Darwinscher Denkungsart so vorstellen,
daß der Vorteil der Amphimixis, der sich dereinst bei der zu-
fälligen Kopulation zweier Protisten ergab, in der ferneren Ent-
wicklung festgehalten und weiter ausgenützt wurde.1 Das
„Geschlecht“ wäre also nicht sehr alt, und die außerordentlich
heftigen Triebe, welche die geschlechtliche Vereinigung herbei-
führen wollen, wiederholten dabei etwas, was sich zufällig ein-
mal ereignet und seither als vorteilhaft befestigt hat.Es ist hier wiederum wie beim Tod die Frage, ob man bei den
Protisten nichts anderes gelten lassen soll, als was sie zeigen, und ob
man annehmen darf, daß Kräfte und Vorgänge, die erst bei höheren
Lebewesen sichtbar werden, auch bei diesen zuerst entstanden sind.
Für unsere Absichten leistet die erwähnte Auffassung der Sexualität
sehr wenig. Man wird gegen sie einwenden dürfen, daß sie die
Existenz von Lebenstrieben, die schon im einfachsten Lebewesen
wirken, voraussetzt, denn sonst wäre ja die Kopulation, die dem
Lebenslauf entgegenwirkt und die Aufgabe des Ablebens erschwert,
nicht festgehalten und ausgearbeitet, sondern vermieden worden.
Wenn man also die Annahme von Todestrieben nicht fahren1) Obwohl Weismann (Das Keimplasma, 1892) auch diesen Vorteil leugnet:
„Die Befruchtung bedeutet keinesfalls eine Verjüngung oder Erneuerung des Lebens,
sie wäre durchaus nicht notwendig zur Fortdauer des Lebens, sie ist nichts als eine
Einrichtung, um die Vermischung zweier verschiedener Ver-
erbungstendenzen möglich zu machen.“ Als die Wirkung einer solchen Ver-
mischung betrachtet er aber doch eine Steigerung der Variabilität der Lebewesen.S.
250
lassen will, muß man ihnen von allem Anfang an Lebenstriebe
zugesellen. Aber man muß es zugestehen, wir arbeiten da an
einer Gleichung mit zwei Unbekannten. Was wir sonst in der
Wissenschaft über die Entstehung der Geschlechtlichkeit finden,
ist so wenig, daß man dies Problem einem Dunkel vergleichen
kann, in welches auch nicht der Lichtstrahl einer Hypothese
gedrungen ist. An ganz anderer Stelle begegnen wir allerdings
einer solchen Hypothese, die aber von so phantastischer Art ist,
– gewiß eher ein Mythus als eine wissenschaftliche Erklärung
– daß ich nicht wagen würde, sie hier anzuführen, wenn sie
nicht gerade die eine Bedingung erfüllen würde, nach deren
Erfüllung wir streben. Sie leitet nämlich einen Trieb ab von
dem Bedürfnis nach Wiederherstellung eines frü-
heren Zustandes.Ich meine natürlich die Theorie, die Plato im Symposion
durch Aristophanes entwickeln läßt, und die nicht nur die
Herkunft des Geschlechtstriebes, sondern auch seiner wichtigsten
Variation in Bezug auf das Objekt behandelt.1„Unser Leib war nämlich zuerst gar nicht ebenso gebildet wie
jetzt; er war ganz anders. Erstens gab es drei Geschlechter, nicht
bloß wie jetzt männlich und weiblich, sondern noch ein drittes,
das die beiden vereinigte … das Mannweibliche …“ Alles an
diesen Menschen war aber doppelt, sie hatten also vier Hände
und vier Füße, zwei Gesichter, doppelte Schamteile usw. Da ließ
sich Zeus bewegen, jeden Menschen in zwei Teile zu teilen,
„wie man die Quitten zum Einmachen durchschneidet … Weil
nun das ganze Wesen entzweigeschnitten war, trieb die Sehn-
sucht die beiden Hälften zusammen: sie umschlangen sich mit
den Händen, verflochten sich ineinander im Verlangen,
zusammenzuwachsen …“21) Übersetzung von U. v. Wilamowitz‑Moellendorff (Platon I,
S. 366 f.)2) Prof. Heinrich Gomperz (Wien) verdanke ich die nachstehenden Andeu-
tungen über die Herkunft des Platonischen Mythus, die ich zum Teil in seinen
Worten wiedergebe: Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß sich wesentlich
dieselbe Theorie auch schon in den Upanishaden findet. Denn Brihad‑
Āranyaka‑Upanishad, I, 4‚ 3 (Deussen, 60 Upanishads des Veda, S. 393),
wo das Hervorgehen der Welt aus dem Ātman (dem Selbst oder Ich) geschildert
wird, heißt es: „… Aber er (der Ātman‚ das Selbst oder das Ich) hatte auch keine
Freude; darum hat einer keine Freude, wenn er allein ist. Da begehrte er nach
einem Zweiten. Nämlich er war so groß wie ein Weib und ein Mann, wenn sie sich
umschlungen halten. Dieses sein Selbst zerfällte er in zwei Teile: daraus entstanden
Gatte und Gattin. Darum ist dieser Leib an dem Selbst gleichsam eine Halbscheid,
so nämlich hat es Yâjñavalkya erklärt. Darum wird dieser leere Raum hier
durch das Weib ausgefüllt.“
Die Brihad‑Āranyaka‑Upanishad ist die älteste aller Upanishaden und
wird wohl von keinem urteilsfähigen Forscher später angesetzt als etwa um das
Jahr 800 v. Chr. Die Frage, ob eine, wenn auch nur mittelbare Abhängigkeit Platos
von diesen indischen Gedanken möglich wäre, möchte ich im Gegensatz zur herr-
schenden Meinung nicht unbedingt verneinen, da eine solche Möglichkeit wohl auch
für die Seelenwanderungslehre nicht geradezu in Abrede gestellt werden kann. Eine
solche, zunächst durch Pythagoreer vermittelte Abhängigkeit würde dem gedanklichen
Zusammentreffen kaum etwas von seiner Bedeutsamkeit nehmen, da Plato eine der-
artige ihm irgendwie aus orientalischer Überlieferung zugetragene Geschichte sich
nicht zu eigen gemacht, geschweige denn ihr eine so bedeutsame Stellung ange-
wiesen hätte, hätte sie ihm nicht selbst als wahrheitshältig eingeleuchtet.
In einem Aufsatz von K. Ziegler, Menschen‑ und Weltenwerden (Neue Jahr-
bücher für das klassische Altertum, Bd. 31, S. 529 ff., 1913), der sich planmäßig mit
der Erforschung des fraglichen Gedankens vor Plato beschäftigt, wird dieser auf
babylonische Vorstellungen zurückgeführt.S.
251
Sollen wir, dem Wink des Dichterphilosophen folgend, die
Annahme wagen, daß die lebende Substanz bei ihrer Belebung in
kleine Partikel zerrissen wurde, die seither durch die Sexual-
triebe ihre Wiedervereinigung anstreben? Daß diese Triebe, in
denen sich die chemische Affinität der unbelebten Materie fort-
setzt, durch das Reich der Protisten hindurch allmählich die
Schwierigkeiten überwinden, welche eine mit lebensgefährlichen
Reizen geladene Umgebung diesem Streben entgegensetzt, die sie
zur Bildung einer schützenden Rindenschicht nötigt? Daß diese
zersprengten Teilchen lebender Substanz so die Vielzelligkeit
erreichen und endlich den Keimzellen den Trieb zur Wiederver-
einigung in höchster Konzentration übertragen? Ich glaube, es ist
hier die Stelle, abzubrechen.Doch nicht, ohne einige Worte kritischer Besinnung anzu-
schließen. Man könnte mich fragen, ob und inwieweit ich selbstS.
252
von den hier entwickelten Annahmen überzeugt bin. Meine
Antwort würde lauten, daß ich weder selbst überzeugt bin, noch
bei anderen um Glauben für sie werbe. Richtiger: ich weiß
nicht, wie weit ich an sie glaube. Es scheint mir, daß das
affektive Moment der Überzeugung hier gar nicht in Betracht
zu kommen braucht. Man kann sich doch einem Gedankengang
hingeben, ihn verfolgen, soweit er führt, nur aus wissenschaft-
licher Neugierde oder, wenn man will, als advocatus diaboli, der
sich darum doch nicht dem Teufel selbst verschreibt. Ich ver-
kenne nicht, daß der dritte Schritt in der Trieblehre, den ich
hier unternehme, nicht dieselbe Sicherheit beanspruchen kann wie
die beiden früheren, die Erweiterung des Begriffs der Sexuali-
tät und die Aufstellung des Narzißmus. Diese Neuerungen waren
direkte Übersetzungen der Beobachtung in Theorie, mit nicht
größeren Fehlerquellen behaftet, als in all solchen Fällen unver-
meidlich ist. Die Behauptung des regressiven Charakters der
Triebe ruht allerdings auch auf beobachtetem Material, nämlich
auf den Tatsachen des Wiederholungszwanges. Allein vielleicht
habe ich deren Bedeutung überschätzt. Die Durchführung dieser
Idee ist jedenfalls nicht anders möglich, als daß man mehrmals
nacheinander Tatsächliches mit bloß Erdachtem kombiniert und
sich dabei weit von der Beobachtung entfernt. Man weiß, daß
das Endergebnis um so unverläßlicher wird, je öfter man dies
während des Aufbaues einer Theorie tut, aber der Grad der
Unsicherheit ist nicht angebbar. Man kann dabei glücklich
geraten haben oder schmählich in die Irre gegangen sein. Der
sogenannten Intuition traue ich bei solchen Arbeiten wenig zu;
was ich von ihr gesehen habe, schien mir eher der Erfolg einer
gewissen Unparteilichkeit des Intellekts. Nur daß man leider
selten unparteiisch ist, wo es sich um die letzten Dinge, die
großen Probleme der Wissenschaft und des Lebens handelt. Ich
glaube, ein jeder wird da von innerlich tief begründeten Vor-
lieben beherrscht, denen er mit seiner Spekulation unwissentlichS.
253
in die Hände arbeitet. Bei so guten Gründen zum Mißtrauen bleibt
wohl nichts anderes als ein kühles Wohlwollen für die Ergebnisse
der eigenen Denkbemühung möglich. Ich beeile mich nur hin-
zuzufügen, daß solche Selbstkritik durchaus nicht zu besonderer
Toleranz gegen abweichende Meinungen verpflichtet. Man darf
unerbittlich Theorien abweisen, denen schon die ersten Schritte
in der Analyse der Beobachtung widersprechen, und kann dabei
doch wissen, daß die Richtigkeit derer, die man vertritt, doch
nur eine vorläufige ist. In der Beurteilung unserer Spekulation
über die Lebens‑ und Todestriebe würde es uns wenig stören,
daß so viel befremdende und unanschauliche Vorgänge darin vor-
kommen, wie ein Trieb werde von anderen herausgedrängt, oder
er wende sich vom Ich zum Objekt und dergleichen. Dies rührt
nur daher, daß wir genötigt sind, mit den wissenschaftlichen
Terminis, das heißt mit der eigenen Bildersprache der Psycho-
logie (richtig: der Tiefenpsychologie) zu arbeiten. Sonst könnten
wir die entsprechenden Vorgänge überhaupt nicht beschreiben, ja,
würden sie gar nicht wahrgenommen haben. Die Mängel unserer
Beschreibung würden wahrscheinlich verschwinden, wenn wir
anstatt der psychologischen Termini schon die physiologischen
oder chemischen einsetzen könnten. Diese gehören zwar auch
nur einer Bildersprache an, aber einer uns seit längerer Zeit ver-
trauten und vielleicht auch einfacheren.Hingegen wollen wir uns recht klar machen, daß die Unsicher-
heit unserer Spekulation zu einem hohen Grade durch die Nöti-
gung gesteigert wurde, Anleihen bei der biologischen Wissen-
schaft zu machen. Die Biologie ist wahrlich ein Reich der unbe-
grenzten Möglichkeiten, wir haben die überraschendsten Auf-
klärungen von ihr zu erwarten und können nicht erraten, welche
Antworten sie auf die von uns an sie gestellten Fragen einige
Jahrzehnte später geben würde. Vielleicht gerade solche, durch die
unser ganzer künstlicher Bau von Hypothesen umgeblasen wird.
Wenn dem so ist, könnte jemand fragen, wozu unternimmt manS.
254
also solche Arbeiten, wie die in diesem Abschnitt niedergelegte,
und warum bringt man sie doch zur Mitteilung? Nun, ich kann
nicht in Abrede stellen, daß einige der Analogien, Verknüpfun-
gen und Zusammenhänge darin mir der Beachtung würdig
erschienen sind.11) Anschließend hier einige Worte zur Klärung unserer Namengebung, die im
Laufe dieser Erörterungen eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat. Was „Sexual-
triebe“ sind, wußten wir aus ihrer Beziehung zu den Geschlechtern und zur Fort-
pflanzungsfunktion. Wir behielten dann diesen Namen bei, als wir durch die Ergeb-
nisse der Psychoanalyse genötigt waren, deren Beziehung zur Fortpflanzung zu
lockern. Mit der Aufstellung der narzißtischen Libido und der Ausdehnung des
Libidobegriffes auf die einzelne Zelle wandelte sich uns der Sexualtrieb zum Eros,
der die Teile der lebenden Substanz zueinanderzudrängen und zusammenzuhalten
sucht, und die gemeinhin so genannten Sexualtriebe erschienen als der dem Objekt
zugewandte Anteil dieses Eros. Die Spekulation läßt dann diesen Eros vom Anfang
des Lebens an wirken und als „Lebenstrieb“ im Gegensatz zum „Todestrieb“
treten, der durch die Belebung des Anorganischen entstanden ist. Sie versucht das
Rätsel des Lebens durch die Annahme dieser beiden von Uranfang an miteinander
ringenden Triebe zu lösen. Unübersichtlicher ist vielleicht die Wandlung, die
der Begriff der „Ichtriebe“ erfahren hat. Ursprünglich nannten wir so alle jene von
uns nicht näher gekannten Triebrichtungen, die sich von den auf das Objekt
gerichteten Sexualtrieben abscheiden lassen, und brachten die Ichtriebe im Gegensatz
zu den Sexualtrieben, deren Ausdruck die Libido ist. Späterhin näherten wir uns der
Analyse des Ichs und erkannten, daß auch ein Teil der „Ichtriebe“ libidinöser Natur
ist, das eigene Ich zum Objekt genommen hat. Diese narzißtischen Selbsterhaltungs-
triebe mußten also jetzt den libidinösen Sexualtrieben zugerechnet werden. Der
Gegensatz zwischen Ich‑ und Sexualtrieben wandelte sich in den zwischen Ich- und
Objekttrieben, beide libidinöser Natur. An seine Stelle trat aber ein neuer Gegensatz
zwischen libidinösen (Ich‑ und Objekt‑) Trieben und anderen, die im Ich zu statu-
ieren und vielleicht in den Destruktionstrieben aufzuzeigen sind. Die Spekulation
wandelt diesen Gegensatz in den von Lebenstrieben (Eros) und von Todestrieben
um.S.
255
VII
Wenn es wirklich ein so allgemeiner Charakter der Triebe ist,
daß sie einen früheren Zustand wiederherstellen wollen, so dürfen
wir uns nicht darüber verwundern, daß im Seelenleben so viele
Vorgänge sich unabhängig vom Lustprinzip vollziehen. Dieser
Charakter würde sich jedem Partialtrieb mitteilen und sich in
seinem Falle auf die Wiedererreichung einer bestimmten Station
des Entwicklungsweges beziehen. Aber all dies, worüber das Lust-
prinzip noch keine Macht bekommen hat, brauchte darum noch
nicht im Gegensatz zu ihm zu stehen, und die Aufgabe ist noch
ungelöst, das Verhältnis der triebhaften Wiederholungsvorgänge
zur Herrschaft des Lustprinzips zu bestimmen.Wir haben es als eine der frühesten und wichtigsten Funk-
tionen des seelischen Apparates erkannt, die anlangenden Trieb-
regungen zu „binden“, den in ihnen herrschenden Primär-
vorgang durch den Sekundärvorgang zu ersetzen, ihre frei beweg-
liche Besetzungsenergie in vorwiegend ruhende (tonische)
Besetzung umzuwandeln. Während dieser Umsetzung kann auf
die Entwicklung von Unlust nicht Rücksicht genommen werden,
allein das Lustprinzip wird dadurch nicht aufgehoben. Die
Umsetzung geschieht vielmehr im Dienste des Lustprinzips; die
Bindung ist ein vorbereitender Akt, der die Herrschaft des Lust-
prinzips einleitet und sichert.Trennen wir Funktion und Tendenz schärfer voneinander, als
wir es bisher getan haben. Das Lustprinzip ist dann eine Ten-
denz, welche im Dienste einer Funktion steht, der es zufällt,S.
256
den seelischen Apparat überhaupt erregungslos zu machen, oder
den Betrag der Erregung in ihm konstant oder möglichst niedrig
zu erhalten. Wir können uns noch für keine dieser Fassungen
sicher entscheiden, aber wir merken, daß die so bestimmte
Funktion Anteil hätte an dem allgemeinsten Streben alles
Lebenden, zur Ruhe der anorganischen Welt zurückzukehren.
Wir haben alle erfahren, daß die größte uns erreichbare Lust,
die des Sexualaktes, mit dem momentanen Erlöschen einer hoch-
gesteigerten Erregung verbunden ist. Die Bindung der Trieb-
regung wäre aber eine vorbereitende Funktion, welche die Erre-
gung für ihre endgültige Erledigung in der Abfuhrlust zurichten soll.Aus demselben Zusammenhang erhebt sich die Frage, ob die
Lust‑ und Unlustempfindungen von den gebundenen wie von
den ungebunden Erregungsvorgängen in gleicher Weise erzeugt
werden können. Da erscheint es denn ganz unzweifelhaft, daß
die ungebundenen, die Primärvorgänge, weit intensivere Empfin-
dungen nach beiden Richtungen ergeben als die gebundenen, die
des Sekundärvorganges. Die Primärvorgänge sind auch die zeit-
lich früheren, zu Anfang des Seelenlebens gibt es keine anderen,
und wir können schließen, wenn das Lustprinzip nicht schon
bei ihnen in Wirksamkeit wäre, könnte es sich überhaupt für
die späteren nicht herstellen. Wir kommen so zu dem im Grunde
nicht einfachen Ergebnis, daß das Luststreben zu Anfang des
seelischen Lebens sich weit intensiver äußert als späterhin, aber
nicht so uneingeschränkt; es muß sich häufige Durchbrüche
gefallen lassen. In reiferen Zeiten ist die Herrschaft des Lust-
prinzips sehr viel mehr gesichert, aber dieses selbst ist der Bän-
digung so wenig entgangen wie die anderen Triebe überhaupt.
Jedenfalls muß das, was am Erregungsvorgange die Empfindungen
von Lust und Unlust entstehen läßt, beim Sekundärvorgang
ebenso vorhanden sein wie beim Primärvorgang.Hier wäre die Stelle, mit weiteren Studien einzusetzen. Unser
Bewußtsein vermittelt uns von innen her nicht nur die EmpfindungenS.
257
von Lust und Unlust, sondern auch von einer eigen-
tümlichen Spannung, die selbst wieder eine lustvolle oder unlust-
volle sein kann. Sind es nun die gebundenen und die ungebun-
denen Energievorgänge, die wir mittels dieser Empfindungen von
einander unterscheiden sollen, oder ist die Spannungsempfindung
auf die absolute Größe, eventuell das Niveau der Besetzung zu
beziehen, während die Lust‑Unlustreihe auf die Änderung der
Besetzungsgröße in der Zeiteinheit hindeutet? Es muß uns auch
auffallen, daß die Lebenstriebe so viel mehr mit unserer inneren
Wahrnehmung zu tun haben, da sie als Störenfriede auftreten,
unausgesetzt Spannungen mit sich bringen, deren Erledigung als
Lust empfunden wird, während die Todestriebe ihre Arbeit unauf-
fällig zu leisten scheinen. Das Lustprinzip scheint geradezu im
Dienste der Todestriebe zu stehen; es wacht allerdings auch
über die Reize von außen, die von beiderlei Triebarten als
Gefahren eingeschätzt werden, aber ganz besonders über die
Reizsteigerungen von innen her, die eine Erschwerung der
Lebensaufgabe erzielen. Hieran knüpfen sich ungezählte andere
Fragen, deren Beantwortung jetzt nicht möglich ist. Man muß
geduldig sein und auf weitere Mittel und Anlässe zur Forschung
warten. Auch bereit bleiben, einen Weg wieder zu verlassen,
den man eine Weile verfolgt hat, wenn er zu nichts Gutem zu
führen scheint. Nur solche Gläubige, die von der Wissenschaft
einen Ersatz für den aufgegebenen Katechismus fordern, werden
dem Forscher die Fortbildung oder selbst die Umbildung seiner
Ansichten verübeln. Im übrigen mag uns ein Dichter (Rückert
in den Makamen des Hariri) über die langsamen Fortschritte
unserer wissenschaftlichen Erkenntnis trösten:„Was man nicht erfliegen kann, muß man erhinken.
…
Die Schrift sagt, es ist keine Sünde zu hinken.“
Freud_1925_Gesammelte_Schriften_VI_Ich_Psychologie
191
–257