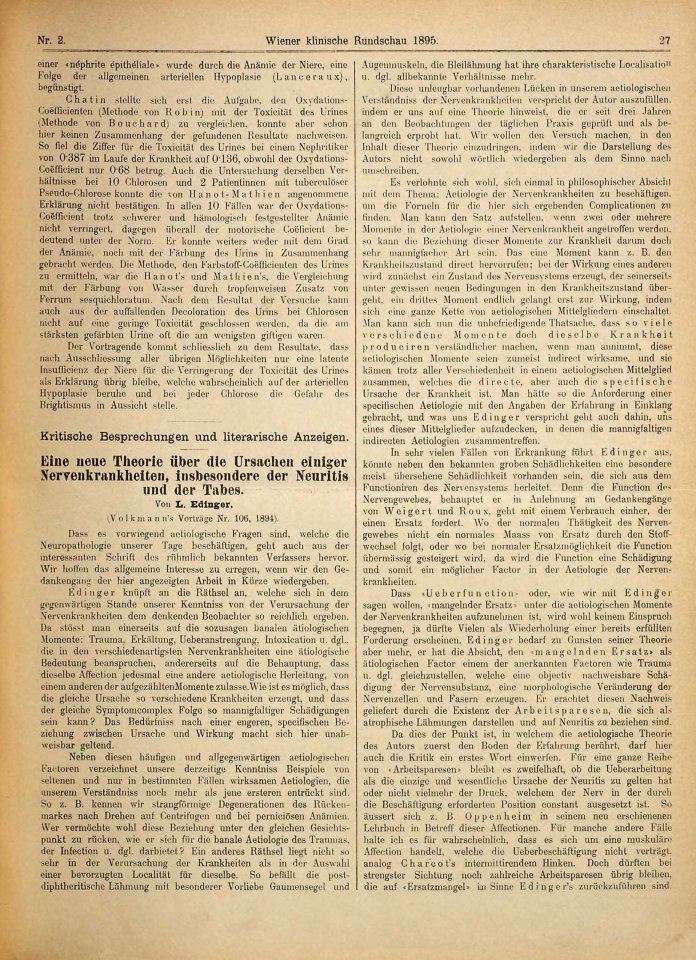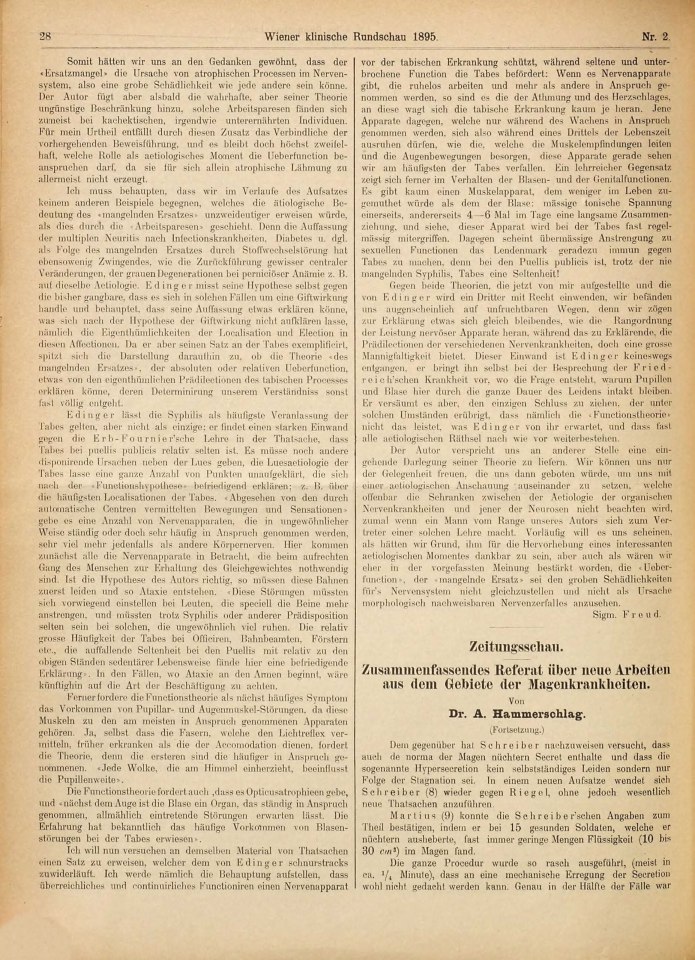S.
Kritische Besprechungen und literarische Anzeigen.
Eine neue Theorie über die Ursachen einiger
Nervenkrankheiten, insbesondere der Neuritis
und der Tabes.
Von L. Edinger.
(Volkmann’s Vorträge Nr. 106, 1894).Dass es vorwiegend aetiologische Fragen sind, welche die
Neuropathologie unserer Tage beschäftigen, geht auch aus der
interessanten Schrift des rühmlich bekannten Verfassers hervor.
Wir hoffen das allgemeine Interesse zu erregen, wenn wir den Ge-
dankengang der hier angezeigten Arbeit in Kürze wiedergeben.
Edinger knüpft an die Räthsel an, welche sich in dem
gegenwärtigen Stande unserer Kenntniss von der Verursachung der
Nervenkrankheiten dem denkenden Beobachter so reichlich ergeben.
Da stösst man einerseits auf die sozusagen banalen aetiologischen
Momente: Trauma, Erkältung, Ueberanstrengung, Intoxication u. dgl.,
die in den verschiedenartigsten Nervenkrankheiten eine ätiologische
Bedeutung beanspruchen, andererseits auf die Behauptung, dass
dieselbe Affection jedesmal eine andere aetiologische Herleitung, von
einem anderen der aufgezählten Momente zulasse. Wie ist es möglich,
dass die gleiche Ursache so verschiedene Krankheiten erzeugt, und
dass der gleiche Symptomcomplex Folge so mannigfaltiger Schädigungen
sein kann? Das Bedürfniss nach einer engeren, specifischen Be-
ziehung zwischen Ursache und Wirkung macht sich hier unab-
weisbar geltend.Neben diesen häufigen und allgegenwärtigen aetiologischen
Factoren verzeichnet unsere derzeitige Kenntniss Beispiele von
selteneren und nur in bestimmten Fällen wirksamen Aetiologien, die
unserem Verständniss noch mehr als jene ersteren entrückt sind.
So z. B. kennen wir strangförmige Degenerationen des Rücken-
markes nach Drehen auf Centrifugen und bei perniciösen Anämien.
Wer vermöchte wohl diese Beziehung unter den gleichen Gesichts-
punkt zu rücken, wie er sich für die banale Aetiologie des Traumas,
der Infection u. dgl. darbietet? Ein anderes Räthsel liegt nicht so
sehr in der Verursachung der Krankheiten als in der Auswahl
einer bevorzugten Localität für dieselbe. So befällt die post-
diphtheritische Lähmung mit besonderer Vorliebe Gaumensegel undAugenmuskeln, die Bleihlähmung hat ihre charakteristische Localisation
u. dgl. allbekannte Verhältnisse mehr.
Diese unbeleugbar vorhandenen Lücken in unserem aetiologischen
Verständniss der Nervenkrankheiten verspricht der Autor auszufüllen,
indem er uns auf eine Theorie hinweist, die er seit drei Jahren
an den Beobachtungen der täglichen Praxis geprüft und als be-
langreich erprobt hat. Wir wollen den Versuch machen, in den
Inhalt dieser Theorie einzudringen, indem wir die Darstellung des
Autors nicht sowohl wörtlich wiedergeben als dem Sinne nach
umschreiben.
Es verlohnt sich wohl, sich einmal in philosophischer Absicht
mit dem Thema Aetiologie der Nervenkrankheiten zu beschäftigen,
um die Formeln für die hier sich ergebenden Complicationen zu
finden. Man kann den Satz aufstellen, wenn zwei oder mehrere
Momente in der Aetiologie einer Nervenkrankheit angetroffen werden,
so kann die Beziehung dieser Momente zur Krankheit z. B. doch
sehr mannigfacher Art sein. Das eine Moment kann z. B. dem
Krankheitszustand direct bevorrufen, bei der Wirkung eines anderen
wird zunächst ein Zustand des Nervensystems erzeugt, der seinerseits
unter gewissen neuen Bedingungen in den Krankheitszustand über-
geht. Ein drittes Moment endlich gehorcht erst zur Wirkung, indem
sich eine ganze Kette von aetiologischen Mitgliedern einschaltet.
Man kann sich nun die unbefriedigende Thatsache, dass so viele
verschiedene Momente doch dieselbe Krankheit
produciren verständlicher machen, wenn man annimmt, diese
aetiologischen Momente seien zumeist indirect wirksame, und sie
dienen trotz aller Verschiedenheit einem aetiologischen Mittelglied
zusammen, welches die directe, aber auch die specifische
Ursache der Krankheit ist. Man hätte so die Anforderung einer
specifischen Aetiologie, mit den Angaben der Erfahrung in Einklang
gebracht, und was uns Edinger verspricht geht auch dahin, uns
einen dieser Mittelglieder aufzudecken, in denen die mannigfaltigen
indirecten Aetiologien zusammentragen.
In sehr vielen Fällen von Erkrankung führt Edinger aus,
könnte neben den bekannten groben Schädlichkeiten eine besondere
meist übersehene Schädlichkeit vorhanden sein, die sich aus dem
Functionen des Nervensystems herleiten. Denn die Function der
Nervengewebe, behauptet er, in Anlehnung an Gedankengänge
von Weigert und Brux, geht mit einem Verbrauch einher, der
einen Ersatz fordert. Wo der normale Thätigkeit des Nerven-
gewebes nicht ein normales Maass von Ersatz durch den Stoff-
wechsel folgt, oder wo bei normaler Ersatzmöglichkeit die Function
übermässig gesteigert wird, da wird die Function eine Schädigung
und somit ein möglicher Factor in der Aetiologie der Nerven-
krankheiten.
Der «Verbrauch» oder, wie wir mit Edinger
sagen wollen, «mangelnder Ersatz» unter die aetiologischen Momente
der Nervenkrankheiten aufzunehmen ist, wird wohl keinem Einspruch
begegnen, ja dürfte Vielen als Wiederholung einer bereits erfüllten
Forderung erscheinen. Edinger’s Bedeutung, seinen bei seiner Theorie
aber mehr, er hat die Absicht, den «mangelnden Ersatz» als
aetiologischen Factor einem, der anerkanntern Factoren wie Trauma
u. dgl. gleichzustellen, welchen eine objectiv nachweisbare Schä-
digung der Nervensubstanz, eine morphologische Veränderung der
Nervenzellen und Fasern erzeugen. Er erachtet diesen Nachweis
geliefert durch die Existenz des Arbeits-Ersatzes, die sich als
atrophische Lähmungen darstellen und auf Neuritis zu beziehen sind.
Dies ist der Punkt ist, in welchem die aetiologische Theorie
des Autors zuerst den Boden der Erfahrung betritt, darf hier
auch die Kritik ein ernstes Wort einwerfen. Für eine ganze Reihe
von «Arbeitsparen» bleibt es zweifelhaft, ob die Ueberarbeitung
als die einzige und wesentliche Ursache der Neuritis zu gelten hat
oder nicht vielmehr der Druck, welchen der Nerv in der durch
die Beschäftigung erlittenen Position ausgesetzt ist, so zu
dessert sich z. B. **Oppenheim** in seinem neu erschienenen
Lehrbuch in Betreff dieser Affectionen. Für manche andere Fälle
halte ich es für wahrscheinlich, dass es sich um eine malage-
Affection handelt, welche die Ueberschäftigung nicht verträgt,
analog **Charcot’s** intermittirendem Hinken. Doch dürften bei
strengster Sichtung doch zahlreiche Arbeitsparesen übrig bleiben,
die auf «Ersatzmangel» in Sinne Edinger’s zurückzuführen sind.S.
Somit hätten wir uns an den Gedanken gewöhnt, dass der
«Ersatzmangel» die Ursache von atrophischen Processen im Nerven-
system, also eine grobe Schädlichkeit wie jede andere sein könne.
Der Autor fügt aber alsbald die warnenden, aber seine Theorie
günstigsten Beschränkung hinzu, solche Arbeitsparesen fänden viel
zuerst bei cachektischen, irgendwie internistischen, Individuen.
Für mein Urtheil enthüllt durch diesen Zusatz das Verhältniss der
vorhergehenden Beweisführung und bleibt doch höchst zweifel-
haft, welche Rolle als aetiologisches Moment die Ueberfunction be-
anspruchen darf, da sie für sich allein atrophische Lähmung zu
allermeist nicht erzeugt.
Ich muss behaupten, dass im Verlaufe des Aufsatzes
keinem anderen Beispiele begegnen, welches die aetiologische Be-
deutung des «mangelnden Ersatzes» unzweideutiger erweisen würde,
als dies durch die «Arbeitsparesen» geschieht. Denn die Zulassung
der Neuritis nach Infectionskrankheiten, Diabetes u. dgl.
als Folge des mangelnden Ersatzes durch Stoffwechselstörung hat
ebensowenig Zwingendes, wie die Zurückführung gewisser centraler
Strangaffectionen, der grauen Degeneration bei perniciöser Anämie z. B.
auf dieselbe Aetiologie. Edinger misst seine Hypothese selbst gegen
die Tabes, da es sich in solchen Fällen um eine Giftwirkung
handelt, und behauptet, dass seine Auffassung etwa erklären könne,
was sich nach der Hypothese der Giftwirkung nicht aufklären lasse,
nämlich die Eigenthümlichkeiten der Localisation und Election in
diesen Affectionen. Da er aber seine Sätze an der Tabes exemplifizirt,
stützt sich die Darstellung daraufhin, u. zw. die Theorie des
«mangelnden Ersatzes» in der absoluten oder relativen Ueberfunction
etwas von den eigenthümlichen Prädilectionen des tabischen Processes
erklären könne, deren Determinirung unserem Verständniss sonst
fast völlig entgeht.
Edinger lässt die Syphilis als häufigste Veranlassung der
Tabes gelten, aber nicht als einzige; er findet einen starken Einwand
gegen die reine «Functionirer-Lehre» in der Thatsache, dass
Tabes bei puellis publicis relativ selten ist. Es müsse noch andere
dispositionirende Factoren neben der Lues geben, die die Geschlechtstube
in Beziehung zu dieser Krankheit. Denn diese, nach der
«Functionshypothese» befriedigend erklären; z. B. über
die häufigsten Localisationen der Tabes, abgesehen von der durch
automatische Centren vermittelten Bewegungen und Sensationen
gebe es eine Anzahl von Nervenapparaten, die in ungewöhnlicher
Weise ständig oder doch sehr häufig in Anspruch genommen seien,
sehr viel mehr jedenfalls als andere Körpernerven. Hier kommen
zunächts all die Nervenapparate in Betracht, die beim aufrechten
Gang des Menschen zur Erhaltung des Gleichgewichtes nothwendig
sind. Dies ist die Hypothese des Autors richtig, so müssen dabei Tabes
zuerst leiden und so Ataxie entstehen. Diese Störungen müssten
sich vorwiegend einstellen bei Leuten, die speciell die Beine mehr
anstrengen, und müssten trotz Syphilis oder anderer Prädisposition
selten sein bei solchen, die ungewöhnlich viel ruhen. Die relativ
grosse Häufigkeit der Tabes bei Offizieren, Bahnbearbeitern etc.,
die auffallende Seltenheit bei den Puellis mit relativ zu den
oben Ständen selteneren Lebensweise fände hier eine befriedigende
Erklärung. In den Fällen, wo Ataxie an den Armen beginnt, wäre
künftighin auf die Art der Beschäftigung zu achten.
Ebenso fordert die Functionstheorie als nächst häufiges Symptom
das Vorkommen von Pupillar- und Augenmuskelstörungen, da diese
Muskeln zu den am meisten in Anspruch genommenen Apparaten
gehören. Ja, selbst dass die Blasen, welche dem Lichtreflex ver-
mitteln, früher erkranken als die dem Accomodation dienen, fordert
die Theorie, denn die ersteren sind die häufiger in Anspruch ge-
nommenen. Jede Wolke, die am Himmel einherzieht, beeinflusst
die Pupillenweite.
Der Functionstheorie passt auch, dass Esophagsplichen gebe
und «zuerst diejenigen Organe die Blase ein Organ, das ständig in Anspruch
genommen, allmählich eintretende Störungen erwarten lässt. Die
Erfahrung hat bekanntlich des häufige Vorkommen von Blasen-
störungen bei der Tabes erwiesen.»
Ich will nun versuchen an demselben Material von Thatsachen
einen Satz zu erweisen, welchen dem von Edinger sehr schreck-
zuzustimmen. Ich werde nämlich die Behauptung aufstellen, dass
übersichtlichen und continuirlichen Functionen einen Nervenapparatvor der tabischen Erkrankung schützt, während seltene und unter-
brochene Function die Tabes befördert. Wenn es Nervenapparate
gibt, die ruhelos arbeiten und mehr als andere in Anspruch ge-
nommen werden, so sind es die der Athmung und des Herzschlages,
an diese wagt sich die tabische Erkrankung kaum je heran. Jene
Apparate dagegen, welche nur während des Wachsens in Anspruch
genommen werden, sich also während eines Drittels der Lebenszeit
ausruhen dürfen, wie die, welche die Muskelemfindungen leiten
und die Augenbewegungen besorgen, diese Apparate gerade sehen
wir am häufigsten der Tabes verfallen. Ein lehrreicher Gegensatz
zeigt sich ferner im Verhalten der Blasen- und der Genitalfunctionen.
Es gibt kaum einen Muskelapparat, dem weniger im Leben zu
gemuthet würde als dem der Blase; mässige tonische Spannung
einerseits, andererseits 4–6 Mal im Tage eine langsame Zusammen-
ziehung, und siehe, dieser Apparat wird bei der Tabes fast regel-
mässig mit-ergriffen. Dagegen scheint übermässige Anstrengung zu
sexuellen Functionen das Lendenmark geradezu immun gegen
Tabes zu machen, denn bei den **Puellis publicis** ist, trotz der nie
mangelnden Syphilis, Tabes eine Seltenheit!Gegen beide Theorien, die jetzt von mir aufgestellte und die
von Edinger wird ein Dritter mit Recht einwenden, wir befänden
uns augenscheinlich auf unfruchtbaren Wegen, denn wir zögern
zur Erklärung etwas sich gleich bleibendes, wie die Rangordnung
der Leistung nervöser Apparate heran, während das zu Erklärende,
die Prädilectionen der verschiedenen Nervenkrankheiten, doch eine grosse
Mannigfaltigkeit bietet. Dieser Einwand ist Edinger keineswegs
entgangen, er bringt ihn selbst bei der Besprechung der **Fried-
reich'**schen Krankheit vor, wo die Frage entsteht, warum Pupillen
und Blase hier durch die ganze Dauer des Leidens intakt bleiben.
Er versäumt es aber, den einzigen Schluss zu ziehen, der unter
solchen Umständen erübrigt, dass nämlich die «**Functionstheorie**»
nicht das leistet, was Edinger von ihr erwartet, und dass fast
alle aetiologischen Räthsel nach wie vor weiterbestehen.Der Autor verspricht uns an anderer Stelle eine ein-
gehende Darlegung seiner Theorie zu liefern. Wir können uns nur
der Gelegenheit freuen, die uns dann geboten würde, um uns mit
einer aetiologischen Anschauung auseinander zu setzen, welche
offenbar die Schranken zwischen der Aetiologie der organischen
Nervenkrankheiten und jener der Neurosen nicht beachten wird,
zumal wenn ein Mann vom Range unseres Autors sich zum Ver-
treter einer solchen Lehre macht. Vorläufig will es uns scheinen,
als hätten wir Grund, ihm für die Hervorhebung eines interessanten
aetiologischen Momentes dankbar zu sein, aber auch als wären wir
eher in der vorgefassten Meinung bestärkt worden, die «Ueber-
function», der «mangelnde Ersatz» sei den groben Schädlichkeiten
für’s Nervensystem nicht gleichzustellen und nicht als Ursache
morphologisch nachweisbaren Nervenverfalles anzusehen.Sigmund Freud.
bsb11506713
27
–28