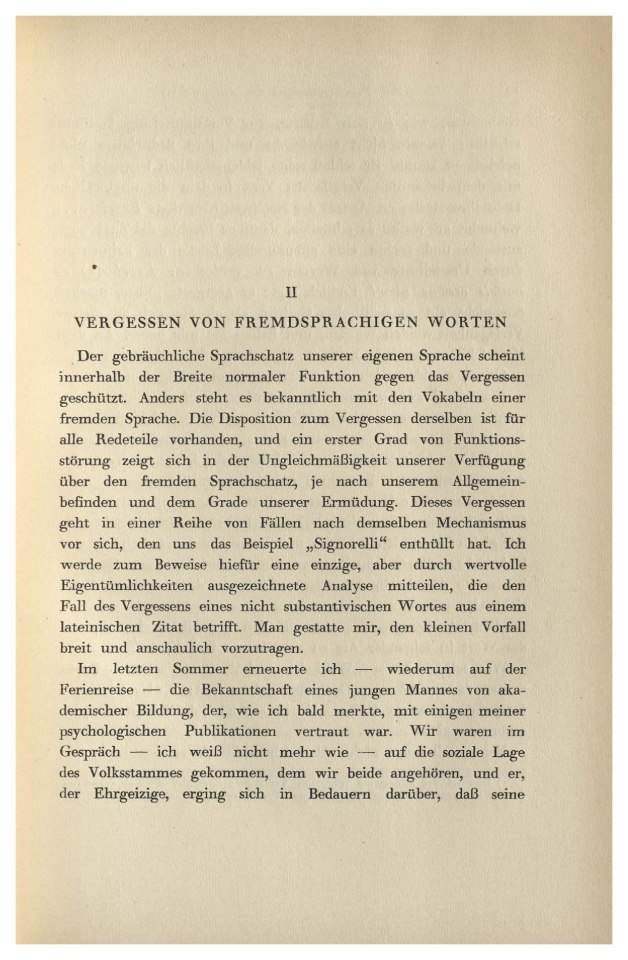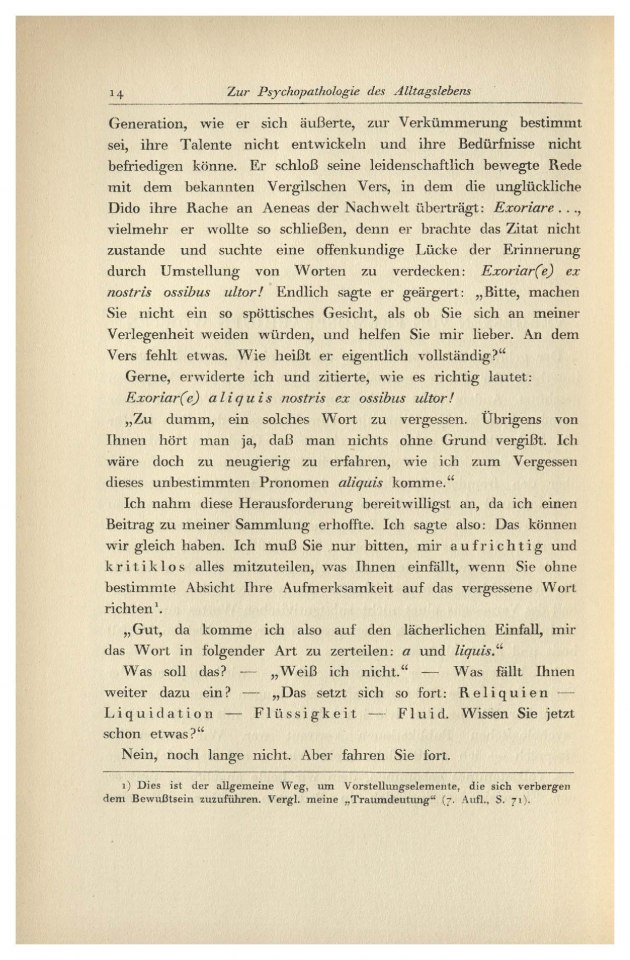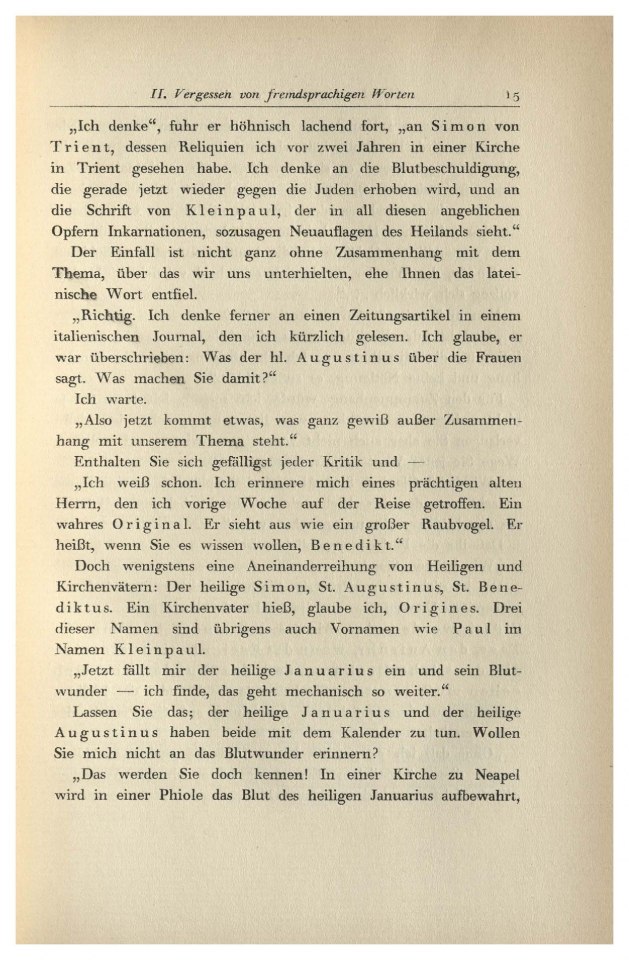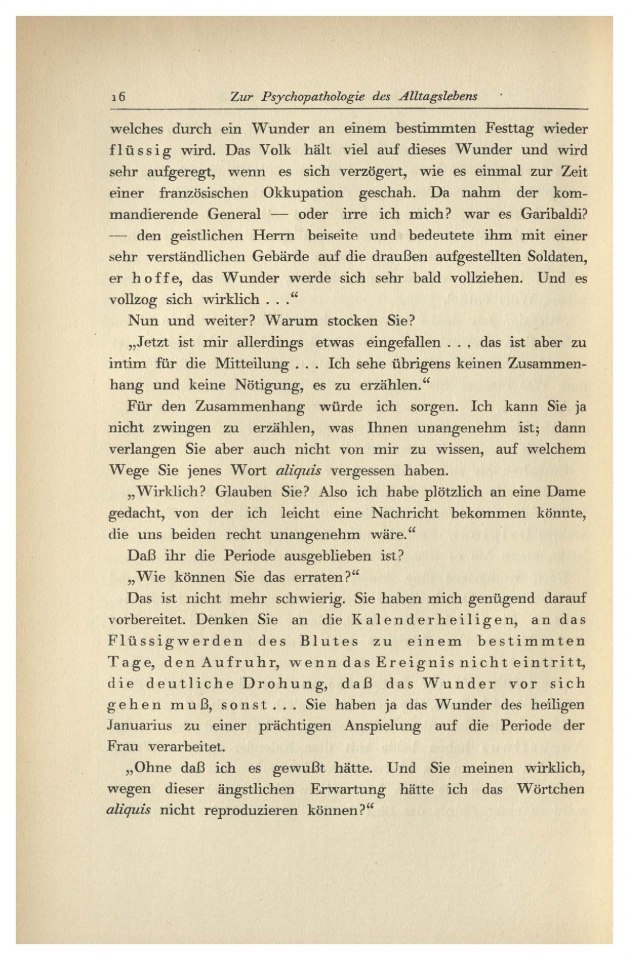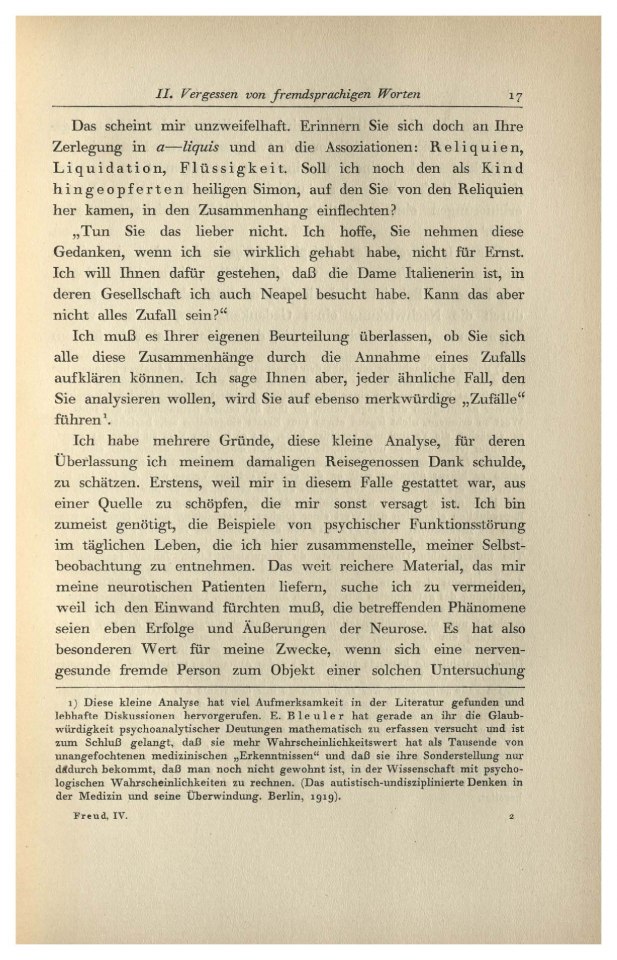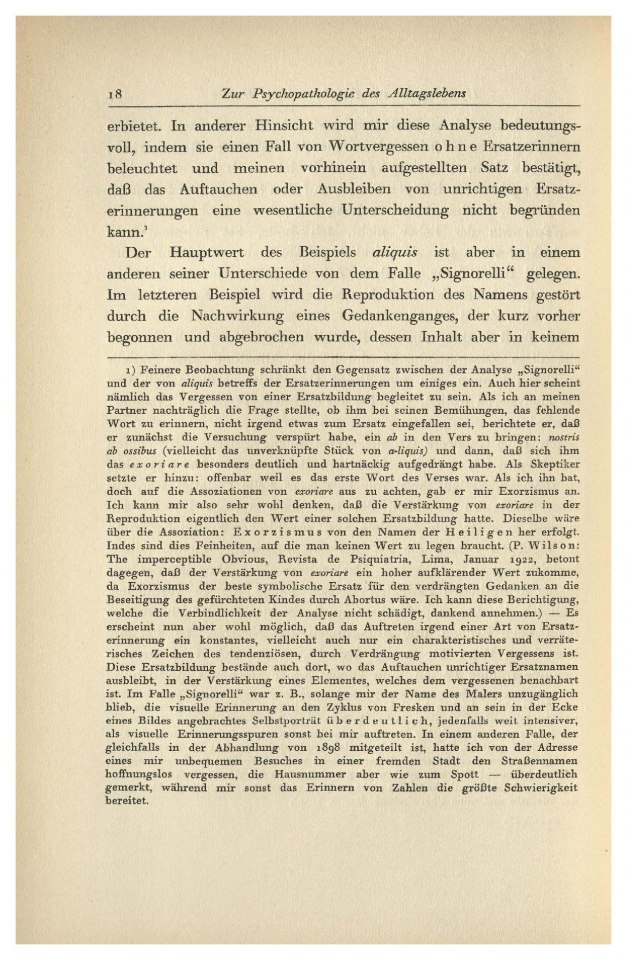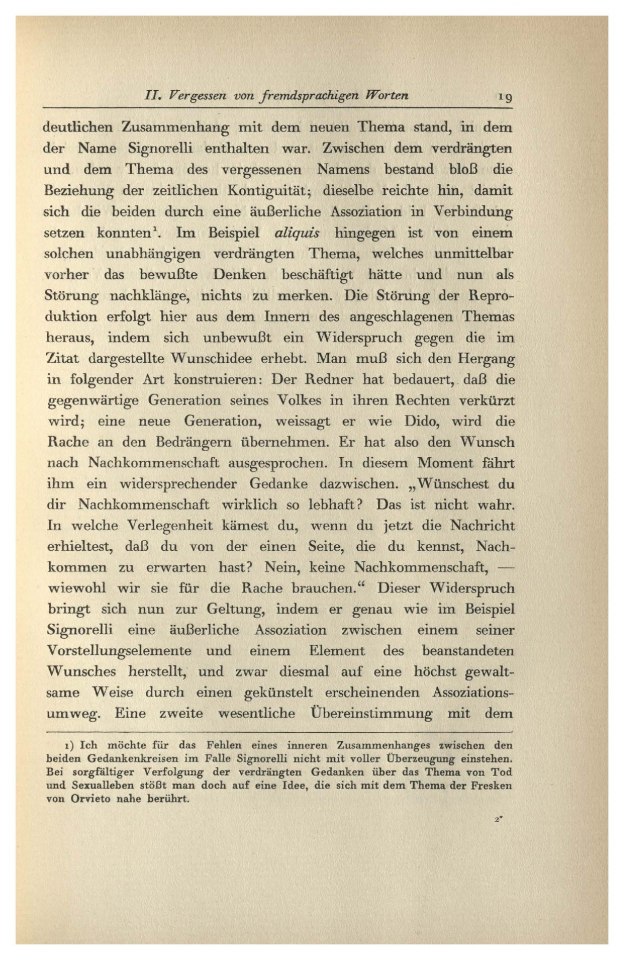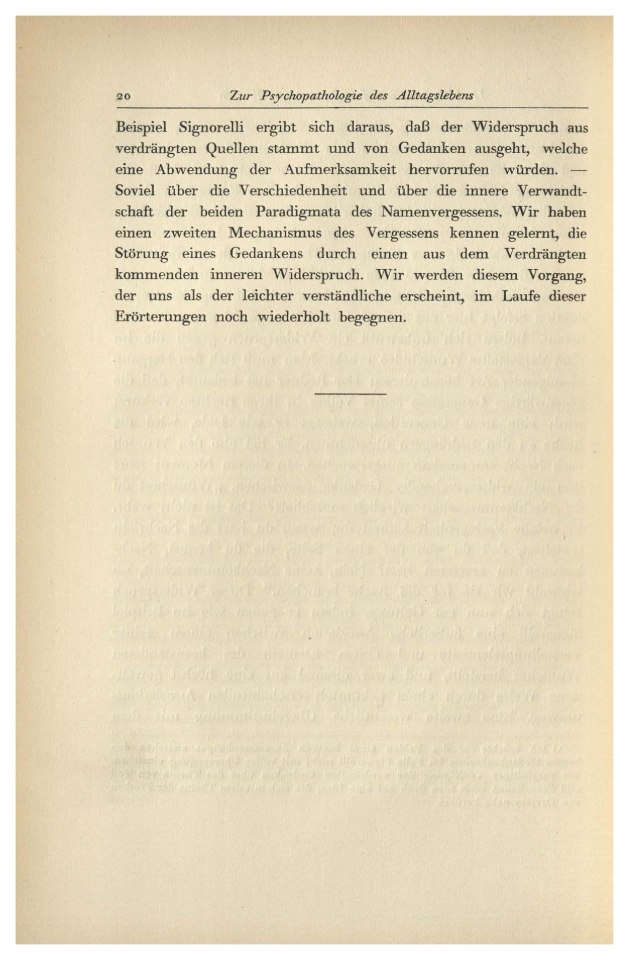S.
[13]
II
VERGESSEN VON FREMDSPRACHIGEN WORTENDer gebräuchliche Sprachschatz unserer eigenen Sprache scheint
innerhalb der Breite normaler Funktion gegen das Vergessen
geschützt. Anders steht es bekanntlich mit den Vokabeln einer
fremden Sprache. Die Disposition zum Vergessen derselben ist für
alle Redeteile vorhanden, und ein erster Grad von Funktions-
störung zeigt sich in der Ungleichmäßigkeit unserer Verfügung
über den fremden Sprachschatz, je nach unserem Allgemein-
befinden und dem Grade unserer Ermüdung. Dieses Vergessen
geht in einer Reihe von Fällen nach demselben Mechanismus
vor sich, den uns das Beispiel „Signorelli“ enthüllt hat. Ich
werde zum Beweise hiefür eine einzige, aber durch wertvolle
Eigentümlichkeiten ausgezeichnete Analyse mitteilen, die den
Fall des Vergessens eines nicht substantivischen Wortes aus einem
lateinischen Zitat betrifft. Man gestatte mir, den kleinen Vorfall
breit und anschaulich vorzutragen.Im letzten Sommer erneuerte ich — wiederum auf der
Ferienreise — die Bekanntschaft eines jungen Mannes von aka-
demischer Bildung, der, wie ich bald merkte, mit einigen meiner
psychologischen Publikationen vertraut war. Wir waren im
Gespräch — ich weiß nicht mehr wie — auf die soziale Lage
des Volksstammes gekommen, dem wir beide angehören, und er,
der Ehrgeizige, erging sich in Bedauern darüber, daß seineS.
14
Generation, wie er sich äußerte, zur Verkümmerung bestimmt
sei, ihre Talente nicht entwickeln und ihre Bedürfnisse nicht
befriedigen könne. Er schloß seine leidenschaftlich bewegte Rede
mit dem bekannten Vergilschen Vers, in dem die unglückliche
Dido ihre Rache an Aeneas der Nachwelt überträgt: Exoriare...,
vielmehr er wollte so schließen, denn er brachte das Zitat nicht
zustande und suchte eine offenkundige Lücke der Erinnerung
durch Umstellung von Worten zu verdecken: Exoriar(e) ex
nostris ossibus ultor! Endlich sagte er geärgert: „Bitte, machen
Sie nicht ein so spöttisches Gesicht, als ob Sie sich an meiner
Verlegenheit weiden würden, und helfen Sie mir lieber. An dem
Vers fehlt etwas. Wie heißt er eigentlich vollständig?“Gerne, erwiderte ich und zitierte, wie es richtig lautet:
Exoriar(e) aliquis nostris ex ossibus ultor!
„Zu dumm, ein solches Wort zu vergessen. Übrigens von
Ihnen hört man ja, daß man nichts ohne Grund vergißt. Ich
wäre doch zu neugierig zu erfahren, wie ich zum Vergessen
dieses unbestimmten Pronomen aliquis komme.“Ich nahm diese Herausforderung bereitwilligst an, da ich einen
Beitrag zu meiner Sammlung erhoffte. Ich sagte also: Das können
wir gleich haben. Ich muß Sie nur bitten, mir aufrichtig und
kritiklos alles mitzuteilen, was Ihnen einfällt, wenn Sie ohne
bestimmte Absicht Ihre Aufmerksamkeit auf das vergessene Wort
richten1.„Gut, da komme ich also auf den lächerlichen Einfall, mir
das Wort in folgender Art zu zerteilen: a und liquis.“Was soll das? — „Weiß ich nicht.“ — Was fällt Ihnen
weiter dazu ein? — „Das setzt sich so fort: Reliquien —
Liquidation — Flüssigkeit — Fluid. Wissen Sie jetzt
schon etwas?“Nein, noch lange nicht. Aber fahren Sie fort.
1) Dies ist der allgemeine Weg, um Vorstellungselemente, die sich verbergen
dem Bewußtsein zuzuführen. Vergl. meine „Traumdeutung“ (7. Aufl., S. 71).S.
15
„Ich denke“, fuhr er höhnisch lachend fort, „an Simon von
Trient, dessen Reliquien ich vor zwei Jahren in einer Kirche
in Trient gesehen habe. Ich denke an die Blutbeschuldigung,
die gerade jetzt wieder gegen die Juden erhoben wird, und an
die Schrift von Kleinpaul, der in all diesen angeblichen
Opfern Inkarnationen, sozusagen Neuauflagen des Heilands sieht.“Der Einfall ist nicht ganz ohne Zusammenhang mit dem
Thema, über das wir uns unterhielten, ehe Ihnen das latei-
nische Wort entfiel.„Richtig. Ich denke ferner an einen Zeitungsartikel in einem
italienischen Journal, den ich kürzlich gelesen. Ich glaube, er
war überschrieben: Was der hl. Augustinus über die Frauen
sagt. Was machen Sie damit?“Ich warte.
„Also jetzt kommt etwas, was ganz gewiß außer Zusammen-
hang mit unserem Thema steht.“Enthalten Sie sich gefälligst jeder Kritik und —
„Ich weiß schon. Ich erinnere mich eines prächtigen alten
Herrn, den ich vorige Woche auf der Reise getroffen. Ein
wahres Original. Er sieht aus wie ein großer Raubvogel. Er
heißt, wenn Sie es wissen wollen, Benedikt.“Doch wenigstens eine Aneinanderreihung von Heiligen und
Kirchenvätern: Der heilige Simon, St. Augustinus, St. Bene-
diktus. Ein Kirchenvater hieß, glaube ich, Origines. Drei
dieser Namen sind übrigens auch Vornamen wie Paul im
Namen Kleinpaul.„Jetzt fällt mir der heilige Januarius ein und sein Blut-
wunder — ich finde, das geht mechanisch so weiter.“Lassen Sie das; der heilige Januarius und der heilige
Augustinus haben beide mit dem Kalender zu tun. Wollen
Sie mich nicht an das Blutwunder erinnern?„Das werden Sie doch kennen! In einer Kirche zu Neapel
wird in einer Phiole das Blut des heiligen Januarius aufbewahrt,S.
16
welches durch ein Wunder an einem bestimmten Festtag wieder
flüssig wird. Das Volk hält viel auf dieses Wunder und wird
sehr aufgeregt, wenn es sich verzögert, wie es einmal zur Zeit
einer französischen Okkupation geschah. Da nahm der kom-
mandierende General — oder irre ich mich? war es Garibaldi?
— den geistlichen Herrn beiseite und bedeutete ihm mit einer
sehr verständlichen Gebärde auf die draußen aufgestellten Soldaten,
er hoffe, das Wunder werde sich sehr bald vollziehen. Und es
vollzog sich wirklich . . .“Nun und weiter? Warum stocken Sie?
„Jetzt ist mir allerdings etwas eingefallen . . . das ist aber zu
intim für die Mitteilung . . . Ich sehe übrigens keinen Zusammen-
hang und keine Nötigung, es zu erzählen.“Für den Zusammenhang würde ich sorgen. Ich kann Sie ja
nicht zwingen zu erzählen, was Ihnen unangenehm ist; dann
verlangen Sie aber auch nicht von mir zu wissen, auf welchem
Wege Sie jenes Wort aliquis vergessen haben.„Wirklich? Glauben Sie? Also ich habe plötzlich an eine Dame
gedacht, von der ich leicht eine Nachricht bekommen könnte,
die uns beiden recht unangenehm wäre.“Daß ihr die Periode ausgeblieben ist?
„Wie können Sie das erraten?“
Das ist nicht mehr schwierig. Sie haben mich genügend darauf
vorbereitet. Denken Sie an die Kalenderheiligen, an das
Flüssigwerden des Blutes zu einem bestimmten
Tage, den Aufruhr, wenn das Ereignis nicht eintritt,
die deutliche Drohung, daß das Wunder vor sich
gehen muß, sonst . . . Sie haben ja das Wunder des heiligen
Januarius zu einer prächtigen Anspielung auf die Periode der
Frau verarbeitet.„Ohne daß ich es gewußt hätte. Und Sie meinen wirklich,
wegen dieser ängstlichen Erwartung hätte ich das Wörtchen
aliquis nicht reproduzieren können?“S.
17
Das scheint mir unzweifelhaft. Erinnern Sie sich doch an Ihre
Zerlegung in a—liquis und an die Assoziationen: Reliquien,
Liquidation, Flüssigkeit. Soll ich noch den als Kind
hingeopferten heiligen Simon, auf den Sie von den Reliquien
her kamen, in den Zusammenhang einflechten?„Tun Sie das lieber nicht. Ich hoffe, Sie nehmen diese
Gedanken, wenn ich sie wirklich gehabt habe, nicht für Ernst.
Ich will Ihnen dafür gestehen, daß die Dame Italienerin ist, in
deren Gesellschaft ich auch Neapel besucht habe. Kann das aber
nicht alles Zufall sein?“Ich muß es Ihrer eigenen Beurteilung überlassen, ob Sie sich
alle diese Zusammenhänge durch die Annahme eines Zufalls
aufklären können. Ich sage Ihnen aber, jeder ähnliche Fall, den
Sie analysieren wollen, wird Sie auf ebenso merkwürdige „Zufälle“
führen1.Ich habe mehrere Gründe, diese kleine Analyse, für deren
Überlassung ich meinem damaligen Reisegenossen Dank schulde,
zu schätzen. Erstens, weil mir in diesem Falle gestattet war, aus
einer Quelle zu schöpfen, die mir sonst versagt ist. Ich bin
zumeist genötigt, die Beispiele von psychischer Funktionsstörung
im täglichen Leben, die ich hier zusammenstelle, meiner Selbst-
beobachtung zu entnehmen. Das weit reichere Material, das mir
meine neurotischen Patienten liefern, suche ich zu vermeiden,
weil ich den Einwand fürchten muß, die betreffenden Phänomene
seien eben Erfolge und Äußerungen der Neurose. Es hat also
besonderen Wert für meine Zwecke, wenn sich eine nerven-
gesunde fremde Person zum Objekt einer solchen Untersuchung1) Diese kleine Analyse hat viel Aufmerksamkeit in der Literatur gefunden und
lebhafte Diskussionen hervorgerufen. E. Bleuler hat gerade an ihr die Glaub-
würdigkeit psychoanalytischer Deutungen mathematisch zu erfassen versucht und ist
zum Schluß gelangt, daß sie mehr Wahrscheinlichkeitswert hat als Tausende von
unangefochtenen medizinischen „Erkenntnissen“ und daß sie ihre Sonderstellung nur
dadurch bekommt, daß man noch nicht gewohnt ist, in der Wissenschaft mit psycho-
logischen Wahrscheinlichkeiten zu rechnen. (Das autistisch-undisziplinierte Denken in
der Medizin und seine Überwindung. Berlin, 1919).S.
18
erbietet. In anderer Hinsicht wird mir diese Analyse bedeutungs-
voll, indem sie einen Fall von Wortvergessen ohne Ersatzerinnern
beleuchtet und meinen vorhinein aufgestellten Satz bestätigt,
daß das Auftauchen oder Ausbleiben von unrichtigen Ersatz-
erinnerungen eine wesentliche Unterscheidung nicht begründen
kann.1Der Hauptwert des Beispiels aliquis ist aber in einem
anderen seiner Unterschiede von dem Falle „Signorelli“ gelegen.
Im letzteren Beispiel wird die Reproduktion des Namens gestört
durch die Nachwirkung eines Gedankenganges, der kurz vorher
begonnen und abgebrochen wurde, dessen Inhalt aber in keinem1) Feinere Beobachtung schränkt den Gegensatz zwischen der Analyse „Signorelli“
und der von aliquis betreffs der Ersatzerinnerungen um einiges ein. Auch hier scheint
nämlich das Vergessen von einer Ersatzbildung begleitet zu sein. Als ich an meinen
Partner nachträglich die Frage stellte, ob ihm bei seinen Bemühungen, das fehlende
Wort zu erinnern, nicht irgend etwas zum Ersatz eingefallen sei, berichtete er, daß
er zunächst die Versuchung verspürt habe, ein ab in den Vers zu bringen: nostris
ab ossibus (vielleicht das unverknüpfte Stück von a-liquis) und dann, daß sich ihm
das exoriare besonders deutlich und hartnäckig aufgedrängt habe. Als Skeptiker
setzte er hinzu: offenbar weil es das erste Wort des Verses war. Als ich ihn bat,
doch auf die Assoziationen von exoriare aus zu achten, gab er mir Exorzismus an.
Ich kann mir also sehr wohl denken, daß die Verstärkung von exoriare in der
Reproduktion eigentlich den Wert einer solchen Ersatzbildung hatte. Dieselbe wäre
über die Assoziation: Exorzismus von den Namen der Heiligen her erfolgt.
Indes sind dies Feinheiten, auf die man keinen Wert zu legen braucht. (P. Wilson:
The imperceptible Obvious‚ Revista de Psiquiatria‚ Lima, Januar 1922, betont
dagegen, daß der Verstärkung von exoriare ein hoher aufklärender Wert zukomme‚
da Exorzismus der beste symbolische Ersatz für den verdrängten Gedanken an die
Beseitigung des gefürchteten Kindes durch Abortus wäre. Ich kann diese Berichtigung,
welche die Verbindlichkeit der Analyse nicht schädigt, dankend annehmen.) — Es
erscheint nun aber wohl möglich, daß das Auftreten irgend einer Art von Ersatz-
erinnerung ein konstantes, vielleicht auch nur ein charakteristisches und verräte-
risches Zeichen des tendenziösen, durch Verdrängung motivierten Vergessens ist.
Diese Ersatzbildung bestände auch dort, wo das Auftauchen unrichtiger Ersatznamen
ausbleibt, in der Verstärkung eines Elementes, welches dem vergessenen benachbart
ist. Im Falle „Signorelli“ war z. B., solange mir der Name des Malers unzugänglich
blieb, die visuelle Erinnerung an den Zyklus von Fresken und an sein in der Ecke
eines Bildes angebrachtes Selbstporträt überdeutlich, jedenfalls weit intensiver,
als visuelle Erinnerungsspuren sonst bei mir auftreten. In einem anderen Falle, der
gleichfalls in der Abhandlung von 1898 mitgeteilt ist, hatte ich von der Adresse
eines mir unbequemen Besuches in einer fremden Stadt den Straßennamen
hoffnungslos vergessen, die Hausnummer aber wie zum Spott — überdeutlich
gemerkt, während mir sonst das Erinnern von Zahlen die größte Schwierigkeit
bereitet.S.
19
deutlichen Zusammenhang mit dem neuen Thema stand, in dem
der Name Signorelli enthalten war. Zwischen dem verdrängten
und dem Thema des vergessenen Namens bestand bloß die
Beziehung der zeitlichen Kontiguität; dieselbe reichte hin, damit
sich die beiden durch eine äußerliche Assoziation in Verbindung
setzen konnten1. Im Beispiel aliquis hingegen ist von einem
solchen unabhängigen verdrängen Thema, welches unmittelbar
vorher das bewußte Denken beschäftigt hätte und nun als
Störung nachklänge, nichts zu merken. Die Störung der Repro-
duktion erfolgt hier aus dem Innern des angeschlagenen Themas
heraus, indem sich unbewußt ein Widerspruch gegen die im
Zitat dargestellte Wunschidee erhebt. Man muß sich den Hergang
in folgender Art konstruieren: Der Redner hat bedauert, daß die
gegenwärtige Generation seines Volkes in ihren Rechten verkürzt
wird; eine neue Generation, weissagt er wie Dido‚ wird die
Rache an den Bedrängern übernehmen. Er hat also den Wunsch
nach Nachkommenschaft ausgesprochen. In diesem Moment fährt
ihm ein widersprechender Gedanke dazwischen. „Wünschest du
dir Nachkommenschaft wirklich so lebhaft? Das ist nicht wahr.
In welche Verlegenheit kämest du, wenn du jetzt die Nachricht
erhieltest, daß du von der einen Seite, die du kennst, Nach-
kommen zu erwarten hast? Nein, keine Nachkommenschaft, —
wiewohl wir sie für die Rache brauchen.“ Dieser Widerspruch
bringt sich nun zur Geltung, indem er genau wie im Beispiel
Signorelli eine äußerliche Assoziation zwischen einem seiner
Vorstellungselemente und einem Element des beanstandeten
Wunsches herstellt, und zwar diesmal auf eine höchst gewalt-
same Weise durch einen gekünstelt erscheinenden Assoziations-
umweg. Eine zweite wesentliche Übereinstimmung mit dem1) Ich möchte für das Fehlen eines inneren Zusammenhanges zwischen den
beiden Gedankenkreisen im Falle Signorelli nicht mit voller Überzeugung einstehen.
Bei sorgfältiger Verfolgung der verdrängten Gedanken über das Thema von Tod
und Sexualleben stößt man doch auf eine Idee, die sich mit dem Thema der Fresken
von 0rvieto nahe berührt.S.
20
Beispiel Signorelli ergibt sich daraus, daß der Widerspruch aus
verdrängen Quellen stammt und von Gedanken ausgeht, welche
eine Abwendung der Aufmerksamkeit hervorrufen würden. —
Soviel über die Verschiedenheit und über die innere Verwandt-
schaft der beiden Paradigmata des Namenvergessens. Wir haben
einen zweiten Mechanismus des Vergessens kennen gelernt, die
Störung eines Gedankens durch einen aus dem Verdrängten
kommenden inneren Widerspruch. Wir werden diesem Vorgang,
der uns als der leichter verständliche erscheint, im Laufe dieser
Erörterungen noch wiederholt begegnen.
freudgs4
13
–20