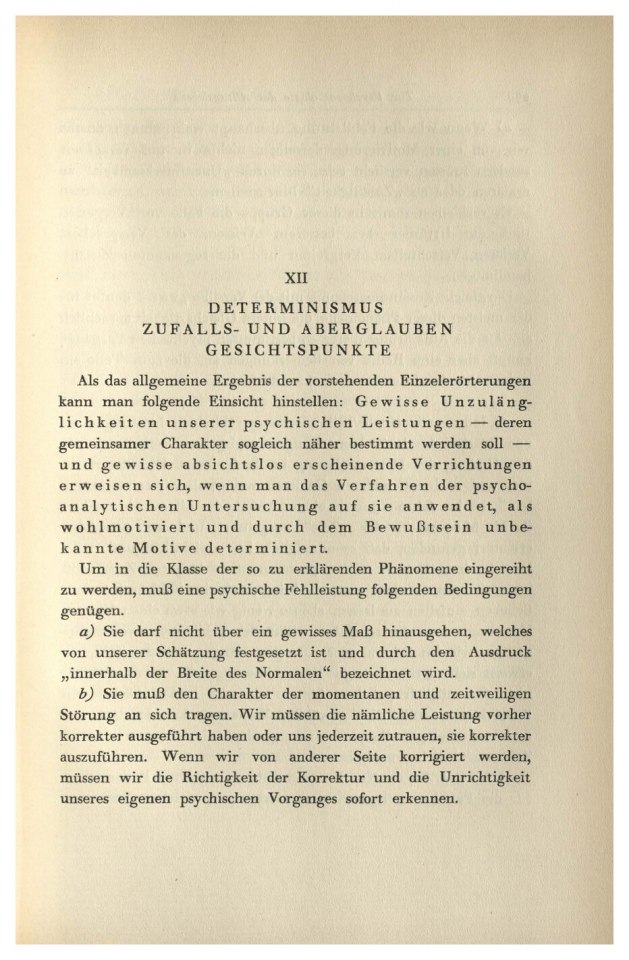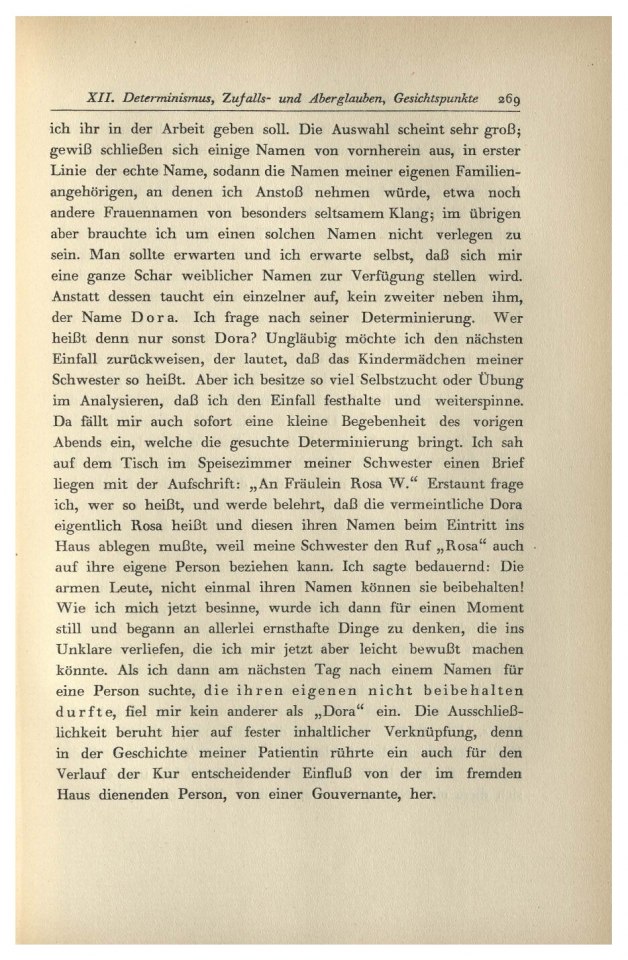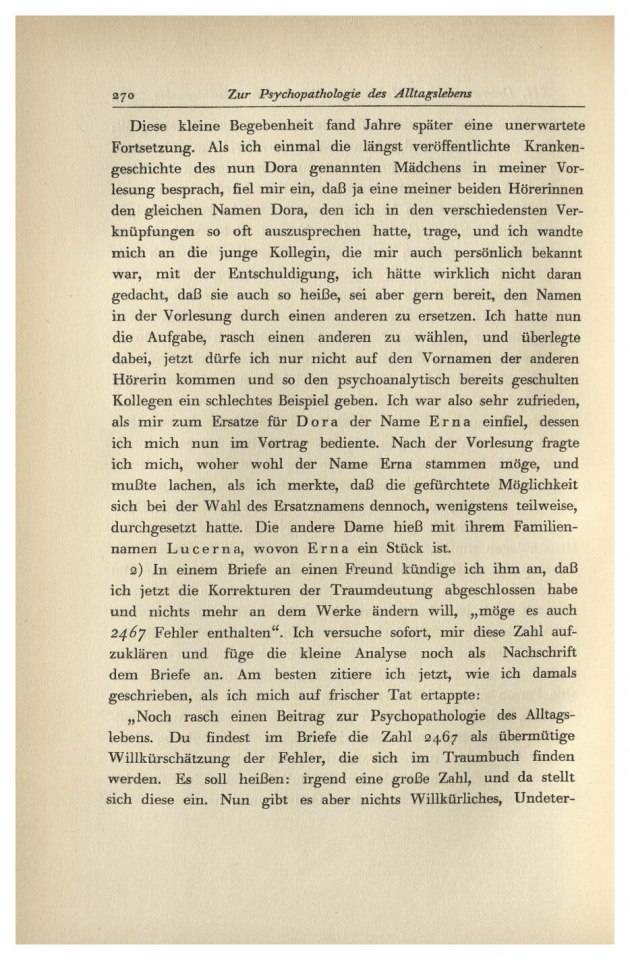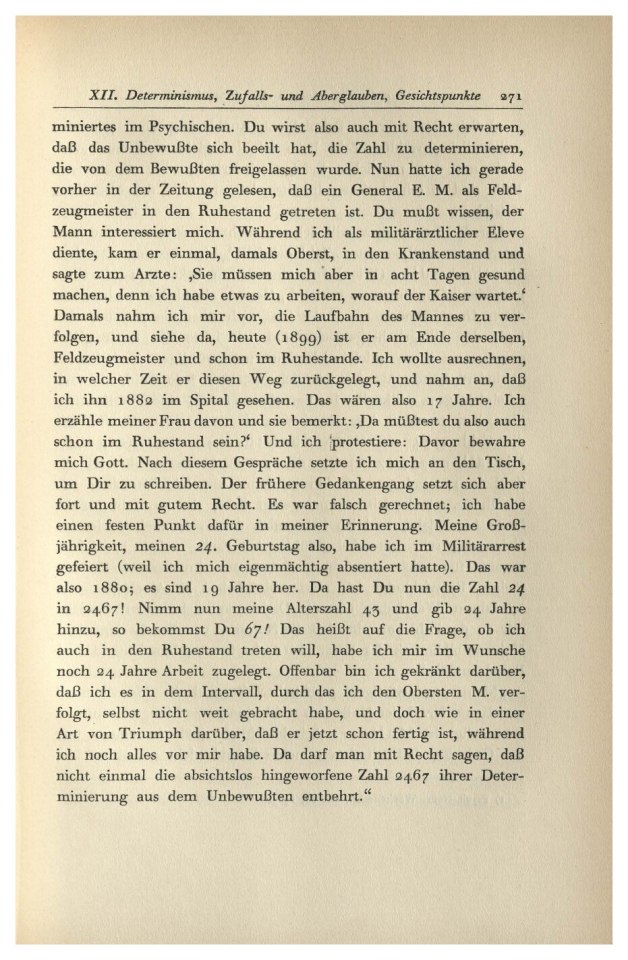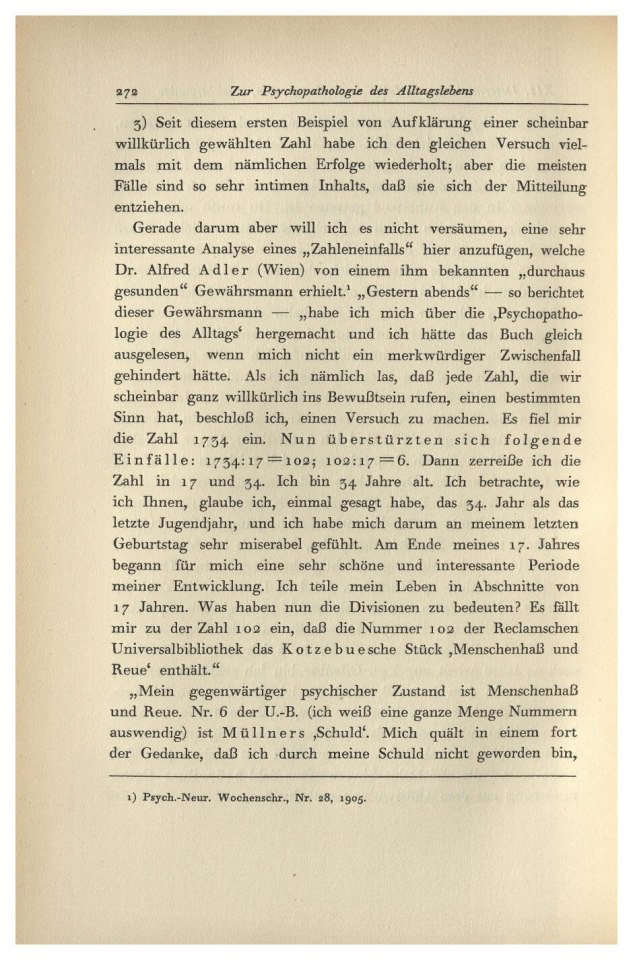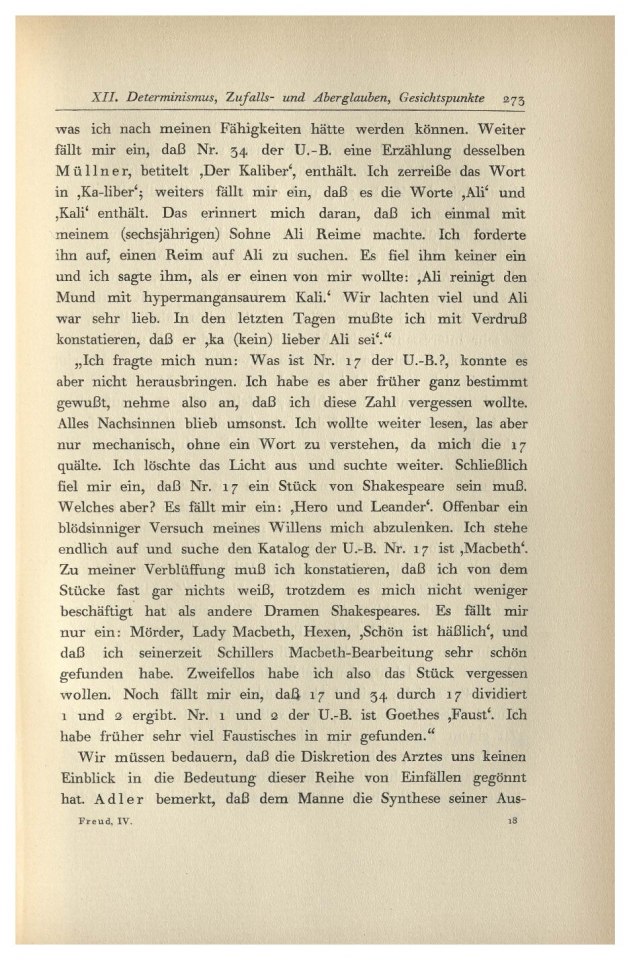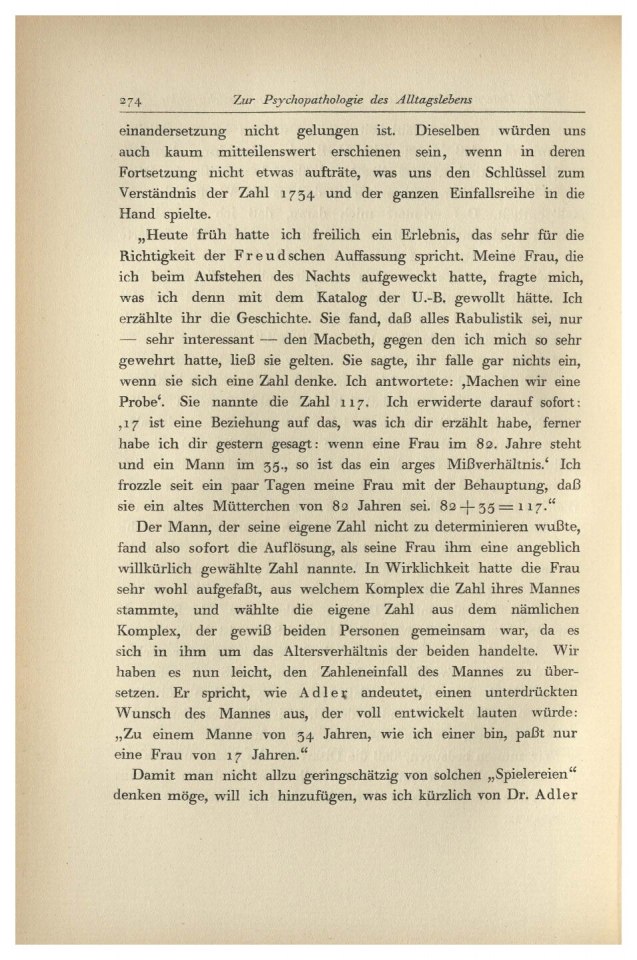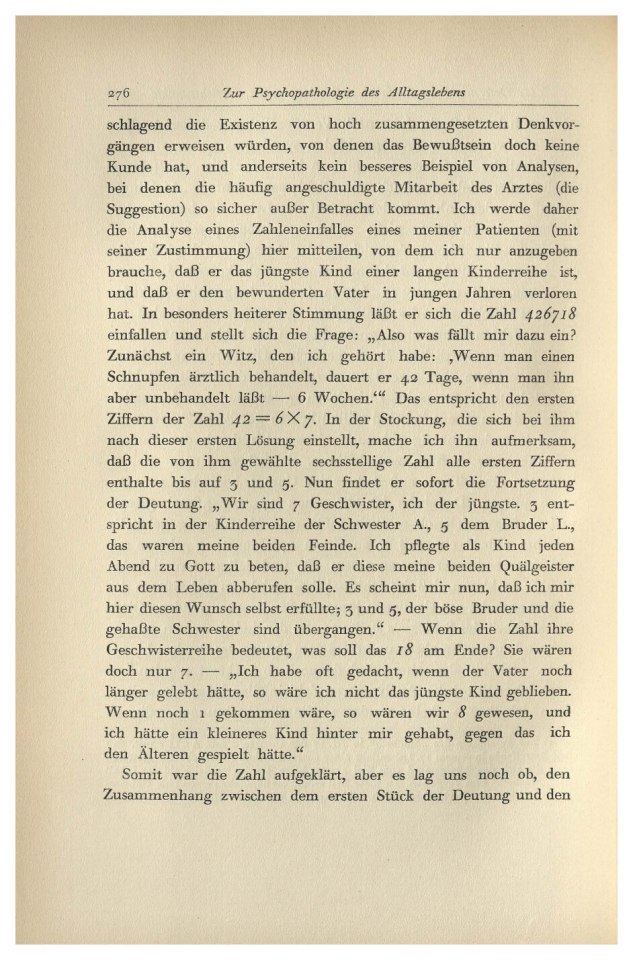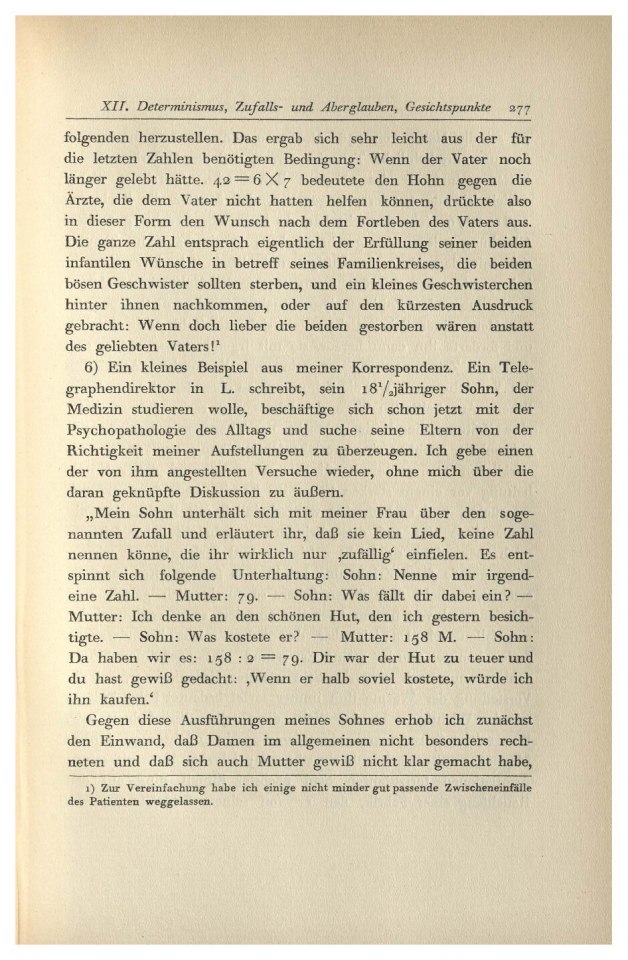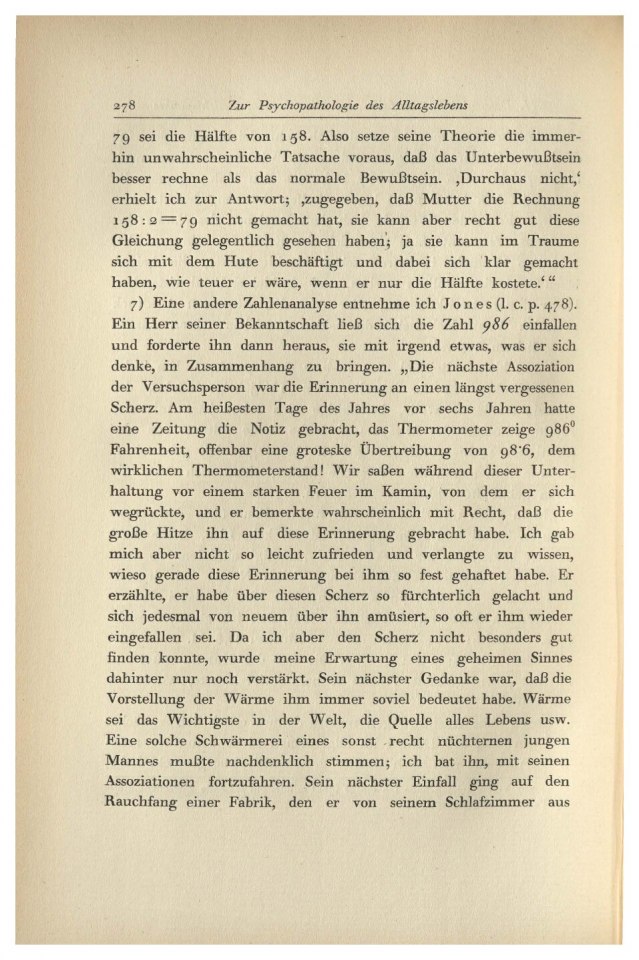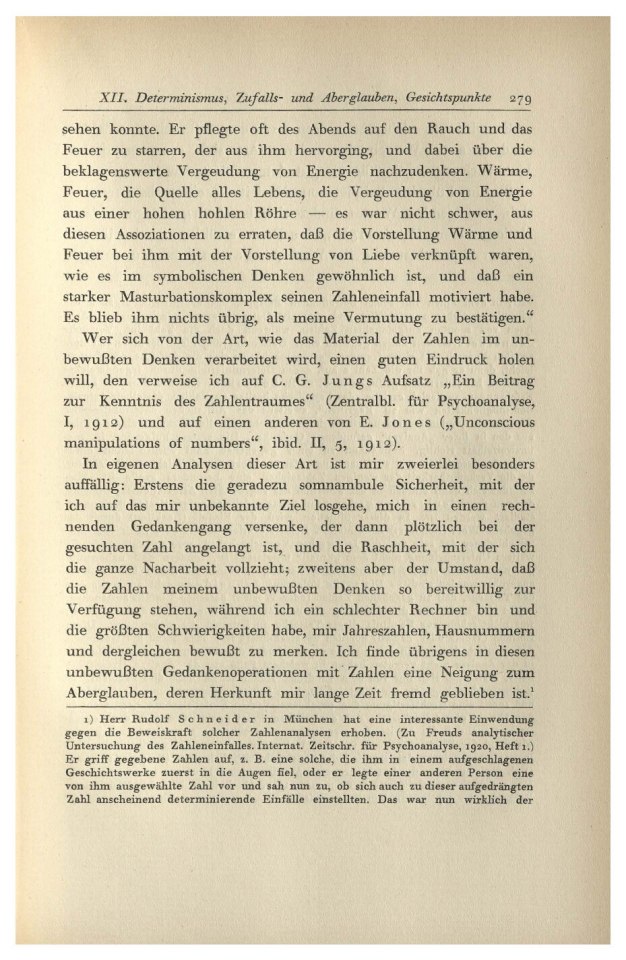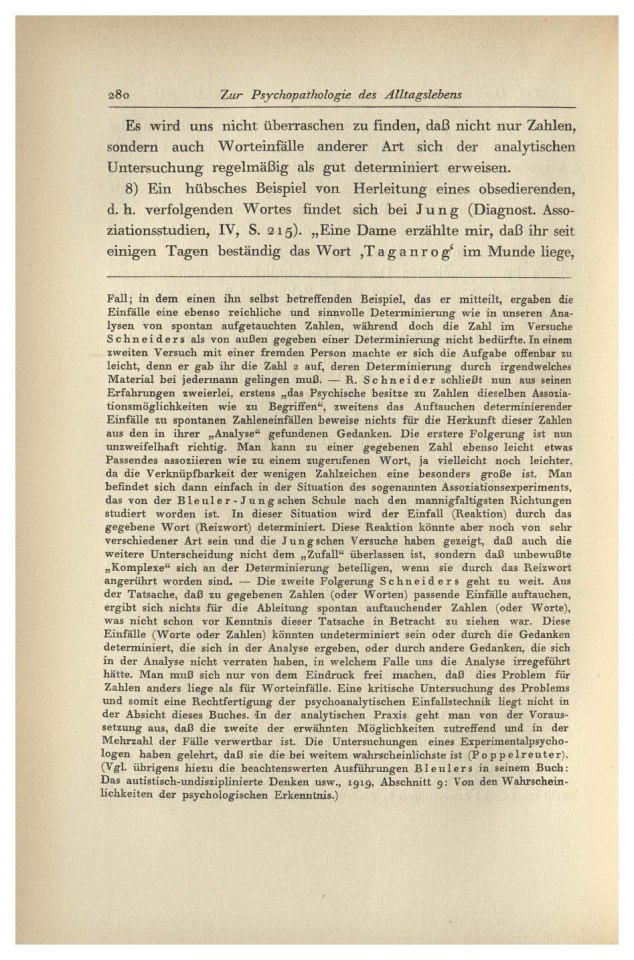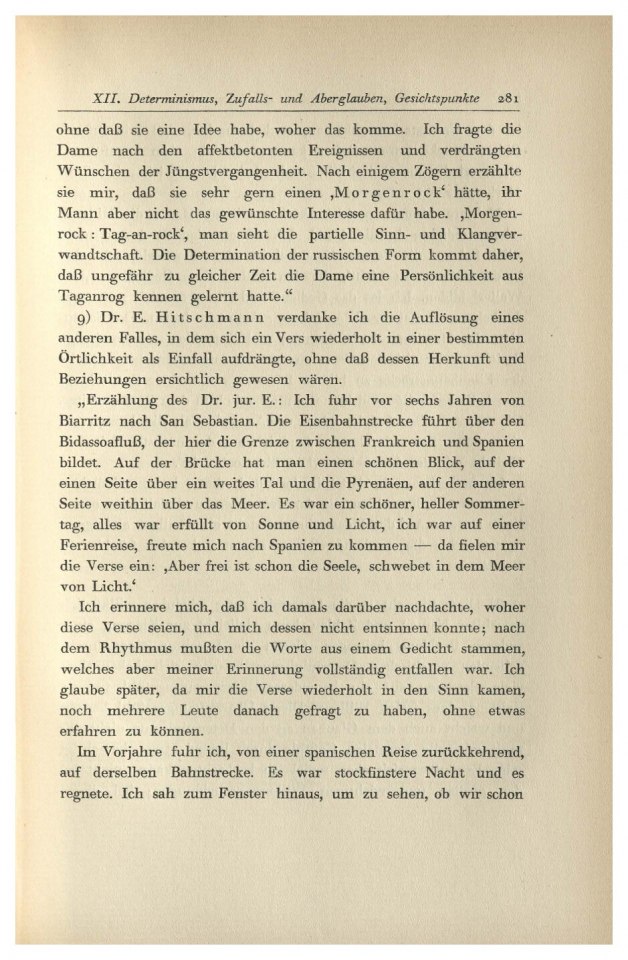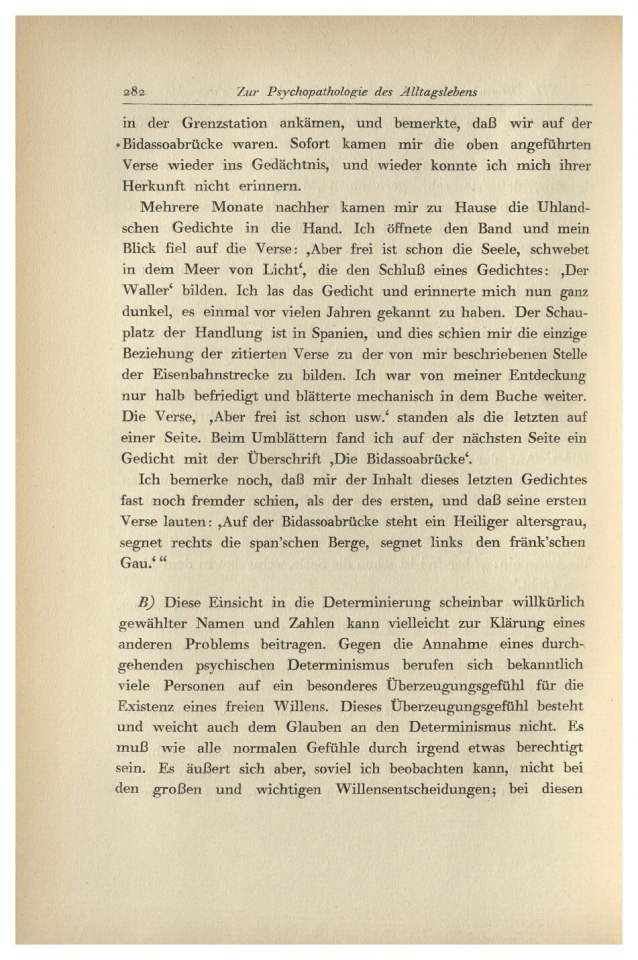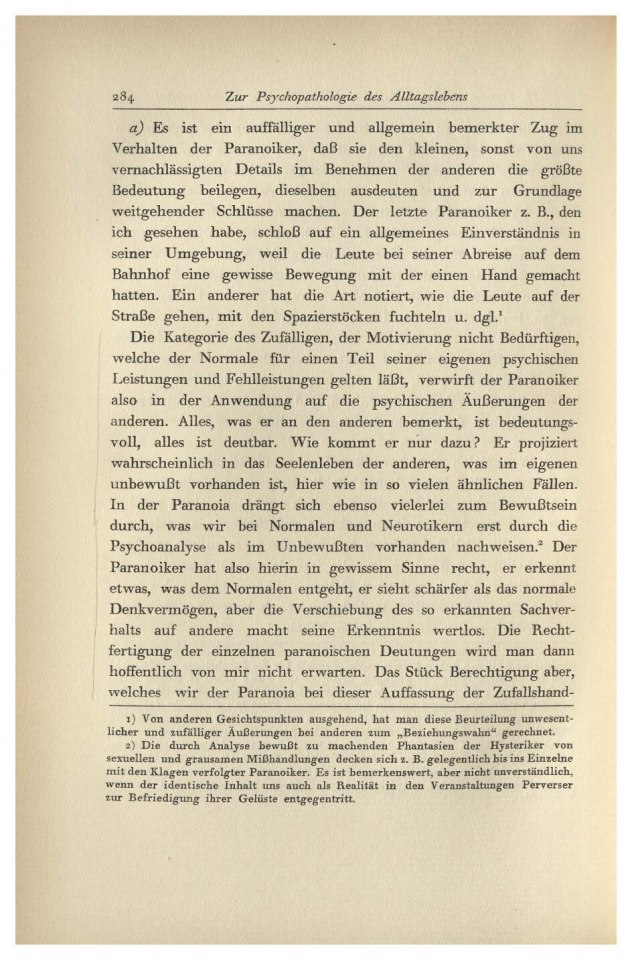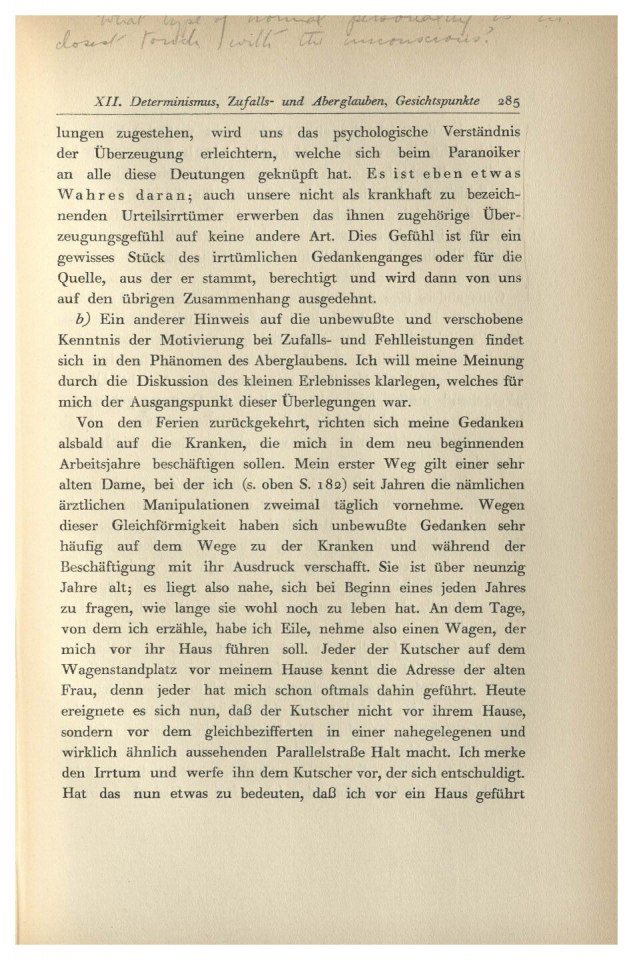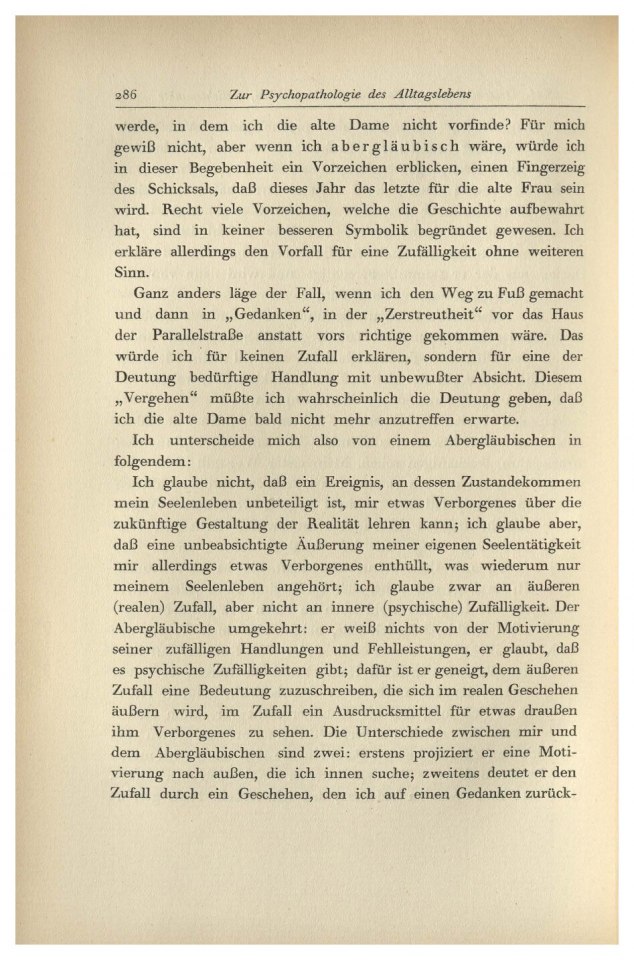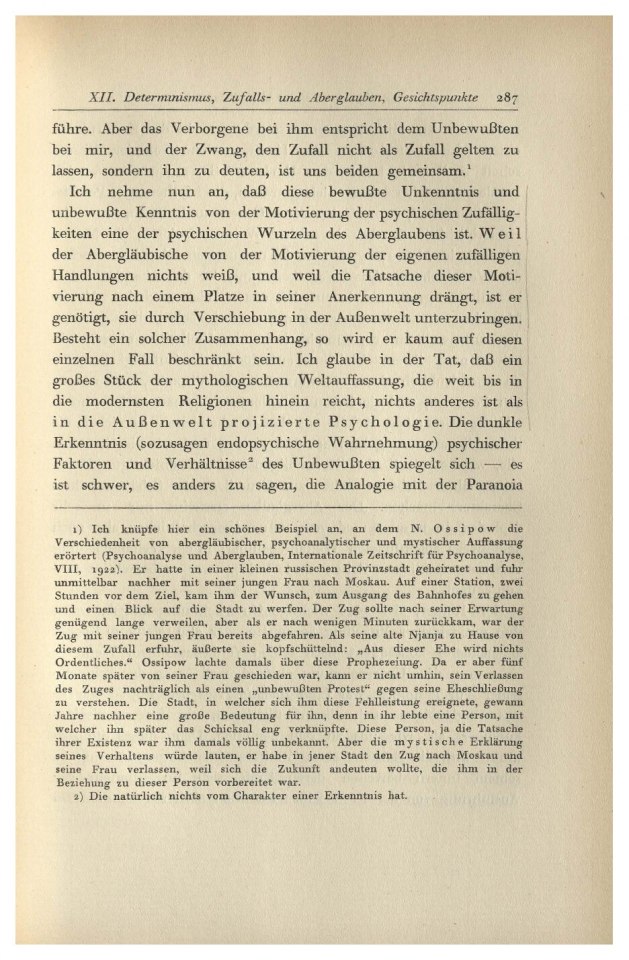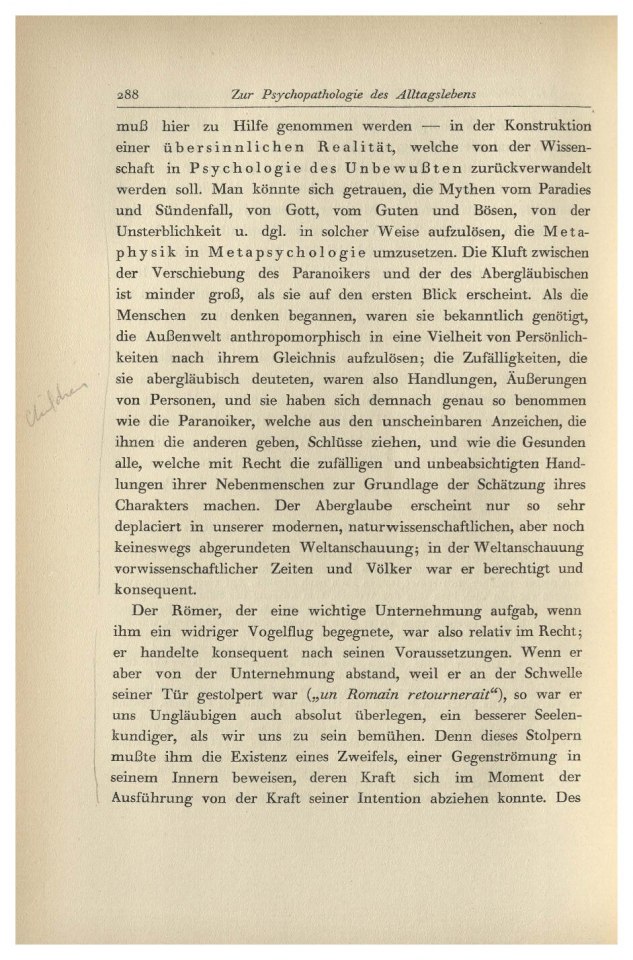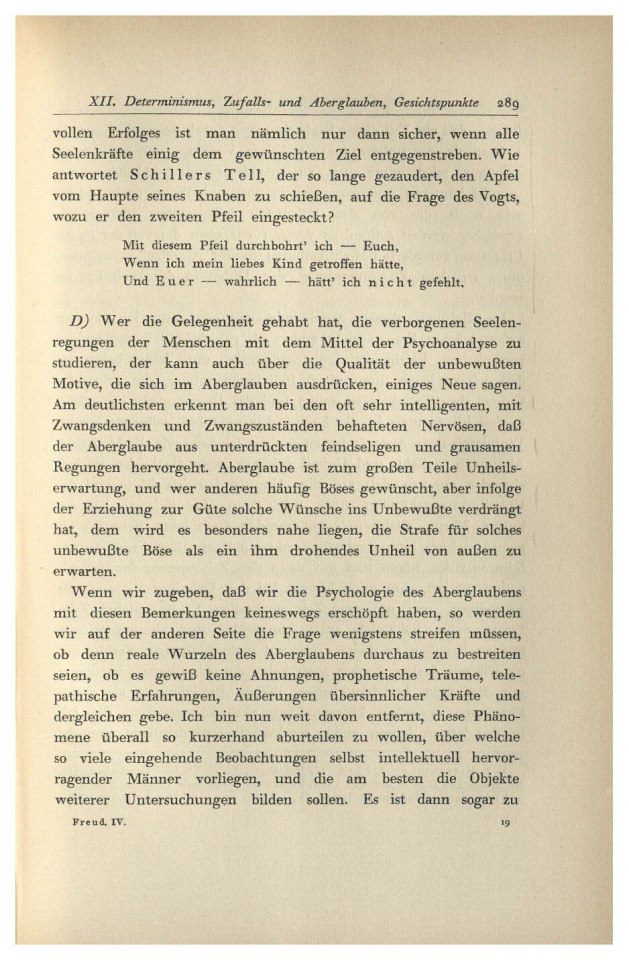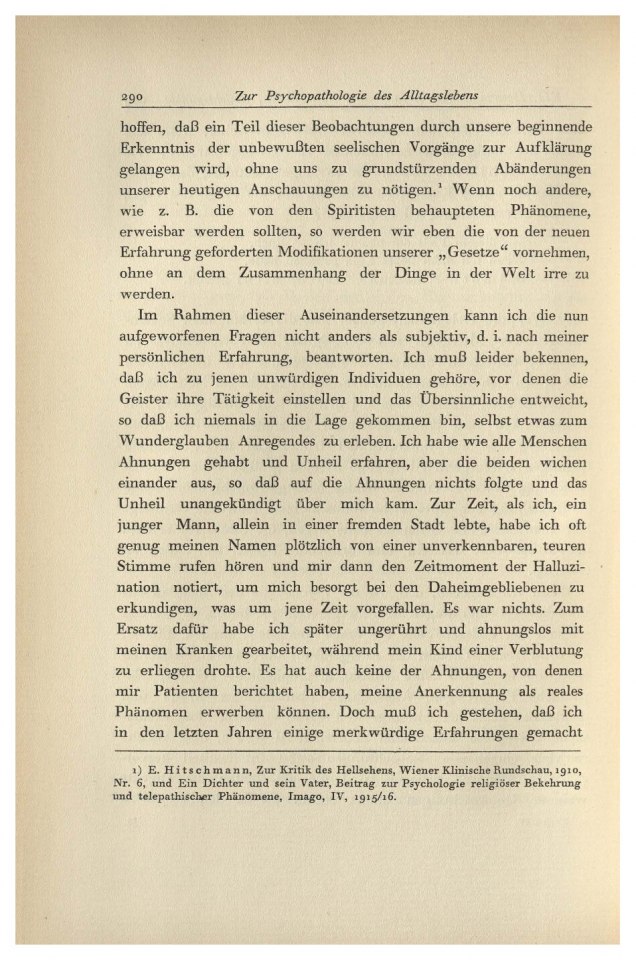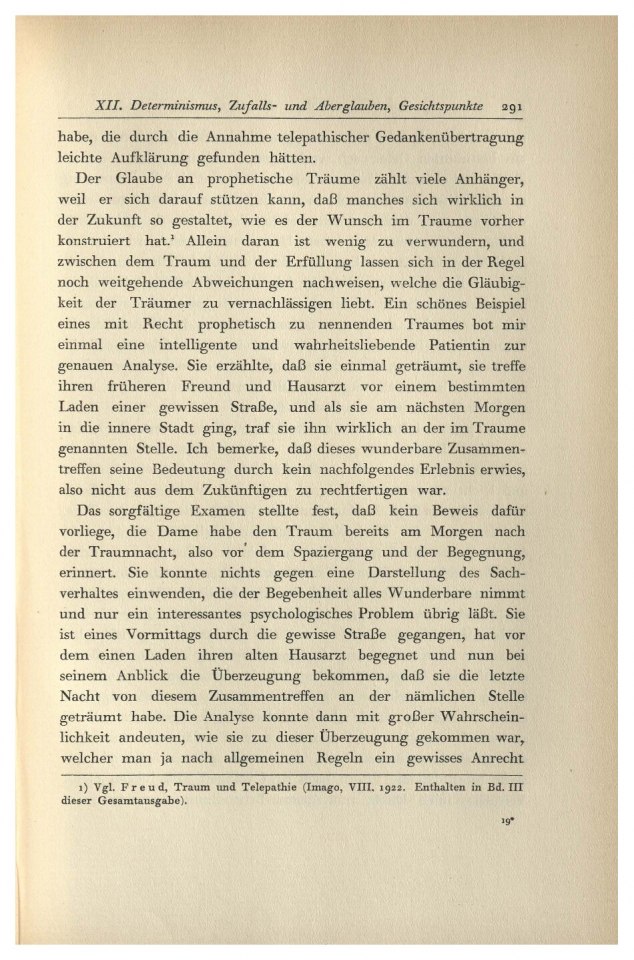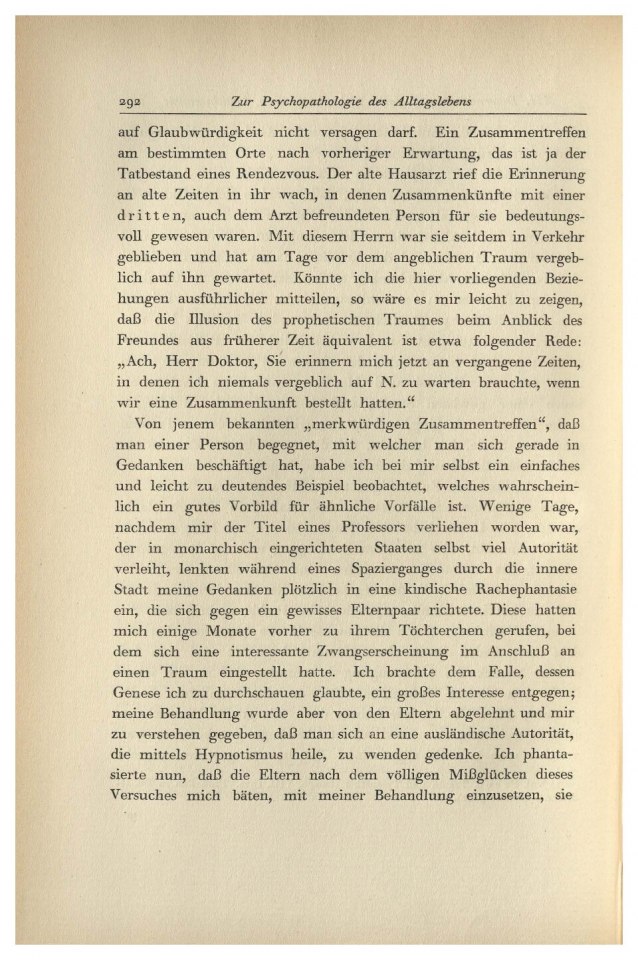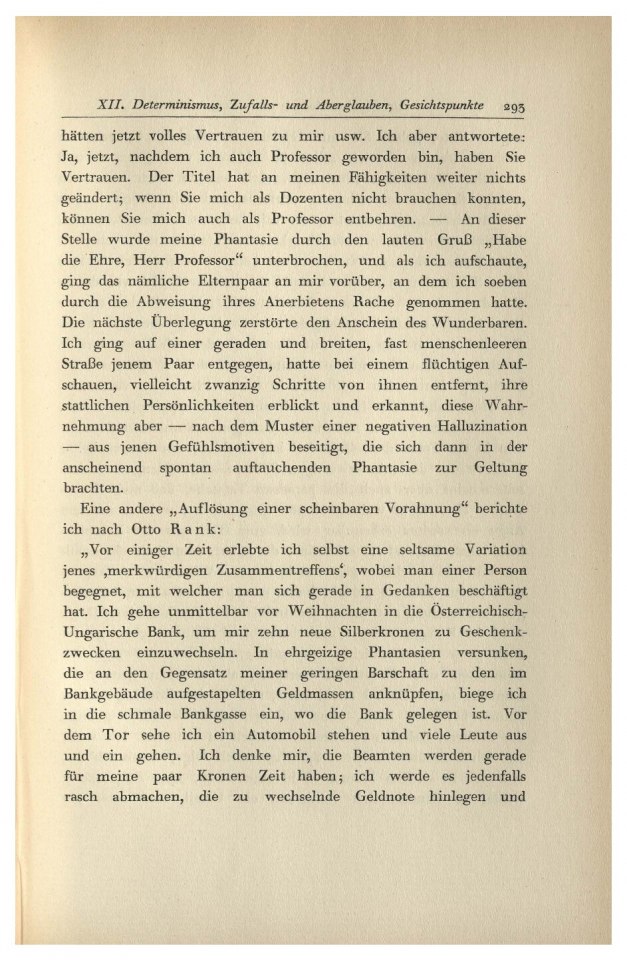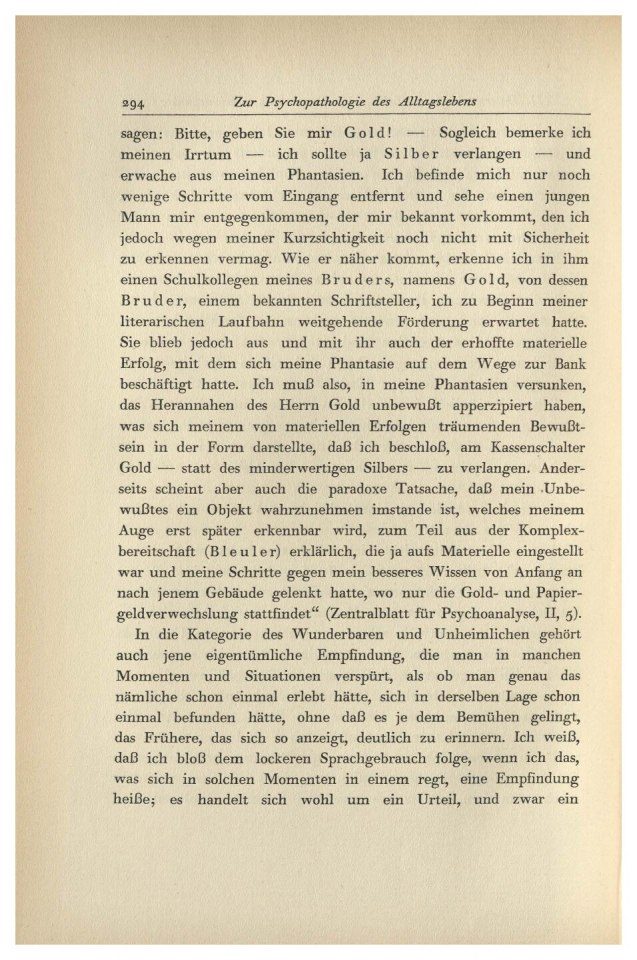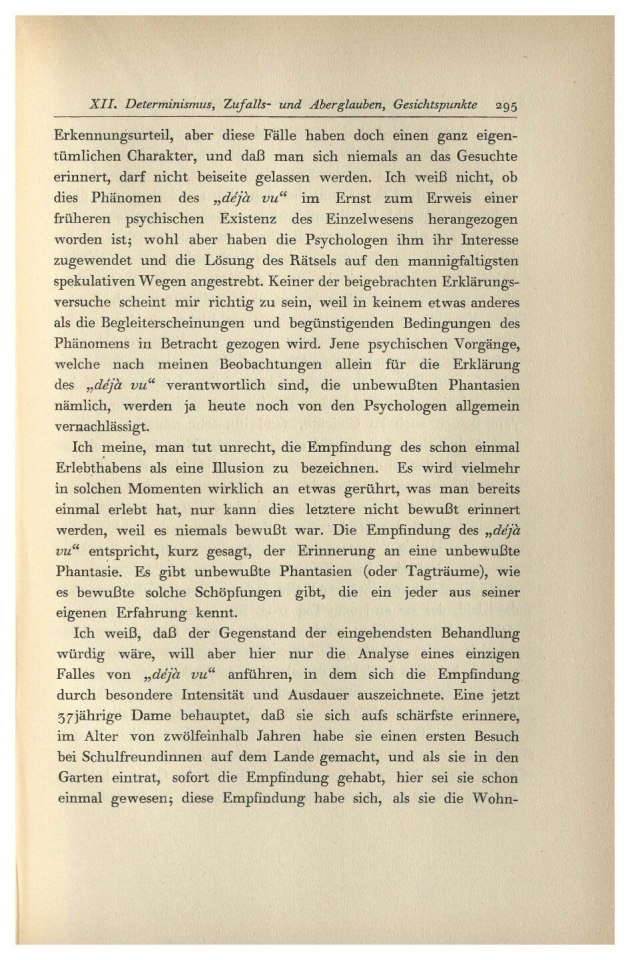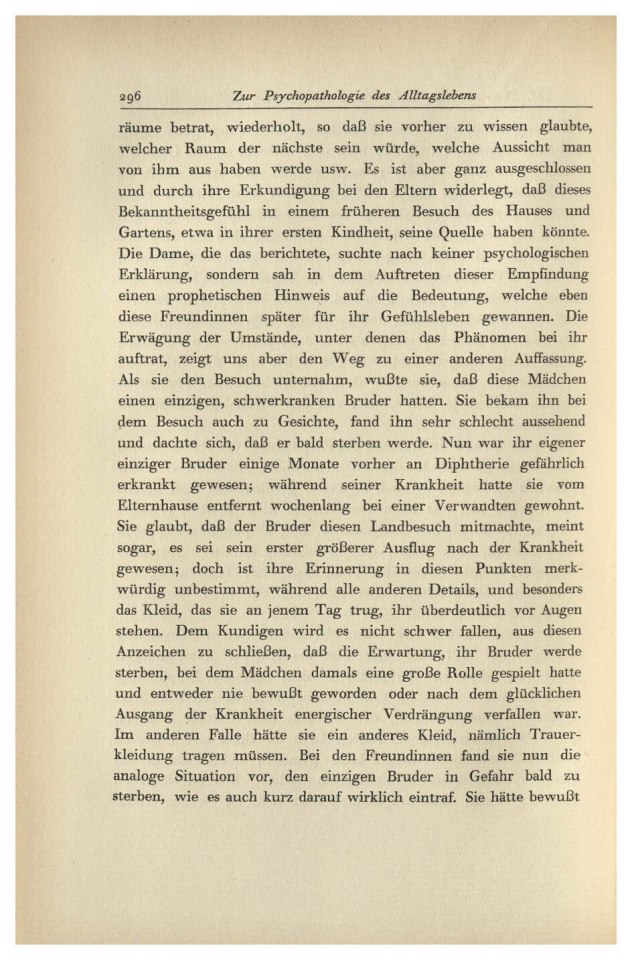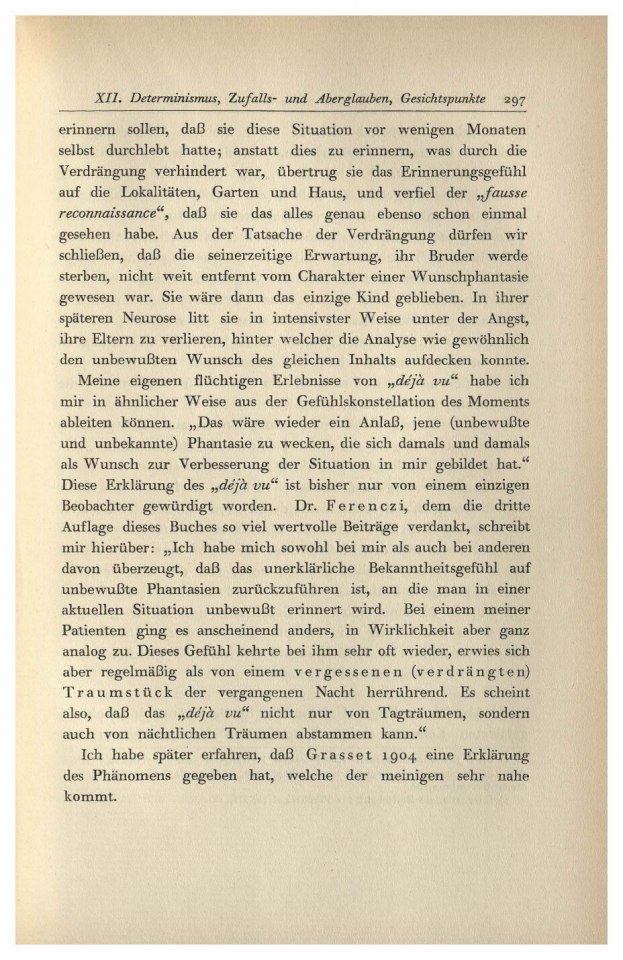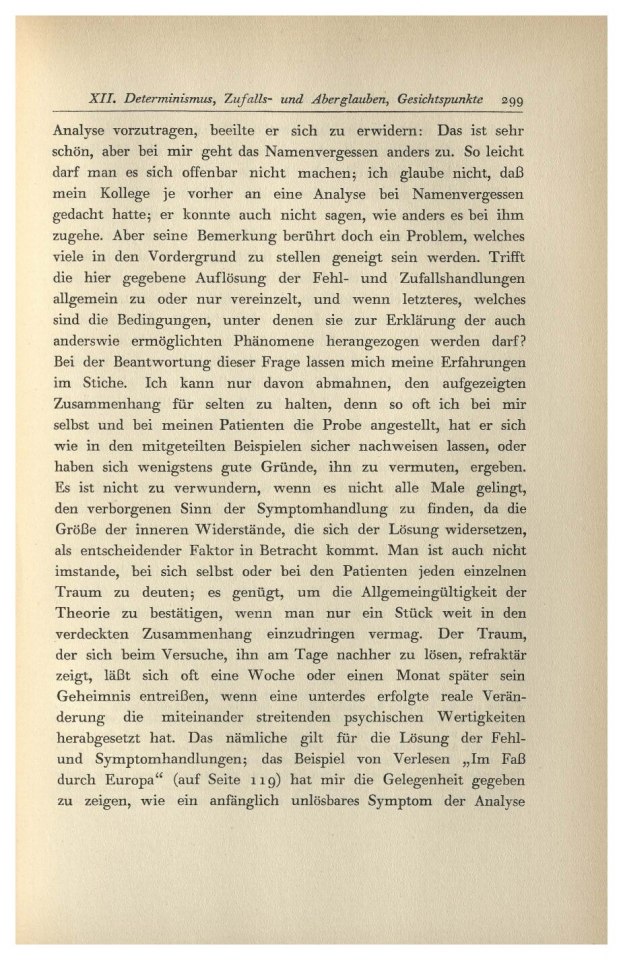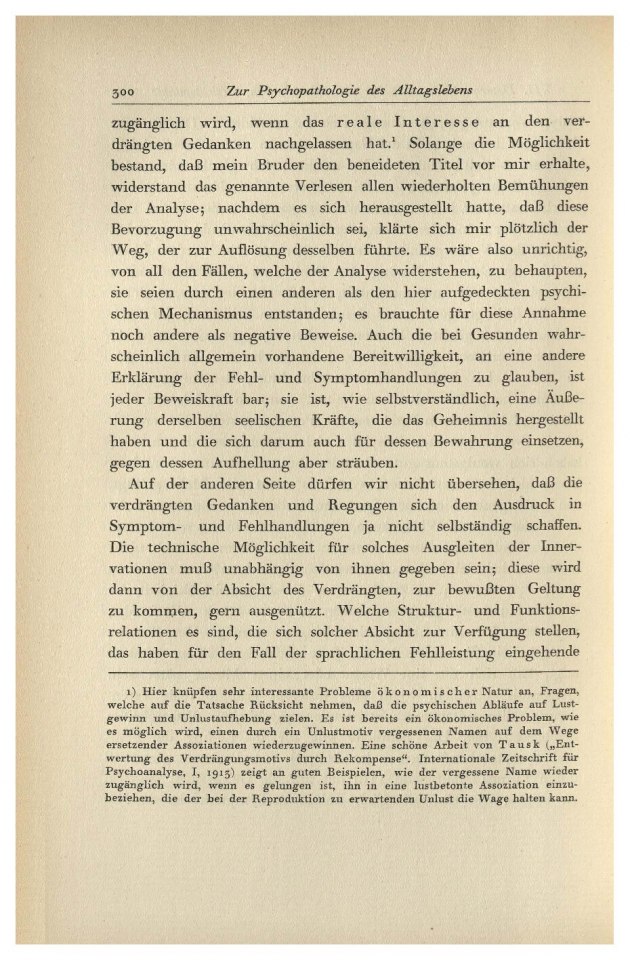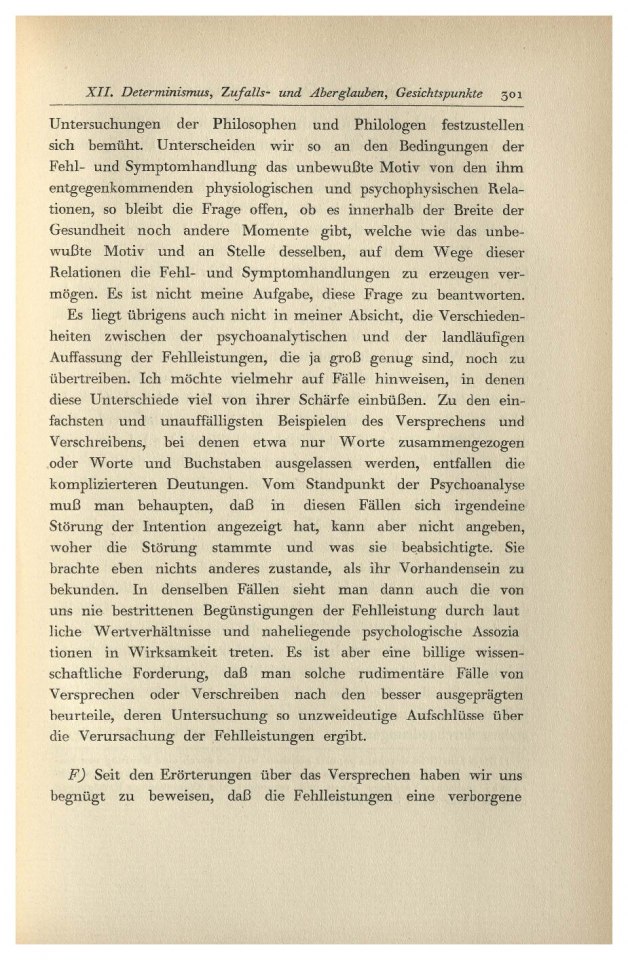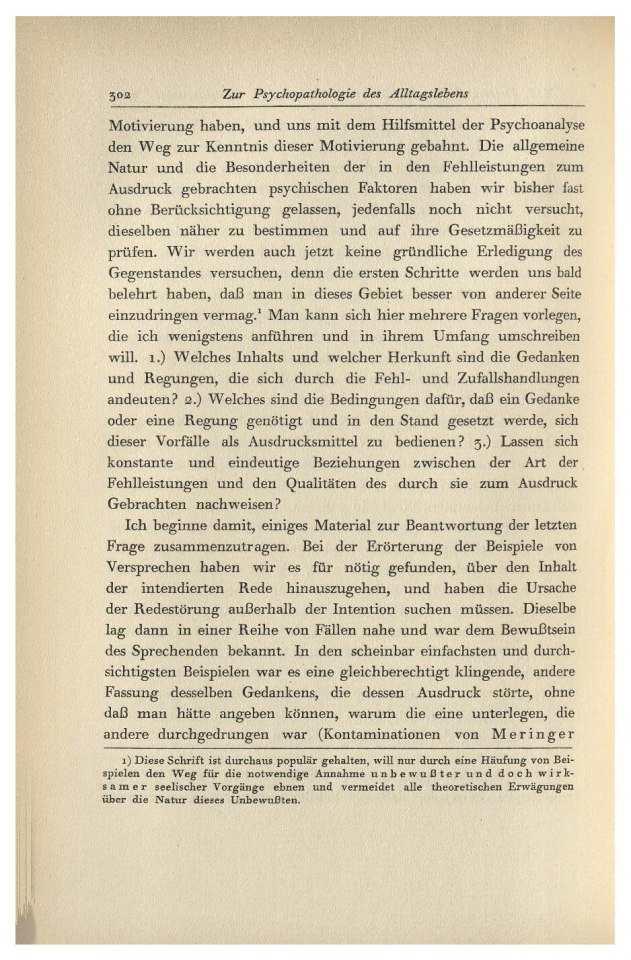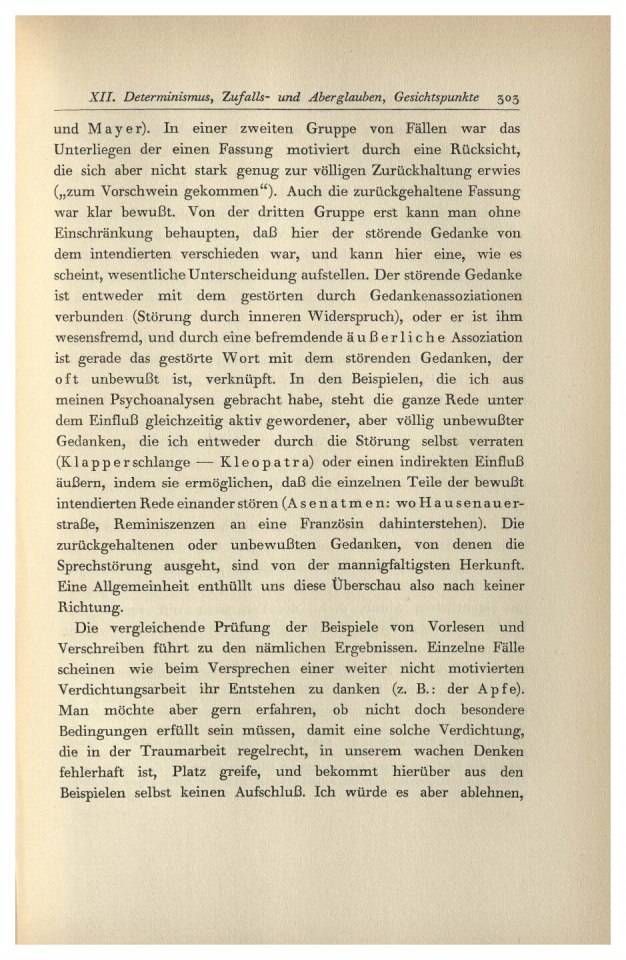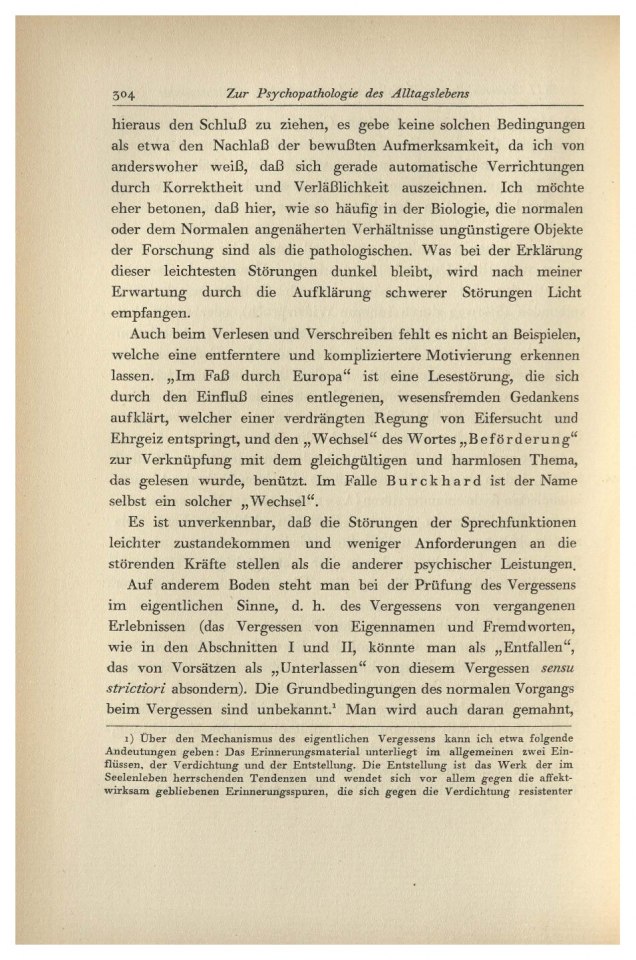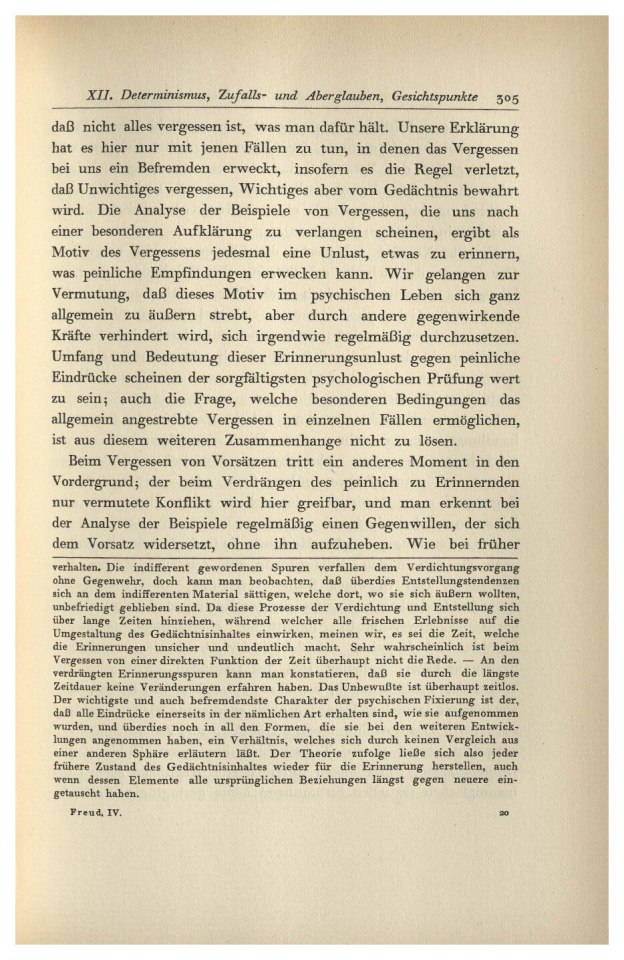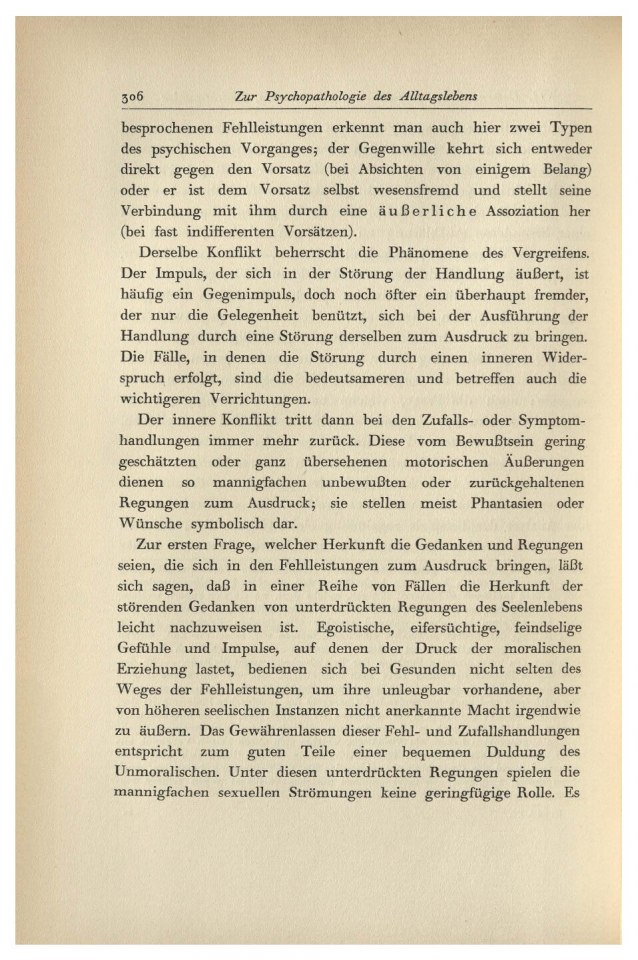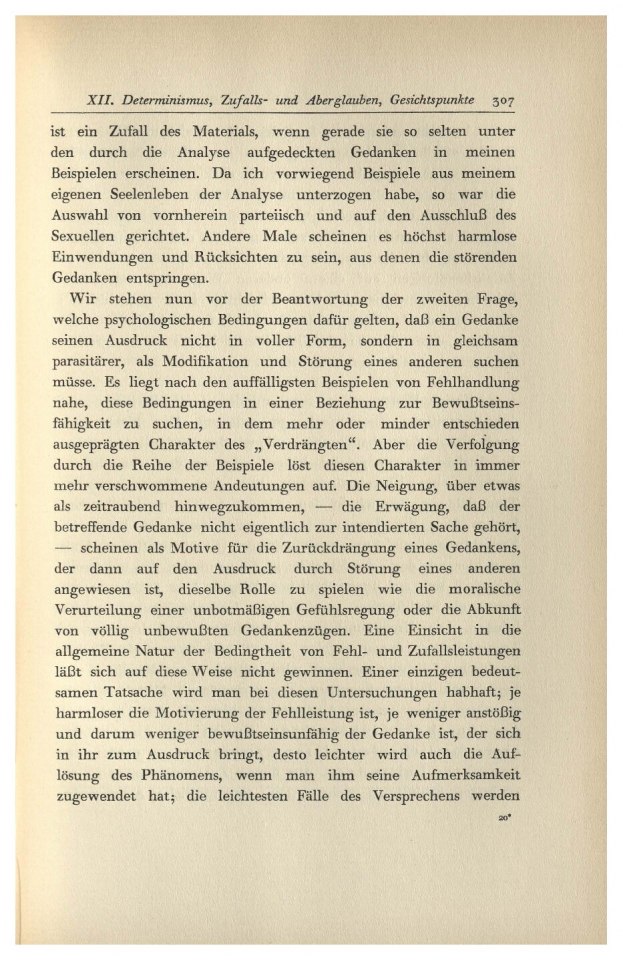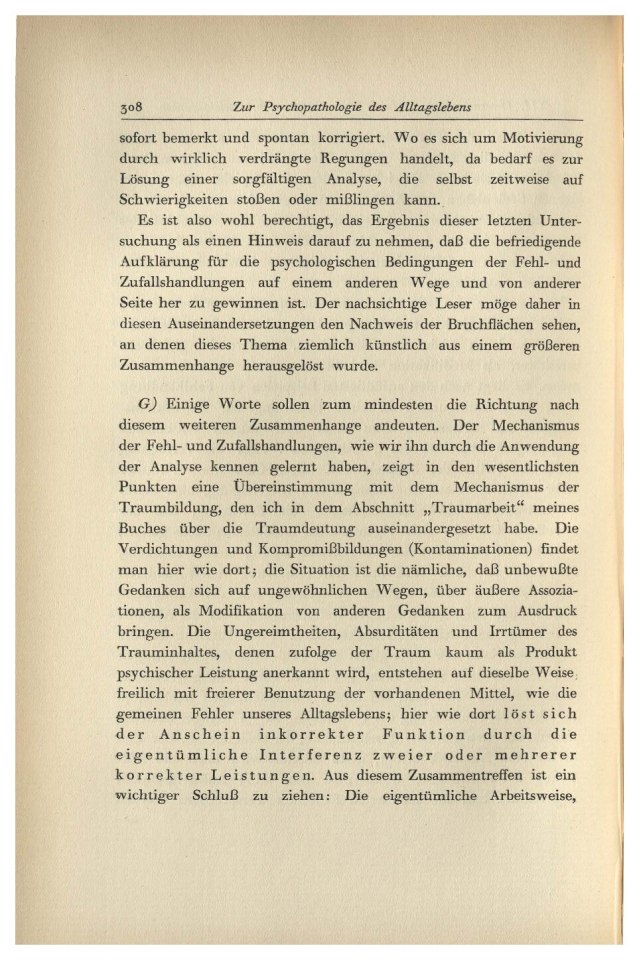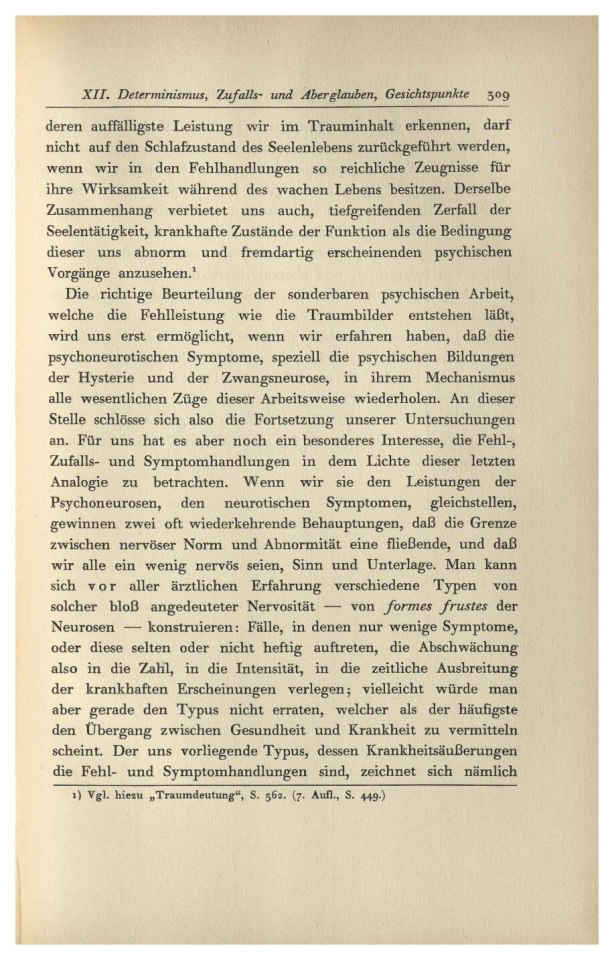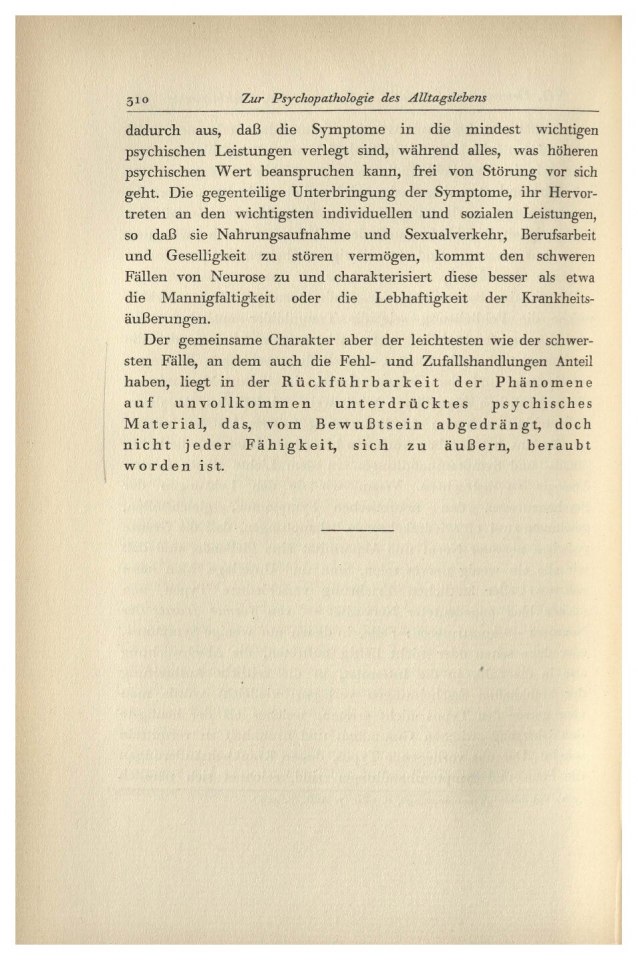S.
[267]
XII
DETERMINISMUS
ZUFALLS- UND ABERGLAUBEN
GESICHTSPUNKTEAls das allgemeine Ergebnis der vorstehenden Einzelerörterungen
kann man folgende Einsicht hinstellen: Gewisse Unzuläng-
lichkeiten unserer psychischen Leistungen — deren
gemeinsamer Charakter sogleich näher bestimmt werden soll —
und gewisse absichtslos erscheinende Verrichtungen
erweisen sich, wenn man das Verfahren der psycho-
analytischen Untersuchung auf sie anwendet, als
wohlmotiviert und durch dem Bewußtsein unbe-
kannte Motive determiniert.Um in die Klasse der so zu erklärenden Phänomene eingereiht
zu werden, muß eine psychische Fehlleistung folgenden Bedingungen
genügen.a) Sie darf nicht über ein gewisses Maß hinausgehen, welches
von unserer Schätzung festgesetzt ist und durch den Ausdruck
„innerhalb der Breite des Normalen“ bezeichnet wird.b) Sie muß den Charakter der momentanen und zeitweiligen
Störung an sich tragen. Wir müssen die nämliche Leistung vorher
korrekter ausgeführt haben oder uns jederzeit zutrauen, sie korrekter
auszuführen. Wenn wir von anderer Seite korrigiert werden,
müssen wir die Richtigkeit der Korrektur und die Unrichtigkeit
unseres eigenen psychischen Vorganges sofort erkennen.S.
268
c) Wenn wir die Fehlleistung überhaupt wahrnehmen, dürfen
wir von einer Motivierung derselben nichts in uns verspüren,
sondern müssen versucht sein, sie durch „Unaufmerksamkeit“ zu
erklären oder als „Zufälligkeit“ hinzustellen.Es verbleiben somit in dieser Gruppe die Fälle von Vergessen
und die Irrtümer bei besserem Wissen, das Versprechen,
Verlesen, Verschreiben, Vergreifen und die sogenannten Zufalls-
handlungen,Die gleiche Zusammensetzung mit der Vorsilbe „ver-“ deutet für
die meisten dieser Phänomene die innere Gleichartigkeit sprachlich
an. An die Aufklärung dieser so bestimmten psychischen Vorgänge
knüpft aber eine Reihe von Bemerkungen an, die zum Teile ein
weitergehendes Interesse erwecken dürfen.A) Indem wir einen Teil unserer psychischen Leistungen als
unaufklärbar durch Zielvorstellungen preisgeben, verkennen wir
den Umfang der Determinierung im Seelenleben. Dieselbe reicht
hier und noch auf anderen Gebieten weiter, als wir es vermuten.
Ich habe im Jahre 1900 in einem Aufsatz des Literaturhistorikers
R. M. Meyer in der „Zeit“ ausgeführt und an Beispielen
erläutert gefunden, daß es unmöglich ist, absichtlich und will-
kürlich einen Unsinn zu komponieren. Seit längerer Zeit weiß
ich, daß man es nicht zustande bringt, sich eine Zahl nach freiem
Belieben einfallen zu lassen, ebenso wenig wie etwa einen Namen.
Untersucht man die scheinbar willkürlich gebildete, etwa mehr-
stellige, wie im Scherz oder Übermut ausgesprochene Zahl, so
erweist sich deren strenge Determinierung, die man wirklich
nicht für möglich gehalten hätte. Ich will nun zunächst ein
Beispiel eines willkürlich gewählten Vornamens kurz erörtern und
dann ein analoges Beispiel einer „gedankenlos hingeworfenen“
Zahl ausführlicher analysieren.1) Im Begriffe, die Krankengeschichte einer meiner Patientinnen
für die Publikation herzurichten, erwäge ich, welchen VornamenS.
269
ich ihr in der Arbeit geben soll. Die Auswahl scheint sehr groß;
gewiß schließen sich einige Namen von vornherein aus, in erster
Linie der echte Name, sodann die Namen meiner eigenen Familien-
angehörigen, an denen ich Anstoß nehmen würde, etwa noch
andere Frauennamen von besonders seltsamem Klang; im übrigen
aber brauchte ich um einen solchen Namen nicht verlegen zu
sein. Man sollte erwarten und ich erwarte selbst, daß sich mir
eine ganze Schar weiblicher Namen zur Verfügung stellen wird.
Anstatt dessen taucht ein einzelner auf, kein zweiter neben ihm,
der Name Dora. Ich frage nach seiner Determinierung. Wer
heißt denn nur sonst Dora? Ungläubig möchte ich den nächsten
Einfall zurückweisen, der lautet, daß das Kindermädchen meiner
Schwester so heißt. Aber ich besitze so viel Selbstzucht oder Übung
im Analysieren, daß ich den Einfall festhalte und weiterspinne.
Da fällt mir auch sofort eine kleine Begebenheit des vorigen
Abends ein, welche die gesuchte Determinierung bringt. Ich sah
auf dem Tisch im Speisezimmer meiner Schwester einen Brief
liegen mit der Aufschrift: „An Fräulein Rosa W.“ Erstaunt frage
ich, wer so heißt, und werde belehrt‚ daß die vermeintliche Dora
eigentlich Rosa heißt und diesen ihren Namen beim Eintritt ins
Haus ablegen mußte, weil meine Schwester den Ruf „Rosa“ auch
auf ihre eigene Person beziehen kann. Ich sagte bedauernd: Die
armen Leute, nicht einmal ihren Namen können sie beibehalten!
Wie ich mich jetzt besinne, wurde ich dann für einen Moment
still und begann an allerlei ernsthafte Dinge zu denken, die ins
Unklare verliefen, die ich mir jetzt aber leicht bewußt machen
könnte. Als ich dann am nächsten Tag nach einem Namen für
eine Person suchte, die ihren eigenen nicht beibehalten
durfte, fiel mir kein anderer als „Dora“ ein. Die Ausschließ-
lichkeit beruht hier auf fester inhaltlicher Verknüpfung, denn
in der Geschichte meiner Patientin führte ein auch für den
Verlauf der Kur entscheidender Einfluß von der im fremden
Haus dienenden Person, von einer Gouvernante, her.S.
270
Diese kleine Begebenheit fand Jahre später eine unerwartete
Fortsetzung. Als ich einmal die längst veröffentlichte Kranken-
geschichte des nun Dora genannten Mädchens in meiner Vor-
lesung besprach, fiel mir ein, daß ja eine meiner beiden Hörerinnen
den gleichen Namen Dora, den ich in den verschiedensten Ver-
knüpfungen so oft auszusprechen hatte, trage, und ich wandte
mich an die junge Kollegin, die mir auch persönlich bekannt
war, mit der Entschuldigung, ich hätte wirklich nicht daran
gedacht, daß sie auch so heiße, sei aber gern bereit, den Namen
in der Vorlesung durch einen anderen zu ersetzen. Ich hatte nun
die Aufgabe, rasch einen anderen zu wählen, und überlegte
dabei, jetzt dürfe ich nur nicht auf den Vornamen der anderen
Hörerin kommen und so den psychoanalytisch bereits geschulten
Kollegen ein schlechtes Beispiel geben. Ich war also sehr zufrieden,
als mir zum Ersatze für Dora der Name Erna einfiel, dessen
ich mich nun im Vortrag bediente. Nach der Vorlesung fragte
ich mich, woher wohl der Name Erna stammen möge, und
mußte lachen, als ich merkte, daß die gefürchtete Möglichkeit
sich bei der Wahl des Ersatznamens dennoch, wenigstens teilweise,
durchgesetzt hatte. Die andere Dame hieß mit ihrem Familien-
namen Lucerna, wovon Erna ein Stück ist.2) In einem Briefe an einen Freund kündige ich ihm an, daß
ich jetzt die Korrekturen der Traumdeutung abgeschlossen habe
und nichts mehr an dem Werke ändern will, „möge es auch
2467 Fehler enthalten“. Ich versuche sofort, mir diese Zahl auf-
zuklären und füge die kleine Analyse noch als Nachschrift
dem Briefe an. Am besten zitiere ich jetzt, wie ich damals
geschrieben, als ich mich auf frischer Tat ertappte:„Noch rasch einen Beitrag zur Psychopathologie des Alltags-
lebens. Du findest im Briefe die Zahl 2467 als übermütige
Willkürschätzung der Fehler, die sich im Traumbuch finden
werden. Es soll heißen: irgend eine große Zahl, und da stellt
sich diese ein. Nun gibt es aber nichts Willkürliches, Undeter-S.
271
miniertes im Psychischen. Du wirst also auch mit Recht erwarten,
daß das Unbewußte sich beeilt hat, die Zahl zu determinieren,
die von dem Bewußten freigelassen wurde. Nun hatte ich gerade
vorher in der Zeitung gelesen, daß ein General E. M. als Feld-
zeugmeister in den Ruhestand getreten ist. Du mußt wissen, der
Mann interessiert mich. Während ich als militärärztlicher Eleve
diente, kam er einmal, damals Oberst, in den Krankenstand und
sagte zum Arzte: ‚Sie müssen mich aber in acht Tagen gesund
machen, denn ich habe etwas zu arbeiten, worauf der Kaiser wartet.‘
Damals nahm ich mir vor, die Laufbahn des Mannes zu ver-
folgen, und siehe da, heute (1899) ist er am Ende derselben,
Feldzeugmeister und schon im Ruhestande. Ich wollte ausrechnen,
in welcher Zeit er diesen Weg zurückgelegt, und nahm an, daß
ich ihn 1882 im Spital gesehen. Das wären also 17 Jahre. Ich
erzähle meiner Frau davon und sie bemerkt: ‚Da müßtest du also auch
schon im Ruhestand sein?‘ Und ich protestiere: Davor bewahre
mich Gott. Nach diesem Gespräche setzte ich mich an den Tisch,
um Dir zu schreiben. Der frühere Gedankengang setzt sich aber
fort und mit gutem Recht. Es war falsch gerechnet; ich habe
einen festen Punkt dafür in meiner Erinnerung. Meine Groß-
jährigkeit, meinen 24. Geburtstag also, habe ich im Militärarrest
gefeiert (weil ich mich eigenmächtig absentiert hatte). Das war
also 1880; es sind 19 Jahre her. Da hast Du nun die Zahl 24
in 2467! Nimm nun meine Alterszahl 43 und gib 24 Jahre
hinzu, so bekommst Du 67! Das heißt auf die Frage, ob ich
auch in den Ruhestand treten will, habe ich mir im Wunsche
noch 24 Jahre Arbeit zugelegt. Offenbar bin ich gekränkt darüber,
daß ich es in dem Intervall, durch das ich den Obersten M. ver-
folgt, selbst nicht weit gebracht habe, und doch wie in einer
Art von Triumph darüber, daß er jetzt schon fertig ist, während
ich noch alles vor mir habe. Da darf man mit Recht sagen, daß
nicht einmal die absichtslos hingeworfene Zahl 2467 ihrer Deter-
minierung aus dem Unbewußten entbehrt.“S.
272
3) Seit diesem ersten Beispiel von Aufklärung einer scheinbar
willkürlich gewählten Zahl habe ich den gleichen Versuch viel-
mals mit dem nämlichen Erfolge wiederholt; aber die meisten
Fälle sind so sehr intimen Inhalts, daß sie sich der Mitteilung
entziehen.Gerade darum aber will ich es nicht versäumen, eine sehr
interessante Analyse eines „Zahleneinfalls“ hier anzufügen, welche
Dr. Alfred Adler (Wien) von einem ihm bekannten „durchaus
gesunden“ Gewährsmann erhielt.1 „Gestern abends“ — so berichtet
dieser Gewährsmann — „habe ich mich über die ,Psychopatho-
logie des Alltags‘ hergemacht und ich hätte das Buch gleich
ausgelesen, wenn mich nicht ein merkwürdiger Zwischenfall
gehindert hätte. Als ich nämlich las, daß jede Zahl, die wir
scheinbar ganz willkürlich ins Bewußtsein rufen, einen bestimmten
Sinn hat, beschloß ich, einen Versuch zu machen. Es fiel mir
die Zahl 1734 ein. Nun überstürzten sich folgende
Einfälle: 1734:17=102; 102:17=6. Dann zerreiße ich die
Zahl in 17 und 34. Ich bin 34 Jahre alt. Ich betrachte, wie
ich Ihnen, glaube ich, einmal gesagt habe, das 34. Jahr als das
letzte Jugendjahr, und ich habe mich darum an meinem letzten
Geburtstag sehr miserabel gefühlt. Am Ende meines 17. Jahres
begann für mich eine sehr schöne und interessante Periode
meiner Entwicklung. Ich teile mein Leben in Abschnitte von
17 Jahren. Was haben nun die Divisionen zu bedeuten? Es fällt
mir zu der Zahl 102 ein, daß die Nummer 102 der Reclamschen
Universalbibliothek das Kotzebuesche Stück ,Menschenhaß und
Reue‘ enthält.“„Mein gegenwärtiger psychischer Zustand ist Menschenhaß
und Reue. Nr. 6 der U.-B. (ich weiß eine ganze Menge Nummern
auswendig) ist Müllners ‚Schuld‘. Mich quält in einem fort
der Gedanke, daß ich durch meine Schuld nicht geworden bin,1) Psych.-Neur. Wochensch.‚ Nr. 28, 1905.
S.
273
was ich nach meinen Fähigkeiten hätte werden können. Weiter
fällt mit ein, daß Nr. 34 der U.-B. eine Erzählung desselben
Müllner, betitelt ‚Der Kaliber‘, enthält. Ich zerreiße das Wort
in ‚Ka-liber‘; weiters fällt mir ein, daß es die Worte ‚Ali‘ und
‚Kali‘ enthält. Das erinnert mich daran, daß ich einmal mit
meinem (sechsjährigen) Sohne Ali Reime machte. Ich forderte
ihn auf, einen Reim auf Ali zu suchen. Es fiel ihm keiner ein
und ich sagte ihm, als er einen von mir wollte: ‚Ali reinigt den
Mund mit hypermangansaurem Kali.‘ Wir lachten viel und Ali
war sehr lieb. In den letzten Tagen mußte ich mit Verdruß
konstatieren, daß er ‚ka (kein) lieber Ali sei‘.“„Ich fragte mich nun: Was ist Nr. 17 der U.-B.?, konnte es
aber nicht herausbringen. Ich habe es aber früher ganz bestimmt
gewußt, nehme also an, daß ich diese Zahl vergessen wollte.
Alles Nachsinnen blieb umsonst. Ich wollte weiter lesen, las aber
nur mechanisch, ohne ein Wort zu verstehen, da mich die 17
quälte. Ich löschte das Licht aus und suchte weiter. Schließlich
fiel mir ein, daß Nr. 17 ein Stück von Shakespeare sein muß.
Welches aber? Es fällt mir ein: ,Hero und Leander‘. Offenbar ein
blödsinniger Versuch meines Willens mich abzulenken. Ich stehe
endlich auf und suche den Katalog der U.-B. Nr. 17 ist ‚Macbeth‘.
Zu meiner Verblüffung muß ich konstatieren, daß ich von dem
Stücke fast gar nichts weiß, trotzdem es mich nicht weniger
beschäftigt hat als andere Dramen Shakespeares. Es fällt mir
nur ein: Mörder, Lady Macbeth, Hexen, ‚Schön ist häßlich‘, und
daß ich seinerzeit Schillers Macbeth-Bearbeitung sehr schön
gefunden habe. Zweifellos habe ich also das Stück vergessen
wollen. Noch fällt mir ein, daß 17 und 34 durch 17 dividiert
1 und 2 ergibt. Nr. 1 und 2 der U.-B. ist Goethes ‚Faust‘. Ich
habe früher sehr viel Faustisches in mir gefunden.“Wir müssen bedauern, daß die Diskretion des Arztes uns keinen
Einblick in die Bedeutung dieser Reihe von Einfallen gegönnt
hat. Adler bemerkt, daß dem Manne die Synthese seiner Aus-S.
274
einandersetzung nicht gelungen ist. Dieselben würden uns
auch kaum mitteilenswert erschienen sein, wenn in deren
Fortsetzung nicht etwas aufträte, was uns den Schlüssel zum
Verständnis der Zahl 1734 und der ganzen Einfallsreihe in die
Hand spielte.„Heute früh hatte ich freilich ein Erlebnis, das sehr für die
Richtigkeit der Freudschen Auffassung spricht. Meine Frau, die
ich beim Aufstehen des Nachts aufgeweckt hatte, fragte mich,
was ich denn mit dem Katalog der U.-B. gewollt hätte. Ich
erzählte ihr die Geschichte. Sie fand, daß alles Rabulistik sei, nur
— sehr interessant — den Macbeth, gegen den ich mich so sehr
gewehrt hatte, ließ sie gelten. Sie sagte, ihr falle gar nichts ein,
wenn sie sich eine Zahl denke. Ich antwortete: ‚Machen wir eine
Probe‘. Sie nannte die Zahl 117. Ich erwiderte darauf sofort:
‚17 ist eine Beziehung auf das, was ich dir erzählt habe, ferner
habe ich dir gestern gesagt: wenn eine Frau im 82. Jahre steht
und ein Mann im 35., so ist das ein arges Mißverhältnis.‘ Ich
frozzle seit ein paar Tagen meine Frau mit der Behauptung, daß
sie ein altes Mütterchen von 82 Jahren sei. 82+35=117.“Der Mann, der seine eigene Zahl nicht zu determinieren wußte,
fand also sofort die Auflösung, als seine Frau ihm eine angeblich
willkürlich gewählte Zahl nannte. In Wirklichkeit hatte die Frau
sehr wohl aufgefaßt, aus welchem Komplex die Zahl ihres Mannes
stammte, und wählte die eigene Zahl aus dem nämlichen
Komplex, der gewiß beiden Personen gemeinsam war, da es
sich in ihm um das Altersverhältnis der beiden handelte. Wir
haben es nun leicht, den Zahleneinfall des Mannes zu über-
setzen. Er spricht, wie Adler andeutet, einen unterdrückten
Wunsch des Mannes aus, der voll entwickelt lauten würde:
„Zu einem Manne von 34 Jahren, wie ich einer bin, paßt nur
eine Frau von 17 Jahren.“Damit man nicht allzu geringschätzig von solchen „Spielereien“
denken möge, will ich hinzufügen, was ich kürzlich von Dr. AdlerS.
275
erfahren habe, daß ein Jahr nach Veröffentlichung dieser Analyse
der Mann von seiner Frau geschieden war.14.) Ähnliche Aufklärungen gibt Adler für die Entstehung
obsedierender Zahlen. Auch die Wahl sogenannter „Lieblings-
zahlen“ ist nicht ohne Beziehung auf das Lebenden der betreffenden
Person und entbehrt nicht eines gewissen psychologischen
Interesses. Ein Mann, der sich zu der besonderen Vorliebe für
die Zahlen 17 und 19 bekannte, wußte nach kurzem Besinnen
anzugeben, daß er mit 17 Jahren in die langersehnte akade-
mische Freiheit, auf die Universität, gekommen, und daß er
mit 19 Jahren seine erste große Reise und bald darauf seinen
ersten wissenschaftlichen Fund gemacht. Die Fixierung dieser
Vorliebe erfolgte aber zwei Lustren später, als die gleichen Zahlen
zur Bedeutung für sein Liebesleben gelangten. — Ja, selbst
Zahlen, die man anscheinend willkürlich in gewissem Zusammen-
hange besonders häufig gebraucht, lassen sich durch die Analyse
auf unerwarteten Sinn zurückführen. So fiel es einem meiner
Patienten eines Tages auf, daß er im Unmut besonders gern zu
sagen pflegte: Das habe ich dir schon 17- bis 36mal gesagt,
und er fragte sich, ob es auch dafür eine Motivierung gebe. Es
fiel ihm alsbald ein, daß er an einem 27. Monatstag geboren sei,
sein jüngerer Bruder aber an einem 26., und daß er Grund habe,
darüber zu klagen, daß das Schicksal ihm soviel von den Gütern des
Lebens geraubt, um sie diesem jüngeren Bruder zuzuwenden. Diese
Parteilichkeit des Schicksals stellte er also dar, indem er von seinem
Geburtsdatum zehn abzog und diese zum Datum des Bruders hinzu-
fügte. „Ich bin der Ältere und dennoch so verkürzt worden.“5) Ich will bei den Analysen von Zahleinfällen länger verweilen,
denn ich kenne keine anderen Einzelbeobachtungen, die so1) Zur Aufklärung des „Macbeth“ in Nr. 17 der U.-B. teilt mir Adler mit, daß
der Betreffende in seinem 17. Lebensjahr einer anarchistischen Gesellschaft beigetreten
war, die sich den Königsmord zum Ziel gesetzt hatte. Darum verfiel wohl der Inhalt
des „Macbeth“ dem Vergessen. Zu jener Zeit erfand die nämliche Person eine Geheim-
schrift, in der die Buchstaben durch Zahlen ersetzt waren.S.
276
schlagend die Existenz von hoch zusammengesetzten Denkvor-
gäugen erweisen würden, von denen das Bewußtsein doch keine
Kunde hat, und anderseits kein besseres Beispiel von Analysen,
bei denen die häufig angeschuldigte Mitarbeit des Arztes (die
Suggestion) so sicher außer Betracht kommt. Ich werde daher
die Analyse eines Zahleneinfalles eines meiner Patienten (mit
seiner Zustimmung) hier mitteilen, von dem ich nur anzugeben
brauche, daß er das jüngste Kind einer langen Kinderreihe ist,
und daß er den bewunderten Vater in jungen Jahren verloren
hat. In besonders heiterer Stimmung läßt er sich die Zahl 426718
einfallen und stellt sich die Frage: „Also was fällt mir dazu ein?
Zunächst ein Witz, den ich gehört habe: ‚Wenn man einen
Schnupfen ärztlich behandelt, dauert er 42 Tage, wenn man ihn
aber unbehandelt läßt — 6 Wochen.‘“ Das entspricht den ersten
Ziffern der Zahl 42 = 6 X 7. In der Stockung, die sich bei ihm
nach dieser ersten Lösung einstellt, mache ich ihn aufmerksam,
daß die von ihm gewählte sechsstellige Zahl alle ersten Ziffern
enthalte bis auf 3 und 5. Nun findet er sofort die Fortsetzung
der Deutung. „Wir sind 7 Geschwister, ich der jüngste. 3 ent-
spricht in der Kinderreihe der Schwester A., 5 dem Bruder L.,
das waren meine beiden Feinde. Ich pflegte als Kind jeden
Abend zu Gott zu beten, daß er diese meine beiden Quälgeister
aus dem Leben abberufen solle. Es scheint mir nun, daß ich mir
hier diesen Wunsch selbst erfüllte; 3 und 5, der böse Bruder und die
gehaßte Schwester sind übergangen.“ — Wenn die Zahl ihre
Geschwisterreihe bedeutet, was soll das 18 am Ende? Sie wären
doch nur 7. — „Ich habe oft gedacht, wenn der Vater noch
länger gelebt hätte, so wäre ich nicht das jüngste Kind geblieben.
Wenn noch 1 gekommen wäre, so wären wir 8 gewesen, und
ich hätte ein kleineres Kind hinter mir gehabt, gegen das ich
den Älteren gespielt hätte.“Somit war die Zahl aufgeklärt, aber es lag uns noch ob, den
Zusammenhang zwischen dem ersten Stück der Deutung und denS.
277
folgenden herzustellen. Das ergab sich sehr leicht aus der für
die letzten Zahlen benötigten Bedingung: Wenn der Vater noch
länger gelebt hätte. 42 = 6 X 7 bedeutete den Hohn gegen die
Ärzte, die dem Vater nicht hatten helfen können, drückte also
in dieser Form den Wunsch nach dem Fortleben des Vaters aus.
Die ganze Zahl entsprach eigentlich der Erfüllung seiner beiden
infantilen Wünsche in betreff seines Familienkreises, die beiden
bösen Geschwister sollten sterben, und ein kleines Geschwisterchen
hinter ihnen nachkommen, oder auf den kürzesten Ausdruck
gebracht: Wenn doch lieber die beiden gestorben wären anstatt
des geliebten Vaters!16) Ein kleines Beispiel aus meiner Korrespondenz. Ein Tele-
graphendirektor in L. schreibt, sein 18½ jähriger Sohn, der
Medizin studieren wolle, beschäftige sich schon jetzt mit der
Psychopathologie des Alltags und suche seine Eltern von der
Richtigkeit meiner Aufstellungen zu überzeugen. Ich gebe einen
der von ihm angestellten Versuche wieder, ohne mich über die
daran geknüpfte Diskussion zu äußern.„Mein Sohn unterhält sich mit meiner Frau über den soge-
nannten Zufall und erläutert ihr, daß sie kein Lied, keine Zahl
nennen könne, die ihr wirklich nur ‚zufällig‘ einfielen. Es ent-
spinnt sich folgende Unterhaltung: Sohn: Nenne mir irgend-
eine Zahl. — Mutter: 79. — Sohn: Was fällt dir dabei ein? —
Mutter: Ich denke an den schönen Hut, den ich gestern besich-
tigte. — Sohn: Was kostete er? — Mutter: 158 M. — Sohn:
Da haben wir es: 158 : 2 = 79. Dir war der Hut zu teuer und
du hast gewiß gedacht: ‚Wenn er halb soviel kostete, würde ich
ihn kaufen.‘Gegen diese Ausführungen meines Sohnes erhob ich zunächst
den Einwand, daß Damen im allgemeinen nicht besonders rech-
neten und daß sich auch Mutter gewiß nicht klar gemacht habe,1) Zur Vereinfachung habe ich einige nicht minder gut passende Zwischeneinfälle
des Patienten weggelassen.S.
278
79 sei die Hälfte von 158. Also setze seine Theorie die immer-
hin unwahrscheinliche Tatsache voraus, daß das Unterbewußtsein
besser rechne als das normale Bewußtsein. ‚Durchaus nicht,‘
erhielt ich zur Antwort; ‚zugegeben, daß Mutter die Rechnung
158 : 2= 79 nicht gemacht hat, sie kann aber recht gut diese
Gleichung gelegentlich gesehen haben; ja sie kann im Traume
sich mit dem Hute beschäftigt und dabei sich klar gemacht
haben, wie teuer er wäre, wenn er nur die Hälfte kostete.‘“7) Eine andere Zahlenanalyse entnehme ich Jones (l. c. p. 478).
Ein Herr seiner Bekanntschaft ließ sich die Zahl 986 einfallen
und forderte ihn dann heraus, sie mit irgend etwas, was er sich
denke, in Zusammenhang zu bringen. „Die nächste Assoziation
der Versuchsperson war die Erinnerung an einen längst vergessenen
Scherz. Am heißesten Tage des Jahres vor sechs Jahren hatte
eine Zeitung die Notiz gebracht, das Thermometer zeige 986°
Fahrenheit, offenbar eine groteske Übertreibung von 98·6, dem
wirklichen Thermometerstand! Wir saßen während dieser Unter-
haltung vor einem starken Feuer im Kamin, von dem er sich
wegrückte, und er bemerkte wahrscheinlich mit Recht, daß die
große Hitze ihn auf diese Erinnerung gebracht habe. Ich gab
mich aber nicht so leicht zufrieden und verlangte zu wissen,
wieso gerade diese Erinnerung bei ihm so fest gehaftet habe. Er
erzählte, er habe über diesen Scherz so fürchterlich gelacht und
sich jedesmal von neuem über ihn amüsiert, so oft er ihm wieder
eingefallen sei. Da ich aber den Scherz nicht besonders gut
finden konnte, wurde meine Erwartung eines geheimen Sinnes
dahinter nur noch verstärkt. Sein nächster Gedanke war, daß die
Vorstellung der Wärme ihm immer soviel bedeutet habe. Wärme
sei das Wichtigste in der Welt, die Quelle alles Lebens usw.
Eine solche Schwärmerei eines sonst recht nüchternen jungen
Mannes mußte nachdenklich stimmen; ich hat ihn, mit seinen
Assoziationen fortzufahren. Sein nächster Einfall ging auf den
Rauchfang einer Fabrik, den er von seinem Schlafzimmer ausS.
279
sehen konnte. Er pflegte oft des Abends auf den Rauch und das
Feuer zu starren, der aus ihm hervorging, und dabei über die
beklagenswerte Vergeudung von Energie nachzudenken. Wärme,
Feuer, die Quelle alles Lebens, die Vergeudung von Energie
aus einer hohen hohlen Röhre — es war nicht schwer, aus
diesen Assoziationen zu erraten, daß die Vorstellung Wärme und
Feuer bei ihm mit der Vorstellung von Liebe verknüpft waren,
wie es im symbolischen Denken gewöhnlich ist, und daß ein
starker Masturbationskomplex seinen Zahleneinfall motiviert habe.
Es blieb ihm nichts übrig, als meine Vermutung zu bestätigen.“Wer sich von der Art, wie das Material der Zahlen im un-
bewußten Denken verarbeitet wird, einen guten Eindruck holen
will, den verweise ich auf C. G. Jungs Aufsatz „Ein Beitrag
zur Kenntnis des Zahlentraumes“ (Zentralbl. für Psychoanalyse,
I, 1912) und auf einen anderen von E. Jones („Unconscious
manipulations of numbers“, ibid. II, 5, 1912).In eigenen Analysen dieser Art ist mir zweierlei besonders
auffällig: Erstens die geradezu somnambule Sicherheit, mit der
ich auf das mir unbekannte Ziel losgehe, mich in einen rech-
nenden Gedankengang versenke, der dann plötzlich bei der
gesuchten Zahl angelangt ist, und die Raschheit, mit der sich
die ganze Nacharbeit vollzieht; zweitens aber der Umstand, daß
die Zahlen meinem unbewußten Denken so bereitwillig zur
Verfügung stehen, während ich ein schlechter Rechner bin und
die größten Schwierigkeiten habe, mir Jahreszahlen, Hausnummern
und dergleichen bewußt zu merken. Ich finde übrigens in diesen
unbewußten Gedankenoperationen mit Zahlen eine Neigung zum
Aberglauben, deren Herkunft mir lange Zeit fremd geblieben ist.11) Herr Rudolf Schneider in München hat eine interessante Einwendung
gegen die Beweiskraft solcher Zahlenanalysen erhoben. (Zu Freuds analytischer
Untersuchung des Zahleneinfalles. lnternat. Zeitschr. für Psychoanalyse, 1920, Heft 1.)
Er griff gegebene Zahlen auf, z. B. eine solche, die ihm in einem aufgeschlagenen
Geschichtswerke zuerst in die Augen fiel, oder er legte einer anderen Person eine
von ihm ausgewählte Zahl vor und sah nun zu, ob sich auch zu dieser aufgedrängten
Zahl anscheinend determinierende Einfälle einstellten. Das war nun wirklich derS.
280
Es wird uns nicht überraschen zu finden, daß nicht nur Zahlen,
sondern auch Worteinfälle anderer Art sich der analytischen
Untersuchung regelmäßig als gut determiniert erweisen.8) Ein hübsches Beispiel von Herleitung eines obsedierenden,
d.h. verfolgenden Wortes findet sich bei Jung (Diagnost. Asso-
ziationsstudien, IV, S. 215). „Eine Dame erzählte mir, daß ihr seit
einigen Tagen beständig das Wort ‚Taganrog‘ im Munde liege,Fall; in dem einen ihn selbst betreffenden Beispiel, das er mitteilt, ergaben die
Einfälle eine ebenso reichliche und sinnvolle Determinierung wie in unseren Ana-
lysen von spontan aufgetauchten Zahlen, während doch die Zahl im Versuche
Schneiders als von außen gegeben einer Determinierung nicht bedürfte. In einem
zweiten Versuch mit einer fremden Person machte er sich die Aufgabe offenbar zu
leicht, denn er gab ihr die Zahl 2 auf, deren Determinierung durch irgendwelches
Material bei jedermann gelingen muß. — R. Schneider schließt nun aus seinen
Erfahrungen zweierlei, erstens „das Psychische besitze zu Zahlen dieselben Assozia-
tionsmöglichkeiten wie zu Begriffen“, zweitens das Auftauchen determinierender
Einfälle zu spontanen Zahleneinfällen beweise nichts für die Herkunft dieser Zahlen
aus den in ihrer „Analyse“ gefundenen Gedanken. Die erstere Folgerung ist nun
unzweifelhaft richtig. Man kann zu einer gegebenen Zahl ebenso leicht etwas
Passendes assoziieren wie zu einem zugerufenen Wort, ja vielleicht noch leichter,
da die Verknüpfbarkeit der wenigen Zahlzeichen eine besonders große ist. Man
befindet sich denn einfach in der Situation des sogenannten Assoziationsexperiments,
das von der Bleuler-Jungschen Schule nach den mannigfaltigsten Richtungen
studiert worden ist. In dieser Situation wird der Einfall (Reaktion) durch das
gegebene Wort (Reizwort) determiniert. Diese Reaktion könnte aber noch von sehr
verschiedener Art sein und die Jungschen Versuche haben gezeigt, daß auch die
weitere Unterscheidung nicht dem „Zufall“ überlassen ist, sondern daß unbewußte
„Komplexe“ sich an der Determinierung beteiligen, wenn sie durch des Reizwort
angerührt worden sind. — Die zweite Folgerung Schneiders geht zu weit. Aus
der Tatsache, daß zu gegebenen Zahlen (oder Worten) passende Einfälle auftauchen,
ergibt sich nichts für die Ableitung spontan auftauchender Zahlen (oder Worte),
was nicht schon vor Kenntnis dieser Tatsache in Betracht zu ziehen war. Diese
Einfälle (Worte oder Zahlen) könnten undeterminiert sein oder durch die Gedanken
determiniert, die sich in der Analyse ergeben, oder durch andere Gedanken, die sich
in der Analyse nicht verraten haben, in welchem Falle uns die Analyse irregeführt
hätte. Man muß sich nur von dem Eindruck frei machen, daß dies Problem für
Zahlen anders liege als für Worteinfälle. Eine kritische Untersuchung des Problems
und somit eine Rechtfertigung der psychoanalytischen Einfallstechnik liegt nicht in
der Absicht dieses Buches. In der analytischen Praxis geht man von der Voraus-
setzung aus, daß die zweite der erwähnten Möglichkeiten zutreffend und in der
Mehrzahl der Fälle verwertbar ist. Die Untersuchungen eines Experimentalpsycho-
logen haben gelehrt, daß sie die bei weitem wahrscheinlichste ist (Poppelreuter).
(Vgl. übrigens hiezu die beachtenswerten Ausführungen Bleulers in seinem Buch:
Du autistisch-undisziplinierte Denken usw., 1919, Abschnitt 9: Von den Wahrschein-
lichkeiten der psychologischen Erkenntnis.)S.
281
ohne daß sie eine Idee habe, woher das komme. Ich fragte die
Dame nach den affektbetonten Ereignissen und verdrängten
Wünschen der Jüngstvergangenheit. Nach einigem Zögern erzählte
sie mir, daß sie sehr gern einen ‚Morgenrock‘ hätte, ihr
Mann aber nicht das gewünschte Interesse dafür habe. ‚Morgen-
rock: Tag-an-rock‘, man sieht die partielle Sinn- und Klangver-
wandtschaft. Die Determination der russischen Form kommt daher,
daß ungefähr zu gleicher Zeit die Dame eine Persönlichkeit aus
Taganrog kennen gelernt hatte.“9) Dr. E. Hitschmann verdanke ich die Auflösung eines
anderen Falles, in dem sich ein Vers wiederholt in einer bestimmten
Örtlichkeit als Einfall aufdrängte, ohne daß dessen Herkunft und
Beziehungen ersichtlich gewesen wären.„Erzählung des Dr. jur. E.: Ich fuhr vor sechs Jahren von
Biarritz nach San Sebastian. Die Eisenbahnstrecke führt über den
Bidassoafluß, der hier die Grenze zwischen Frankreich und Spanien
bildet. Auf der Brücke hat man einen schönen Blick, auf der
einen Seite über ein weites Tal und die Pyrenäen, auf der anderen
Seite weithin über das Meer. Es war ein schöner, heller Sommer-
tag, alles war erfüllt von Sonne und Licht, ich war auf einer
Ferienreise, freute mich nach Spanien zu kommen — da fielen mir
die Verse ein: ‚Aber frei ist schon die Seele, schwebet in dem Meer
von Licht.‘Ich erinnere mich, daß ich damals darüber nachdachte, woher
diese Verse seien, und mich dessen nicht entsinnen konnte; nach
dem Rhythmus mußten die Worte aus einem Gedicht stammen,
welches aber meiner Erinnerung vollständig entfallen war. Ich
glaube später, da mir die Verse wiederholt in den Sinn kamen,
noch mehrere Leute danach gefragt zu haben, ohne etwas
erfahren zu können.Im Vorjahre fuhr ich, von einer spanischen Reise zurückkehrend,
auf derselben Bahnstrecke. Es war stockfinstere Nacht und es
regnete. Ich sah zum Fenster hinaus, um zu sehen, ob wir schonS.
282
in der Grenzstation ankämen, und bemerkte, daß wir auf der
Bidassoabrücke waren. Sofort kamen mir die oben angeführten
Verse wieder ins Gedächtnis, und wieder konnte ich mich ihrer
Herkunft nicht erinnern.Mehrere Monate nachher kamen mir zu Hause die Uhland-
schen Gedichte in die Hand. Ich öffnete den Band und mein
Blick fiel auf die Verse: ‚Aber frei ist schon die Seele, schwebet
in dem Meer von Licht‘, die den Schluß eines Gedichtes: ‚Der
Waller‘ bilden. Ich las das Gedicht und erinnerte mich nun ganz
dunkel, es einmal vor vielen Jahren gekannt zu haben. Der Schau-
platz der Handlung ist in Spanien, und dies schien mir die einzige
Beziehung der zitierten Verse zu der von mir beschriebenen Stelle
der Eisenbahnstrecke zu bilden. Ich war von meiner Entdeckung
nur halb befriedigt und blätterte mechanisch in dem Buche weiter.
Die Verse, ‚Aber frei ist schon usw.‘ standen als die letzten auf
einer Seite. Beim Umblättern fand ich auf der nächsten Seite ein
Gedicht mit der Überschrift ‚Die Bidassoabrücke‘.Ich bemerke noch, daß mir der Inhalt dieses letzten Gedichtes
fast noch fremder schien, als der des ersten, und daß seine ersten
Verse lauten: ‚Auf der Bidassoabrücke steht ein Heiliger altersgrau,
segnet rechts die span’schen Berge, segnet links den fränk’schen
Gau.‘“B) Diese Einsicht in die Determinierung scheinbar willkürlich
gewählter Namen und Zahlen kann vielleicht zur Klärung eines
anderen Problems beitragen. Gegen die Annahme eines durch-
gehenden psychischen Determinismus berufen sich bekanntlich
viele Personen auf ein besonderes Überzeugungsgefühl für die
Existenz eines freien Willens. Dieses Überzeugungsgefühl besteht
und weicht auch dem Glauben an den Determinismus nicht. Es
muß wie alle normalen Gefühle durch irgend etwas berechtigt
sein. Es äußert sich aber, soviel ich beobachten kann, nicht bei
den großen und wichtigen Willensentscheidungen; bei diesenS.
283
Gelegenheiten hat man vielmehr die Empfindung des psychischen
Zwanges und beruft sich gern auf sie („Hier stehe ich, ich kann
nicht anders“). Hingegen möchte man gerade bei den belanglosen,
indifferenten Entschließungen versichern, daß man ebensowohl
anders hätte handeln können, daß man aus freiem, nicht
motiviertem Willen gehandelt hat. Nach unseren Analysen braucht
man nun das Recht des Überzeugungsgefühls vom freien Willen
nicht zu bestreiten. Führt man die Unterscheidung der Motivierung
aus dem Bewußten von der Motivierung aus dem Unbewußten
ein, so berichtet uns das Überzeugungsgefühl, daß die bewußte
Motivierung sich nicht auf alle unsere motorischen Entscheidungen
erstreckt. Minima non curat praetor. Was aber so von der einen
Seite freigelassen wird, das empfängt seine Motivierung von
anderer Seite, aus dem Unbewußten, und so ist die Determinierung
im Psychischen doch lückenlos durchgeführt.1C) Wenngleich dem bewußten Denken die Kenntnis von der
Motivierung der besprochenen Fehlleistungen nach der ganzen
Sachlage abgehen muß, so wäre es doch erwünscht, einen psycho-
logischen Beweis für deren Existenz aufzufinden; ja es ist aus
Gründen, die sich bei näherer Kenntnis des Unbewußten ergeben,
wahrscheinlich, daß solche Beweise irgendwo auffindhar sind. Es
lassen sich wirklich auf zwei Gebieten Phänomene nachweisen,
welche einer unbewußten und darum verschobenen Kenntnis von
dieser Motivierung zu entsprechen scheinen:1) Diese Anschauungen über die strenge Determinierung anscheinend willkürlicher
psychischer Aktionen haben bereits reiche Früchte für die Psychologie — vielleicht
auch für die Rechtspflege — getragen. Bleuler und Jung haben in diesem Sinne
die Reaktionen beim sogenannten Assoziationsexperiment verständlich gemacht, bei
dem die untersuchte Person auf ein ihr zugerufenes Wort mit einem ihr dazu ein-
fallenden antwortet (Reizwort-Reaktion), und die dabei verlaufene Zeit gemessen wird
(Reaktionszeit). Jung hat in seinen „Diagnostischen Assoziationsstudien“ (1906) gezeigt,
welch feines Reagens für psychische Zustände wir in dem so gedeuteten Assoziations-
experiment besitzen. Zwei Schüler des Strafrechtslehrers H. Groß in Prag, Wertheimer
und Klein, haben aus diesen Experimenten eine Technik zur „Tatbestands-Diagnostik“
in strafrechtlichen Fällen entwickelt, deren Prüfung Psychologen und Juristen
beschäftigt.S.
284
a) Es ist ein auffälliger und allgemein bemerkter Zug im
Verhalten der Paranoiker, daß sie den kleinen, sonst von uns
vernachlässigten Details im Benehmen der anderen die größte
Bedeutung beilegen, dieselben ausdeuten und zur Grundlage
weitgehender Schlüsse machen. Der letzte Paranoiker z. B., den
ich gesehen habe, schloß auf ein allgemeines Einverständnis in
seiner Umgebung, weil die Leute bei seiner Abreise auf dem
Bahnhof eine gewisse Bewegung mit der einen Hand gemacht
hatten. Ein anderer hat die Art notiert, wie die Leute auf der
Straße gehen, mit den Spazierstöcken fuchteln u. dgl.1Die Kategorie des Zufälligen, der Motivierung nicht Bedürftigen,
welche der Normale für einen Teil seiner eigenen psychischen
Leistungen und Fehlleistungen gelten läßt, verwirft der Paranoiker
also in der Anwendung auf die psychischen Äußerungen der
anderen. Alles, was er an den anderen bemerkt, ist bedeutungs-
voll, alles ist deutbar. Wie kommt er nur dazu? Er projiziert
wahrscheinlich in das Seelenleben der anderen, was im eigenen
unbewußt vorhanden ist, hier wie in so vielen ähnlichen Fällen.
In der Paranoia drängt sich ebenso vielerlei zum Bewußtsein
durch, was wir bei Normalen und Neurotikern erst durch die
Psychoanalyse als im Unbewußten vorhanden nachweisen.2 Der
Paranoiker hat also hierin in gewissem Sinne recht, er erkennt
etwas, was dem Normalen entgeht, er sieht schärfer als das normale
Denkvermögen, aber die Verschiebung des so erkannten Sachver-
halts auf andere macht seine Erkenntnis wertlos. Die Recht-
fertigung der einzelnen paranoischen Deutungen wird man dann
hoffentlich von mir nicht erwarten. Das Stück Berechtigung aber,
welches wir der Paranoia bei dieser Auffassung der Zufallshand-1) Von anderen Gesichtspunkten ausgehend, hat man diese Beurteilung unwesent-
licher und zufälliger Äußerungen bei anderen zum „Beziehungswahn“ gerechnet.2) Die durch Analyse bewußt zu machenden Phantasien der Hysteriker von
sexuellen und grausamen Mißhandlungen decken sich z. B. gelegentlich bis ins Einzelne
mit den Klagen verfolgter Paranoiker. Es ist bemerkenswert, aber nicht unverständlich,
wenn der identische Inhalt uns auch als Realität in den Veranstaltungen Perverser
zur Befriedigung ihrer Gelüste entgegentritt.S.
285
lungen zugestehen, wird uns das psychologische Verständnis
der Überzeugung erleichtern, welche sich beim Paranoiker
an alle diese Deutungen geknüpft hat. Es ist eben etwas
Wahres daran; auch unsere nicht als krankhaft zu bezeich-
nenden Urteilsirrtümer erwerben das ihnen zugehörige Über-
zeugungsgefühl auf keine andere Art. Dies Gefühl ist für ein
gewisses Stück des irrtümlichen Gedankenganges oder für die
Quelle, aus der er stammt, berechtigt und wird dann von uns
auf den übrigen Zusammenhang ausgedehnt.b) Ein anderer Hinweis auf die unbewußte und verschobene
Kenntnis der Motivierung bei Zufalls- und Fehlleistungen findet
sich in den Phänomen des Aberglaubens. Ich will meine Meinung
durch die Diskussion des kleinen Erlebnisses klarlegen, welches für
mich der Ausgangspunkt dieser Überlegungen war.Von den Ferien zurückgekehrt, richten sich meine Gedanken
alsbald auf die Kranken, die mich in dem neu beginnenden
Arbeitsjahre beschäftigen sollen. Mein erster Weg gilt einer sehr
alten Dame, bei der ich (s. oben S. 182) seit Jahren die nämlichen
ärztlichen Manipulationen zweimal täglich vornehme. Wegen
dieser Gleichförmigkeit haben sich unbewußte Gedanken sehr
häufig auf dem Wege zu der Kranken und während der
Beschäftigung mit ihr Ausdruck verschafft. Sie ist über neunzig
Jahre alt; es liegt also nahe, sich bei Beginn eines jeden Jahres
zu fragen, wie lange sie wohl noch zu leben hat. An dem Tage,
von dem ich erzähle, habe ich Eile, nehme also einen Wagen, der
mich vor ihr Haus führen soll. Jeder der Kutscher auf dem
Wagenstandplatz vor meinem Hause kennt die Adresse der alten
Frau, denn jeder hat mich schon oftmals dahin geführt. Heute
ereignete es sich nun, daß der Kutscher nicht vor ihrem Hause,
sondern vor dem gleichbezifferten in einer nahegelegenen und
wirklich ähnlich aussehenden Parallelstraße Halt macht. Ich merke
den Irrtum und werfe ihn dem Kutscher vor, der sich entschuldigt.
Hat das nun etwas zu bedeuten, daß ich vor ein Haus geführtS.
286
werde, in dem ich die alte Dame nicht vorfinde? Für mich
gewiß nicht, aber wenn ich abergläubisch wäre, würde ich
in dieser Begebenheit ein Vorzeichen erblicken, einen Fingerzeig
des Schicksals, daß dieses Jahr das letzte für die alte Frau sein
wird. Recht viele Vorzeichen, welche die Geschichte aufbewahrt
hat, sind in keiner besseren Symbolik begründet gewesen. Ich
erkläre allerdings den Vorfall für eine Zufälligkeit ohne weiteren
Sinn.Ganz anders läge der Fall, wenn ich den Weg zu Fuß gemacht
und dann in „Gedanken“, in der „Zerstreutheit“ vor das Haus
der Parallelstraße anstatt vors richtige gekommen wäre. Das
würde ich für keinen Zufall erklären, sondern für eine der
Deutung bedürftige Handlung mit unbewußter Absicht. Diesem
„Vergehen“ müßte ich wahrscheinlich die Deutung geben, daß
ich die alte Dame bald nicht mehr anzutreffen erwarte.Ich unterscheide mich also von einem Abergläubischen in
folgendem:Ich glaube nicht, daß ein Ereignis, an dessen Zustandekommen
mein Seelenleben unbeteiligt ist, mir etwas Verborgenes über die
zukünftige Gestaltung der Realität lehren kann; ich glaube aber,
daß eine unbeabsichtigte Äußerung meiner eigenen Seelentätigkeit
mir allerdings etwas Verborgenes enthüllt, was wiederum nur
meinem Seelenleben angehört; ich glaube zwar an äußeren
(realen) Zufall, aber nicht an innere (psychische) Zufälligkeit. Der
Abergläubische umgekehrt: er weiß nichts von der Motivierung
seiner zufälligen Handlungen und Fehlleistungen, er glaubt, daß
es psychische Zufälligkeiten gibt; dafür ist er geneigt, dem äußeren
Zufall eine Bedeutung zuzuschreiben, die sich im realen Geschehen
äußern wird, im Zufall ein Ausdrucksmittel für etwas draußen
ihm Verborgenes zu sehen. Die Unterschiede zwischen mir und
dem Abergläubischen sind zwei: erstens projiziert er eine Moti-
vierung nach außen, die ich innen suche; zweitens deutet er den
Zufall durch ein Geschehen, den ich auf einen Gedanken zurück-S.
287
führe. Aber das Verborgene bei ihm entspricht dem Unbewußten
bei mir, und der Zwang, den Zufall nicht als Zufall gelten zu
lassen, sondern ihn zu deuten, ist uns beiden gemeinsam.1Ich nehme nun an, daß diese bewußte Unkenntnis und
unbewußte Kenntnis von der Motivierung der psychischen Zufällig-
keiten eine der psychischen Wurzeln des Aberglaubens ist. Weil
der Abergläubische von der Motivierung der eigenen zufälligen
Handlungen nichts weiß, und weil die Tatsache dieser Moti-
vierung nach einem Platze in seiner Anerkennung drängt, ist er
genötigt, sie durch Verschiebung in der Außenwelt unterzubringen.
Besteht ein solcher Zusammenhang, so wird er kaum auf diesen
einzelnen Fall beschränkt sein. Ich glaube in der Tat, daß ein
großes Stück der mythologischen Weltauffassung, die weit bis in
die modernsten Religionen hinein reicht, nichts anderes ist als
in die Außenwelt projizierte Psychologie. Die dunkle
Erkenntnis (sozusagen endopsychische Wahrnehmung) psychischer
Faktoren und Verhältnisse2 des Unbewußten spiegelt sich — es
ist schwer, es anders zu sagen, die Analogie mit der Paranoia1) Ich knüpfe hier ein schönes Beispiel an, an dem N. Ossipow die
Verschiedenheit von abergläubischer, psychoanalytischer und mystischer Auffassung
erörtert (Psychoanalyse und Aberglauben, Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse,
VIII, 1922). Er hatte in einer kleinen russischen Provinzstadt geheiratet und fuhr
unmittelbar nachher mit seiner jungen Frau nach Moskau. Auf einer Station, zwei
Stunden vor dem Ziel, kam ihm der Wunsch, zum Ausgang des Bahnhofes zu gehen
und einen Blick auf die Stadt zu werfen. Der Zug sollte nach seiner Erwartung
genügend lange verweilen, aber als er nach wenigen Minuten zurückkam, war der
Zug mit seiner jungen Frau bereits abgefahren. Als seine alte Njanja zu Hause von
diesem Zufall erfuhr, äußerte sie kopfschüttelnd: „Aus dieser Ehe wird nichts
Ordentliches.“ Ossipow lachte damals über diese Prophezeiung. Da er aber fünf
Monate später von seiner Frau geschieden war, kann er nicht umhin, sein Verlassen
des Zuges nachträglich als einen „unbewußten Protest“ gegen seine Eheschließung
zu verstehen. Die Stadt, in welcher sich ihm diese Fehlleistung ereignete, gewann
Jahre nachher eine große Bedeutung für ihn, denn in ihr lebte eine Person, mit
welcher ihn später das Schicksal eng verknüpfte. Diese Person, ja die Tatsache
ihrer Existenz war ihm damals völlig unbekannt. Aber die mystische Erklärung
seinen Verhaltens würde lauten, er habe in jener Stadt den Zug nach Moskau und
seine Frau verlassen, weil sich die Zukunft andeuten wollte. die ihm in der
Beziehung zu dieser Person vorbereitet war.2) Die natürlich nichts vom Charakter einer Erkenntnis hat.
S.
288
muß hier zu Hilfe genommen werden — in der Konstruktion
einer übersinnlichen Realität, welche von der Wissen-
schaft in Psychologie des Unbewußten zurückverwandelt
werden soll. Man könnte sich getrauen, die Mythen vom Paradies
und Sündenfall, von Gott, vom Guten und Bösen, von der
Unsterblichkeit u. dgl. in solcher Weise aufzulösen, die Meta-
physik in Metapsychologie umzusetzen. Die Kluft zwischen
der Verschiebung des Paranoikers und der des Abergläubischen
ist minder groß, als sie auf den ersten Blick erscheint. Als die
Menschen zu denken begannen, waren sie bekanntlich genötigt,
die Außenwelt anthropomorphisch in eine Vielheit von Persönlich-
keiten nach ihrem Gleichnis aufzulösen; die Zufälligkeiten, die
sie abergläubisch deuteten, waren also Handlungen, Äußerungen
von Personen, und sie haben sich demnach genau so benommen
wie die Paranoiker, welche aus den unscheinbaren Anzeichen, die
ihnen die anderen geben, Schlüsse ziehen, und wie die Gesunden
alle, welche mit Recht die zufälligen und unbeabsichtigten Hand-
lungen ihrer Nebenmenschen zur Grundlage der Schätzung ihres
Charakters machen. Der Aberglaube erscheint nur so sehr
deplaciert in unserer modernen, naturwissenschaftlichen, aber noch
keineswegs abgerundeten Weltanschauung; in der Weltanschauung
vorwissenschaftlicher Zeiten und Völker war er berechtigt und
konsequent.Der Römer, der eine wichtige Unternehmung aufgab, wenn
ihm ein widriger Vogelflug begegnete, war also relativ im Recht;
er handelte konsequent nach seinen Voraussetzungen. Wenn er
aber von der Unternehmung abstand, weil er an der Schwelle
seiner Tür gestolpert war („un Romain retournerait“), so war er
uns Ungläubigen auch absolut überlegen, ein besserer Seelen-
kundiger, als wir uns zu sein bemühen. Denn dieses Stolpern
mußte ihm die Existenz eines Zweifels, einer Gegenströmung in
seinem Innern beweisen, deren Kraft sich im Moment der
Ausführung von der Kraft seiner Intention abziehen konnte. DesS.
289
vollen Erfolges ist man nämlich nur dann sicher, wenn alle
Seelenkräfte einig dem gewünschten Ziel entgegenstreben. Wie
antwortet Schillers Tell, der so lange gezaudert, den Apfel
vom Haupte seines Knaben zu schießen, auf die Frage des Vogts,
wozu er den zweiten Pfeil eingesteckt?Mit diesem Pfeil durchbohrt’ ich — Euch,
Wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte,
Und Euer — wahrlich — hätt’ ich nicht gefehlt.D) Wer die Gelegenheit gehabt hat, die verborgenen Seelen-
regungen der Menschen mit dem Mittel der Psychoanalyse zu
studieren, der kann auch über die Qualität der unbewußten
Motive, die sich im Aberglauben ausdrücken, einiges Neue sagen.
Am deutlichsten erkennt man bei den oft sehr intelligenten, mit
Zwangsdenken und Zwangszuständen behafteten Nervösen, daß
der Aberglaube aus unterdrückten feindseligen und grausamen
Regungen hervorgeht. Aberglaube ist zum großen Teile Unheils-
erwartung, und wer anderen häufig Böses gewünscht, aber infolge
der Erziehung zur Güte solche Wünsche ins Unbewußte verdrängt
hat, dem wird es besonders nahe liegen, die Strafe für solches
unbewußte Böse als ein ihm drohendes Unheil von außen zu
erwarten.Wenn wir zugeben, daß wir die Psychologie des Aberglaubens
mit diesen Bemerkungen keineswegs erschöpft haben, so werden
wir auf der anderen Seite die Frage wenigstens streifen müssen,
ob denn reale Wurzeln des Aberglaubens durchaus zu bestreiten
seien, ob es gewiß keine Ahnungen, prophetische Träume, tele-
pathische Erfahrungen, Äußerungen übersinnlicher Kräfte und
dergleichen gebe. Ich bin nun weit davon entfernt, diese Phäno-
mene überall so kurzerhand aburteilen zu wollen, über welche
so viele eingehende Beobachtungen selbst intellektuell hervor-
ragender Männer vorliegen, und die am besten die Objekte
weiterer Untersuchungen bilden sollen. Es ist dann sogar zuS.
290
hoffen, daß ein Teil dieser Beobachtungen durch unsere beginnende
Erkenntnis der unbewußten seelischen Vorgänge zur Aufklärung
gelangen wird, ohne uns zu grundstürzenden Abänderungen
unserer heutigen Anschauungen zu nötigen.1 Wenn noch andere,
wie z. B. die von den Spiritisten behaupteten Phänomene,
erweisbar werden sollten, so werden wir eben die von der neuen
Erfahrung geforderten Modifikationen unserer „Gesetze“ vornehmen,
ohne an dem Zusammenhang der Dinge in der Welt irre zu
werden.Im Rahmen dieser Auseinandersetzungen kann ich die nun
aufgeworfenen Fragen nicht anders als subjektiv, d. i. nach meiner
persönlichen Erfahrung, beantworten. Ich muß leider bekennen,
daß ich zu jenen unwürdigen Individuen gehöre, vor denen die
Geister ihre Tätigkeit einstellen und das Übersinnliche entweicht,
so daß ich niemals in die Lage gekommen bin, selbst etwas zum
Wunderglauben Anregendes zu erleben. Ich habe wie alle Menschen
Ahnungen gehabt und Unheil erfahren, aber die beiden wichen
einander aus, so daß auf die Ahnungen nichts folgte und das
Unheil unangekündigt über mich kam. Zur Zeit, als ich, ein
junger Mann, allein in einer fremden Stadt lebte, habe ich oft
genug meinen Namen plötzlich von einer unverkennbaren, teuren
Stimme rufen hören und mir dann den Zeitmoment der Halluzi-
nation notiert, um mich besorgt bei den Daheimgebliebenen zu
erkundigen, was um jene Zeit vorgefallen. Es war nichts. Zum
Ersatz dafür habe ich später ungerührt und ahnungslos mit
meinen Kranken gearbeitet, während mein Kind einer Verblutung
zu erliegen drohte. Es hat auch keine der Ahnungen, von denen
mir Patienten berichtet haben, meine Anerkennung als reales
Phänomen erwerben können. Doch muß ich gestehen, daß ich
in den letzten Jahren einige merkwürdige Erfahrungen gemacht1) E. Hitschmann, Zur Kritik des Hellsehens, Wiener Klinische Rundschau, 1910,
Nr. 6, und Ein Dichter und sein Vater, Beitrag zur Psychologie religiöser Bekehrung
und telepathischer Phänomene, Imago, IV, 1915/16.S.
XII. Detzrminismw, Zufalls— und Aberglaubm, a„am„„„m 991
habe, die durch die Annahme telepathiseher Gedankenübertragung
leichte Aufklärung gefunden hätten.Der Glaube an prophetische Träume fihlt viele Anhänger,
weil er sich darauf stützen kann, daß manches sich wirklich in
der Zukunft so gestaltet, wie es der Wunsch im Traume vorher
knnstruiert hat.’ Allein daran ist wenig zu verwundern, und
zwischen dem Traum und der Erfüllung lassen sich in der Regel
noch weitgehende Abweichungen nachweisen, welche die Gläubig-
keit der Träumer zu vernachlässigen liebt. Ein schönes Beispiel
eines mit Recht propheü'sch zu nennenden Traumes bot mir
einmal eine intelligente und wahrheitsliebende Patientin zur
genauen Analyse. Sie erzählte, daß sie einmal geträumt, sie treffe
ihren früheren Freund und Hausarzt vor einem bestimmten
Laden einer gewissen Straße, und als sie am nächsten Morgen
in die innere Stadt ging, traf sie ihn wirklich an der imTraume
genannten Stelle. Ich bemerke, daß dieses Wunderbare Zusammenv
treffen seine Bedeutung durch kein nachfolgendes Erlebnis erwies,
also nicht aus dem Zukünftigen zu rechtfertigen war.Das sorgfältige Examen stellte fest, daß kein Beweis dafür
vorliege, die Dame habe den Traum bereits am Morgen nach
der Traumnacht‚ also vor. dem Spaziergang und der Begegnung,
erinnert. Sie konnte nichts gegen eine Darstellung des Sach-
verhaltes einwenden, die der Begehenheit alles Wunderbare nimmt
und nur ein interessantes psychologisches Problem übrig läßt. Sie
ist eines Vormittags durch die gewisse Straße gegangen, hat vor
dem einen Laden ihren alten Hausarzt begegnet und nun bei
seinem Anblick die Überzeugung bekommen, daß sie die letzte
Nacht von diesem Zusammentreifen an der nämlichen Stelle
geträumt habe. Die Analyse konnte dann mit großer Wahrschein—
lichkeit andeuten, wie sie zu dieser Überzeugung gekommen war,
welcher man ja nach allgemeinen Regeln ein gewisses Anrecht;) Vg1‚ r„„a‚ Traum und Telepathie (Image, vm. 19„. Enthalten in Bd, in
dieser Gesamtausgabe).19'
S.
292 Zur P:ychopatholagie de: Alltagst
auf Glaubwürdigkeit nicht versagen darf. Ein Zusammentreffen
am bestimmten Orte nach vorheriger Erwartung, das ist ja der
Tatbestand eines Rendezvous. Der alte Hausarzt rief die Erinnerung
an alte Zeiten in ihr wach, in denen Zusammenkünfte mit einer
dritten, auch dem Arzt befreundeten Person für sie bedeutungs»
voll gewesen waren. Mit diesem Herrn war sie seitdem in Verkehr
geblieben und hat am Tage vor dem angeblichen Traum vergeb—
lich auf ihn gewartet. Könnte ich die hier vorliegenden Bezie-
hungen ausführlicher mitteilen, so wäre es mir leicht zu zeigen,
daß die Illusion des prophet'ischen Traumes beim Anblick des
Freundes aus früherer Zeit äquivalent ist etwa folgender Rede:
„Ach, Herr Doktor, Sie erinnern mich jetzt an vergangene Zeiten,
in denen ich niemals vergeblich auf N. zu warten brauchte, wenn
wir eine Zusammenkunft bestellt hatten.“Von jenem bekannten „merkwürdigen Zusammentreffen“, daß
man einer Person begegnet, mit welcher man sich gerade in
Gedanken beschäftigt hat, habe ich bei mir selbst ein einfaches
und leicht zu deutendes Beispiel beobachtet, welches wahrschein-
lich ein gutes Vorbild für ähnliche Vorfälle ist. Wenige Tage,
nachdem mir der Titel eines Professors verliehen werden war,
der in monarchisch eingerichteten Staaten selbst viel Autorität
verleiht, lenkten während eines Spazierganges durch die innere
Stadt meine Gedanken plötzlich in eine kindjsche Rachephantasie
ein, die sich gegen ein gewisses Elternpaar richtete. Diese hatten
mich einige Monate vorher zu ihrem Töchterchen gerufen, bei
dem sich eine interessante Zwangseischeinung im Anschluß an
einen Traum eingestellt hatte. Ich brachte dem Falle, dessen
Genese ich zu durchschauen glaubte, ein großes Interesse entgegen;
meine Behandlung wurde aber von den Eltern abgelehnt und mir
zu verstehen gegeben, daß man sich an eine ausländische Autorität,
die mittels Hypnotismus heile, zu wenden gedenke. Ich phanta-
sierte nun, daß die Eltern nach dem völligen Mißglücken dieses
Versuches mich bäten, mit meiner Behandlung einzusetzen, sieS.
XII. Detzrminirmus‚ z.;f„u;- und Ab„glm„5m‚ Gesichtspunkt: 995
hätten jetzt volles Vertrauen zu mir usw. Ich aber antwortete:
Ja, jetzt, nachdem ich auch Professor geworden bin' haben Sie
Vertrauen. Der Titel hat an meinen Fähigkeiten weiter nichts
geändert; wenn Sie mich als Dozenten nicht brauchen konnten,
können Sie mich auch als Professor entbehren. — An dieser
Stelle wurde meine Phantasie durch den lauten Gruß „Habe
die Ehre, Herr Professor“ unterbrochen, und als ich aufschante,
ging das nämliche Elternpaar an mir vorüber, an dem ich soeben
durch die Abweisung ihres Anerbietens Rache genommen hatte.
Die nächste Überlegung zerstörte den Anschein des Wunderbaren.
Ich ging auf einer geraden und breiten, fast menschenleeren
Straße jenem Paar entgegen, hatte bei einem flüchtigen Auf—
schauen, vielleicht zwanzig Schritte von ihnen entferne ihre
stattlichen Persönlichkeiten erblickt und erkannt, diese VVahr—
nehmung aber — nach dem Muster einer negativen Halluzination
— aus jenen Gefühlsinotiven beseitigt, die sich dann in der
anscheinend spontan auftauchenden Phantasie zur Geltung
brachten.Eine andere „Auflösung einer scheinbaren Vorahnung“ berichte
ich nach Otto Rank: .„Vor einiger Zeit erlebte ich selbst eine seltsame Variation
jenes ‚merkwürdigen Zusammentreffens‘, wobei man einer Person
begegnet, mit: welcher man sich gerade in Gedanken besch" ‘gt
hat. Ich gehe unmittelbar vor Weihnachten in die Österreichische
Ungarische Bank, um mit zehn neue Silberkronen zu Geschenk-
zwecken einzuwechseln. In ehrgeizige Phantasien versunken,
die an den Gegensatz meiner geringen Barschaft zu den im
Bankgebäude aufgestapelten Geldmassen anknüpfen, biege ich
in die schmale Bankgasse ein, wo die Bank gelegen ist. Vor
dem Tor sehe ich ein Automobil stehen und viele Leute aus
und ein gehen. Ich denke mir, die Beamten werden gerade
für meine paar Kronen Zeit haben; ich werde es jedenfalls
rasch abmachen, die zu wechselnde Geldnote hinlegen undS.
994 Zur Psychopatlwhgiz des Alltagslesz
sagen: Bitte, geben Sie mir Gold! — Sogleich bemerke ich
meinen Irrtum — ich sollte ja Silber verlangen —— und
erwache aus meinen Phantasien. Ich befinde mich nur noch
wenige Schritte vom Eingang entfernt und sehe einen jungen
Mann mir entgegenkommen, der mir bekannt vorkommt, den ich
jedoch wegen meiner Kurzsichtigkeit noch nicht mit Sicherheit
zu erkennen vermag. Wie er näher kommt, erkenne ich in ihm
einen Schulltollegen meines Bruders, namens Gold, von dessen
Bruder, einem bekannten Schriftsteller, ich zu Beginn meiner
literarischen Laufbahn weitgehende Förderung erwartet hatte.
Sie blieb jedoch aus und mit ihr auch der erhoffte materielle
Erfolg, mit dem sich meine Phantasie auf dem Wege zur Bank
beschäftigt hatte. Ich muß also, in meine Phantasien versunken,
das Herannahen des Herrn Gold unbewußt appenipiert haben,
was sich meinem von materiellen Erfolgen träumenden Bewußt-
sein in der Fonn dar-stellte, daß ich beschloß, am Kassenschalter
Gold —— statt des minderwertigen Silbers —— zu verlangen. Ander—
seits scheint aber auch die paradoxe Tatsache, daß mein -Unbe—
wußtes ein Objekt wahrzunehmen imstande ist, welches meinem
Auge erst später erkennbar wird, zum Teil aus der Komplex»
bereitschafi (Bleuler) erklärlioh, die ja aufs Materielle eingestellt
war und meine Schritte gegen mein besseres Wissen von Anfang an
nach jenem Gebäude gelenkt hatte, wo nur die Gold- und Papier—
geldverwechslung stattfindet“ (Zentralblatt für Psychoanalyse, II, 5).In die Kategorie des Wunderbaren und Unheimlichen gehört
auch jene eigentümliche Empfindung, die man in manchen
Momenten und Situationen verspürt‚ als ob man genau das
nämliche schon einmal erlebt hätte, sich in derselben Lage schon
einmal befunden hätte, ohne daß es je dem Bemühen gelingt,
das Frühere, das sich so anzeigt, deutlich zu erinnern. Ich weiß,
daß ich bloß dem lockeren Sprachgebrauch folge, wenn ich das7
was sich in solchen Momenten in einem regt, eine Empfindung
heiße; es handelt sich wohl um ein Urteil, und zwar einS.
XII. thzrminismus‚ Zufulls- und Aberglauben‚ Gesichtspunkte 295
Erkennungsuxteil, aber diese Fälle haben doch einen ganz eigen-
tümlichen Charakter, und daß man sich niemals an das Gesuchte
erinnert, darf nicht beiseite gelassen werden. Ich weiß nicht7 ob
dies Phänomen des „de'jä vu“ im Ernst zum Erweis einer
früheren psychischen Existenz des Einzelvvesens herangezogen
werden ist; wohl aber haben die Psychologen ihm ihr Interesse
zugewendet und die Lösung des Rätsels auf den mannigfaltigsten
spekulativen Wegen angestrebt. Keiner der beigebrachten Erklärungs-
versuche scheint mir richtig zu sein, weil in keinem etwas anderes
als die Begleiterscheinungen und begünstigenden Bedingungen des
Phänomens in Betracht gezogen wird. Jene psychischen Vorgänge,
welche nach meinen Beobachtungen allein für die Erklärung
des „de'jä vu“ verantwortlich sind, die unbewußten Phantasien
nämlich, werden ja heute noch von den Psychologen allgemein
vernachlässigt.Ich meine, man tut unrecht, die Empfindung des schon einmal
Erlebtliabens als eine Illusion zu bezeichnen. Es wird vielmehr
in solchen Momenten wirklich an etwas gerührt, was man bereits
einmal erlebt hat, nur kann dies letztere nicht bewußt erinnert
werden, weil es niemals bewußt war. Die Empfindung des „déjä
vu“ entspricht, kurz gesagt, der Erinnerung an eine unbewußte
Phantasie. Es gibt unbewußte Phantasien (oder Tagträume), wie
es bewußte solche Schöpfungen gibt, die ein jeder aus seiner
eigenen Erfahrung kennt.Ich weiß, daß der Gegenstand der eingehendsten Behandlung
würdig wäre, will aber hier nur die Analyse eines einzigen
Falles von „de'jä vu“ anführen‚ in dem sich die Empfindung
durch besondere Intensität und Ausdauer auszeichnete. Eine jetzt
57jäh.rige Dame behauptet, daß sie sich aufs schärfste erinnere,
im Alter von zwölfeinhalb Jahren habe sie einen ersten Besuch
bei Schulfreundinnen auf dem Lande gemacht, und als sie in den
Garten eintrat, sofort die Empfindung gehabt, hier sei sie schon
einmal gewesen; diese Empfindung habe sich, als sie die Wohn-S.
296 Zur Psychaparhalagr'e das Alltagsleben:
räume betrat, wiederholt, so daß sie vorher zu wissen glaubte,
welcher Raum der nächste sein würde, welche Aussicht man
von ihm aus haben werde usw. Es ist aber ganz ausgeschlossen
und durch ihre Erkundigung bei den Eltern widerlegt, daß dieses
Bekanntheitsgefühl in einem früheren Besuch des Hauses und
Gartens, etwa in ihrer ersten Kindheit, seine Quelle haben könnte.
Die Dame, die das berichtete, suchte nach keiner psychologischen
Erklärung, sondern sah in dem Auftreten dieser Empfindung
einen prophetischen Hinweis auf die Bedeutung, welche eben
diese Freundinnen später für ihr Gefühlsleben gewannen. Die
Erwägung der Umstände, unter denen das Phänomen bei ihr
auftrat, zeigt uns aber den Weg zu einer anderen Auflassung.
Als sie den Besuch unternahm, wußte sie, daß diese Mädchen
einen einzigen, schwerkranken Bruder hatten. Sie bekam ihn bei
dem Besuch auch zu Gesichte, fand ihn sehr schlecht aussehend
und dachte sich, daß er bald sterben werde. Nun war ihr eigener
einziger Bruder einige Monate vorher an Diphtherie gefährlich
erkrankt gewesen; während seiner Krankheit hatte sie vom
Elternhause entfernt wochenlang bei einer Verwandten gewohnt.
Sie glaubt, daß der Bruder diesen Inndbesuch mitmachte, meint
sogar, es sei sein erster größerer Ausflug nach der Krankheit
gewesen; doch ist ihre Erinnerung in diesen Punkten merk»
würdig unbestimmt, während alle anderen Details, und besonders
das Kleid1 das sie an jenem Tag trug, ihr überdeutlich vor Augen
stehen. Dem Kundigen wird es nicht schwer fallen, aus diesen
Anzeichen zu schließen, daß die Erwartung, ihr Bruder werde
sterben, bei dem Mädchen damals eine große Rolle gespielt hatte
und entweder nie bewußt geworden oder nach dern glücklichen
Ausgang der Krankheit energischer Verdrängung verfallen war.
Im anderen Falle hätte sie ein anderes Kleid, nämlich Trauer-
kleidung tragen müssen. Bei den Freundinnen fand sie nun die
analoge Situation vor, den einn'gen Bruder in Gefahr bald zu
sterben, wie es auch kun darauf wirklich eintraf. Sie hätte bewußtS.
XII. Dezermbnismu.s‚ z„f„zz„- und Aberglauben, Gcsl'chtspunklz 297
erinnern sollen., daß sie diese Situation vor wenigen Monaten
selbst durchlebt hatte; anstatt dies zu erinnern, was durch die
Verdrängung verhindert war, übertrug sie das Erinnerungsgefühl
auf die Lokalitäten, Garten und Haus, und verfiel der „fausse
remnnaissance“, daß sie das alles genau ebenso schon einmal
gesehen habe. Aus der Tatsache der Verdrängung dürfen wir
schließen, daß die seinerzeitige Erwartung, ihr Bruder werde
sterben, nicht weit entfernt vom Charakter einer Wunschphantasie
gewesen war. Sie wäre dann das einzige Kind geblieben. In ihrer
späteren Neurose litt sie in intensivster Weise unter der Angst,
ihre Eltern zu verlieren, hinter welcher die Analyse wie gewöhnlich
den unbewußten Wunsch des gleichen Inhalts aufdecken konnte.Meine eigenen flüchtigen Erlebnisse von „zie'j4‘z vu“ habe ich
mir in ähnlicher Weise aus der Gefühlskonstellation des Moments
ableiten können. „Das wäre wieder ein Anlaß, jene (unbewußte
und unbekannte) Phantasie zu wecken, die sich damals und damals
als Wunsch zur Verbesserung der Situation in mir gebildet hat.“
Diese Erklärung des „de'jz‘z vu“ ist bisher nur von einem einzigen
Beobachter gewürdigt werden. Dr. Ferenczi, dem die dritte
Auflage dieses Buches so viel wertvolle Beiträge verdankt, schreibt
mir hierüber: „Ich habe mich sowohl bei mir als auch bei anderen
davon überzeugt, daß das unerklärliche Bekanntheitsgefühl auf
unbevvußte Phantasien zurückzuführen ist, an die man in einer
aktuellen Situation unbewußt erinnert wird. Bei einem meiner
Patienten ging es anscheinend anders, in Wirklichkeit aber ganz
analog zu. Dieses Gefühl kehrte bei ihm sehr oft wieder, erwies sich
aber regelmäßig als von einem vergessenen (verdrängten)
Traumstück der vergangenen Nacht herrührend. Es scheint
also, daß das „de'jä Du“ nicht nur von Tagträumen, sondern
auch von nächtlichen Träumen abstarnmen kann.“Ich habe später erfahren, daß G»rasset 1904 eine Erklärung
des Phänomens gegeben hat, welche der meinigen sehr nahe
kommt.S.
298 Zur Psychopazholngiz de.. Alltagsleben:
Im Jahre 1915 habe ich in einer kleinen Abhandlung’ ein
anderes Phänomen beschrieben, welches dem „de'/'!) un“
recht nahe steht. Es ist das „dz'jä nannte“, die Illusion,
etwas bereits mitgeteilt zu haben, die besonders interessant ist7
wenn sie während der psychoanalytischen Behandlung auftritt.
Der Patient behauptet dann mit allen Anzeichen subjektiver
Sicherheit, daß er eine bestimmte Erinnerung schon längst
erzählt hat. Der Arzt ist aber des Gegenteils sicher und kann
den Patienten in der Regel seines Irrtums überführen. Die
Erklärung dieser interessanten Fehlleistung ist wohl die, daß der
Patient den Impuls und Vorsatz gehabt hat, jene Mitteilung zu
machen, aber versäumt hat, ihn auszuführen und daß er jetzt
die Erinnerung an die ersteren als Ersatz für das letztere, die
Ausführung des Vorsatzes, setzt.Einen ähnlichen Tatbestand, wahrscheinlich auch den gleichen
Mechanismus, zeigen die von Ferenczi so benannten „ver-
meintlichen Fehlhandlungen“? Man glaubt, etwas — einen
Gegenstand ‚_ vergessen, verlegt, verloren zu haben und kann
sich überzeugen, daß man nichts dergleichen getan hat, daß alles
in Ordnung ist. Eine Patientin kommt z. B. ins Zimmer des
Arztes zurück mit der Mutivierung, sie wolle den Regenschirm
holen, den sie dort stehen gelassen habe, aber der Arzt bemerkt7
daß sie ja diesen Schirm — in der Hand hält. Es bestand also
der Impuls zu einer solchen Fehlleistung und dieser genügte,
um deren Ausführung zu ersetzen. Bis auf diesen Unterschied
ist die vermeintliche Fehlleistung der wirklichen gleichmstellen.
Sie ist aber sozusagen wohlfeiler.E) Als ich unlängst Gelegenheit hatte, einem philosophisch
gebildeten Kollegen einige Beispiele von Namenvergessen mit.
1) Über fausn munmu'ssnnn („Mia movmé”) wihrend rler p1ychaunalyfischmArbeit. (Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, I, 1515. Furthnlten in Band vr
dieser Ge1mnsusgube.>
2) Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, in, 1915,S.
XII. Dmmi„i:„„‚ z„f„zu— und Aberglauben, Gesichtspunkte 299
Analyse vorzutragen, beeilte er sich zu erwidern: Das ist sehr
schön, aber bei mir geht das Namenvergessen anders zu. So leicht
darf man es sich offenbar nicht machen; ich glaube nicht, daß
mein Kollege je vorher an eine Analyse bei Namenvergessen
gedacht hatte; er konnte auch nicht sagen, wie anders es bei ihm
zugehe. Aber seine Bemerkung berührt doch ein Problem, welches
viele in den Vordergrund zu stellen geneigt sein werden. Trifft
die hier gegebene Auflösung der Fehl— und Zufallshandlungen
allgemein zu oder nur vereinzelt, und wenn letzteres, welches
sind die Bedingungen, unter denen sie zur Erklärung der auch
anderswie ermöglichten Phänomene herangezogen werden darf?
Bei der Beantwortung dieser Frage lassen mich meine Erfahrungen
im Stiche. Ich kann nur davon abmahnen, den aufgezeigten
Zusammenhang für selten zu halten, denn so oft ich bei mir
selbst und bei meinen Patienten die Probe angestellt, hat er sich
wie in den mitgeteilten Beispielen sicher nachweisen lassen, oder
haben sich wenigstens gute Gründe, ihn zu vermuten, ergeben.
Es ist nicht zu verwundern, wenn es nicht alle Male gelingt,
den verborgenen Sinn der Symptomhandlung zu finden, da die
Größe der inneren Widerstände, die sich der Lösung widersetzen,
als entscheidender Faktor in Betracht kommt Man ist auch nicht
imstande, bei sich selbst oder bei den Patienten jeden einzelnen
Traum zu deuten, es genügt, um die Allgemeingültigkeit der
Theorie zu bestätigen, wenn man nur ein Stück weit in den
verdeckten Zusammenhang einzudringen vermag. Der Traum,
der sich beim Versuche, ihn am Tage nachher zu lösen, refi‘aktär
zeigt, läßt sich oh eine Woche oder einen Monat später sein
Geheimnis entreißen, wenn eine unterdes erfolgte reale Verän-
derung die miteinander streitenden psychischen Wertigkeiten
herabgesetzt hat. Das nämliche gilt für die Lösung der Fehl-
und Symptomhandlungen; das Beispiel von Verlesen „Im Faß
durch Europa“ (auf Seite 119) hat mir die Gelegenheit gegeben
zu zeigen, wie ein anfänglich unlösbares Symptom der AnalyseS.
500 Zur Psywhvpathologie des Allragslebcru
zugänglich wird, wenn das reale Interesse an den ver—
drängten Gedanken nachgelassen hat.‘ Solange die Möglichkeit
bestand, daß mein Bmder den heneideten Titel vor mir erhalte,
Widerstand das genannte Verlesen allen wiederholten Bemühungen
der Analyse; nachdem es sich herausgestth hatte, daß diese
Bevorzugung unwahrscheinlich sei, klärte sich mir plötzlich der
Weg, der zur Auflösung desselben führte. F; wäre also unlichtig,
von all den Fällen, welche der Analyse widerstehen, zu behaupten,
sie seien durch einen anderen als den hier aufgedeckten psychi—
schen Mechanismus entstanden; es brauchte für diese Annahme
noch andere als negative Beweise. Auch die bei Gesunden wahr—
scheinlich allgemein vorhandene Bereitwilligkeit, an eine andere
Erklärung der Fehl- und Sympwmhnndlungen zu glauben, ist
jeder Beweiskraft bar; sie ist7 wie selbstverständlich, eine Äuße—
rung derselben seelischen Kräfte, die das Geheimnis hergestellt
haben und die sich darum auch für dessen Bewahrung einsetzen,
gegen dessen Aufhellung aber Sträuben.Auf der anderen Seite dürfen wir nicht übersehen, daß die
verdrängten Gedanken und Begungen sich den Ausdruck in
Symptom— und Fehlbandlnngen ja nicht selbständig schaffen
Die technische Möglichkeit für solches Ausgleiten der Inner-
vstionen muß unabhängig von ihnen gegeben sein; diese wird
dann van der Absicht des Vexdrängten, zu: bewußten Geltung
zu kommen, gern ausgenützt. Welche Struktur- und Funktions-
relationen es sind, die sich solcher Absicht zur Verfügung stellen,
das haben für den Fall der sprachlichen Fehlleistung eingehende1) Hier knüpfen uhr interessante Probleme ökonomitcher Nntur m. man,
welche auf die Tntnehe Rücklicht nehmen, daß die psychischen Abliufe auf Luiz-
gewinn und Un'lusuuflxebung fielen. Es m bereits ein ökonnmilnhu Problem, wie
ei möglich wird inen durch ein Unlustznofiv vergessenen Nimm auf dem Wege
mmander Anni 'onan wiederzuguwinnen. Eine schöne Arbeit von Tnuk („Em-
wemiiig de. Venlrängungsmolz'vs durch Bekompense". Internationale Zn'uclm‘ft für
Plychonnnlyu‚ ], ig;5> zeigt an guten Beispielen, wie det vergessen: Name wieder
zugänglich wird, wenn „ gelungen in, ihn in eine 1u'‚zbmm Auozi.iion einzu-
huieh=n‚ die der bei der Reproduktion iu erwartenden Unhm die nge mm. kann.S.
XII. Demminismw, Zufallv- und Abzrgüzuben, Gesichtspunkte 5a;
Untersuchungen der Philosophen und Philologen festzustellen
sich bemüht. Unterscheiden wir so an den Bedingungen der
‘ehl- und Symptomhandlung das unbewußte Motiv von den ihm
entgegenkommenden physiologischen und psychophysischen Rela—
tionen, so bleibt die Frage offen, ob es innerhalb der Breite der
Gesundheit noch andere Momente gibt, welche wie das unbe-
wußte Motiv und an Stelle desselben, auf dem Wege dieser
Relationen die Fehl— und Symptomhandluugen zu erzeugen ver-
mögen. Es ist nicht meine Aufgabe, diese Frage zu beantworten.Es liegt übrigens auch nicht in meiner Absicht, die Verschieden-
heiten zwischen der psychoanaly'tischen und der landläufigen
Auffassung der Fehlleistungen, die ja groß genug sind, noch zu
übertreiben. Ich möchte vielmehr auf Fälle hinweisen, in denen
diese Unterschiede viel von ihrer Schärfe einbüßen. Zu den ein—
fachsten und unauffälligsten Beispielen des Versprechens und
Verschreibens, bei denen etwa nur Worte zusammengezogen
oder Worte und Buchstaben ausgelassen werden, entfallen die
komplizierteren Deutungen. Vom Standpunkt der Psychoanalyse
muß man behaupten, daß in diesen Fällen sich irgendeine
Störung der Intention angezeigt hat7 kann aber nicht angeben,
woher die Störung stammte und was sie beabsichtigte. Sie
brachte eben nichts anderes zustande, als ihr Vorhandensein zu
bekunden. In denselben Fällen sieht man dann auch die von
uns nie bestrittenen Begünstigungen der Fehlleistung durch laut
liche Wertverhältnisse und naheliegende psychologische Assozia
tionen in Wirksamkeit treten. Es ist aber eine billige wisen-
schaftliche Forderung, daß man solche rudimentäre Fälle von
Versprechen oder Verschreiben nach den besser ausgeprägten
beurteile, deren Untersuchung so unzweideutige Aufschlüsse über
die Verursachung der Fehlleistungen ergibt.F) Seit den Erörterungen über das Versprechen haben wir uns
begnügt zu beweisen, daß die Fehlleistlmgen eine verborgeneS.
509 Zur Psyßhapatholagie des Alltagskbzns
Motivierung haben, und uns mit dem Hilfsmittel der Psychoanalyse
den Weg zur Kenntnis dieser Motivierung gebahnt, Die allgemeine
Natur und die Besonderheiten der in den Fehlleistungen zum
Ausdruck gebrachten Psychischen Faktoren haben wir bisher fast
ohne Berücksichtigung gelassen, jedenfalls nach nicht versucht,
dieselben näher zu bestimmen und auf ihre Geselzmäßigkeit zu
prüfen. Wir werden auch jetzt keine gründliche Erledigung des
Gegenstandes versuchen, denn die ersten Schritte werden uns bald
belehrt haben, daß man in dieses Gebiet besser von anderer Seite
einzudringen vermag.‘ Man kann sich hier mehrere Fragen vorlegen,
die ich Wenigstens anfiihren und in ihrem Umfang umschreiben
will. 1.) Welches Inhalts und welcher Herkunft sind die Gedanken
und Regungen, die sich durch die Fehl- und Zufallshandlungen
andeuten? 2.) Welches sind die Bedingungen dafür, daß ein Gedanke
oder eine Regung genötigt und in den Stand gesetzt werde, sich
dieser Vorfälle als Ausdrucksmittel zu bedienen? 5.) Lassen sich
konstante und eindeutige Beziehungen zwischen der Art dt?!
Fehlleistungen und den Qualitäten des durch sie zum Ausdruck
Gebrachten nachweisen?Ich beginne damit, einiges Material zur Beantwortung der letzten
Frage zusammenzutragen. Bei der Erörterung der Beispiele von
Versprechen haben wir es für nötig gefunden, über den Inhalt
der intendierten Rede hinauszugehen, und haben die Ursache
der Redestörung außerhalb der Intention suchen müssen. Dieselbe
lag dann in einer Reihe von Fällen nahe und war dem Bewußtsein
des Sprechenden bekannt. In den scheinbar einfachsten und durch-
sichtigsten Beispielen war es eine gleichberechtigt klingende, andere
Fassung desselben Gedankens, die dessen Ausdruck störte, ohne
daß man hätte angeben können, warum die eine unterlegen‚ die
andere durchged.rungen war (Kontaminationen von Meringer]) Diese Schrift ist durchaus populär gehalten, will nur durch eine Hänfung von Bei-
spielen den Weg für die notwendige Annahme unhewuß ter un d do ch wirk-
s a m e r seelischer Vorgänge ahnen und vermeidet alle theoretischen Erwägungen
über die Natur dieser Unhewußten.S.
XII, Determinismus, Zufalb— und Abzrglaulzzn‚ Gerichtspunktz 505
und Mayer). In einer zweiten Gruppe von Fällen war das
Unterliegen der einen Fassung motiviert durch eine Rücksicht,
die sich aber nicht stark genug zur völligen Zurückhaltung erwies
(„zum Vorschwein gekommen“). Auch die zurückgehaltene Fassung
war klar bewußt. Von der dritten Gruppe erst kann man ohne
Einschränkung behaupten, daß hier der störende Gedanke von
dem intendierten verschieden war, und kann hier eine, wie es
scheint, wesentliche Unterscheidung aufstellen. Der störende Gedanke
ist entweder mit dem gestörten durch Gedankenassoziationen
verbunden (Störung durch inneren Widerspruch), oder er ist ihm
wesensfremd, und durch eine befremdende äu ßerlich e Assoziatinn
ist gerade das gestörte Wort mit dem störenden Gedanken, der
oft unbewußt ist, verknüpft. In den Beispielen, die ich aus
meinen Psychoanalysen gebracht habe, steht die ganze Rede unter
dem Einfluß gleichzeitig aktiv gewordener, aber völlig unbewuß'ter
Gedanken, die ich entweder durch die Störung selbst verraten
(Klapperschlange —— Kleopatra) oder einen indirekten Einfluß
äußern, indem sie ermöglichen, daß die einzelnen Teile der bewußt
intendiertenliede einanderstören(Asenatm en: onausenauer-
straße, Reminiszenzen an eine Französin dahinterstehen). Die
zurückgehaltenen oder unhewußten Gedanken, von denen die
Sprechstörung ausgeht, sind von der mannigfaltigsten Herkunft.
Eine Allgemeinheit enthüllt uns diese Überschau also nach keiner
Richtung.Die vergleichende Prüfung der Beispiele von Vorlesen und
Verschreiben führt zu den nämlichen Ergebnissen. Einzelne Fälle
scheinen wie beim Versprechen einer weiter nicht motivierten
Verdichtungsarbeit ihr Entstehen zu danken (z. B.: der Apfe).
Man möchte aber gern erfahren, ob nicht doch besondere
Bedingungen erfüllt sein müssen, damit eine solche Verdichtung,
die in der Traumarheit regelrecht, in unserem wachen Denken
fehlerhaft ist, Platz greife, und bekommt hierüber aus den
Beispielen selbst keinen Aufschluß. Ich würde es aber ablehnen,S.
304 Zur Psychapathalogiz des Alltagsleben:
hieraus den Schluß zu ziehen, es gebe keine solchen Bedingungen
als etwa den Nachlaß der bewußten Aufmerksamkeit, da ich von
anderswuher weiß, daß sich gerade automatische Verrichtungen
durch Korrektheit und Verläßlichkeit auszeichnen. Ich möchte
eher betonen7 daß hier, wie so häufig in der Biologie, die normalen
oder dem Normalen angenäherten Verhältnisse ungünstigere Objekte
der Forschung sind als die pathologischen. Was bei der Erklänmg
dieser leichtesten Störungen dunkel bleibt, wird nach meiner
Erwartung durch die Aufklärung schwerer Störungen Licht
empfangen.Auch beim Verlesen und Verschreiben fehlt es nicht an Beispielen,
welche eine entferntere und komplizierten! Motivierung erkennen
lassen. „Im Faß durch Europa“ ist eine Lesestörung, die sich
durch den Einfluß eines enflegenen, wesensfremden Gedankens
aufklän, welcher einer verdrängten Regung von Eifersucht und
Ehrgeiz entspringt, und den „Wechse “ des Wortes „B ef {ir-derung“
zur Verknüpfung mit dem gleichgültigen und harmlosen Thema,
das gelesen wurde, heliützt. Im Falle Burckhard ist der Name
selbst ein solcher „Wechse “.Es ist unverkennbar, daß die Störungen der Sprechfimktionen
leichter Zustandekommen und weniger Anforderungen an die
störenden Kräfte stellen als die anderer psychischer LeistungenAuf anderem Boden steht man bei der Prüfung des Vergessens
im eigentlichen Sinne, d. h. des Vergessens von vergangenen
Erlebnissen (das Vergessen von Eigennamen und Fremdworten,
wie in den Abschnitten I und II, könnte man als „Entfallen“,
das von Vorsätzen als „Unterlassen“ von diesem Vergessen sem
strictiori absondern). Die Grundbedingungen des normalen Vorgangs
beim Vergessen sind unbekannt.’ Man wird auch daran gemalmt,1) Über den Meehlnismus der eigentlichen Vergessen: kann ich etwa falgende
Andeutungen geben: Das Erinnenmgsrnateriel unterliegt im allgemeinen zwei Ein<
flüasen. der Verdichtung und der Entstellung. Die EnMellung ist das Werk der imSeelenleben herrschenden Tendenzen und wendet sich vor allem gegen die mm-
wirksam gehlieben- En'nnmngnpnnn, an lich gegen an Verdichtung resinenterS.
XI]. Derer„n'nimnn‚ Zufalb— und Aberglauben, Gesichtspunkte 505
daß nicht alles vergessen ist, was man dafür hält. Unsere Erklärung
hat es hier nur mit jenen Fällen zu tun, in denen das Vergessen
bei uns ein Befremden erweckt, insofern es die Regel verletzt,
daß Unw-ichtiges vergessen, Wichtiges aber vom Gedächtnis bewahrt
wird. Die Analyse der Beispiele von Vergessen, die uns nach
einer besonderen Aufklärung zu verlangen scheinen, ergibt als
Motiv des Vergessens jedesmal eine Unlust7 etwas zu erinnern,
was peinliche Empfindungen erwecken kann. Wir gelangen zur
Vermutung, daß dieses Motiv im psychischen Leben sich ganz
allgemein zu äußern strebt, aber durch andere gegenwirkende
Kräfte verhindert wird, sich irgendwie regelmäßig durchzusetzen.
Umfang und Bedeutung dieser Erinnerungsunlust gegen peinliche
Eindrücke scheinen der sorgfältigsten psychologischen Prüfung wert
zu sein; auch die Frage, welche besonderen Bedingungen das
allgemein angestrebte Vergessen in einzelnen Fällen ermöglichen,
ist aus diesem weiteren Zusammenhange nicht zu lösen.Beim Vergessen von Vorsätzen tritt ein anderes Moment in den
Vurdergnmd; der beim Verdrängen des peinlich zu Erinnernden
nur vermutete Konflikt wird hier greifbar, und man erkennt bei
der Analyse der Beispiele regelmäßig einen Gegenwillen, der sich
dem Vorsatz vvidersetzt, ohne ihn aufzuhehen. Wie bei früherverhalten. Die indifi'erent gewordenen Spuren reriniien dem Verdichmngevnrgung
nhne Gegenwehr, doch kann mm beobachten. rhß überdies Entstellungstendenzen
eich en dem iudifierenten Mauer-in] sättigen, weiche dort, wu sie sich äußern wollten,
unheiriedigt gehiieheu sind. Du diese Prozerse der Verdichtung und Entsmllung sich
über lange Zeiten hinzinhen, wihrend welcher alle frischen Erlebnisse auf die
Umgerulmg des Gedächtnilinhnltes einwirken, meinen wir, er sei die Zeit, welehe
die Erinnerungen unsicher und undeudich macht. Sehr w.hreeheinhch ist heim
Vergeuen von einer direkten Funktion der Zeit überhaupt nicht die Rede. _ An den
Verdringten Erinnerimgsspuren kann men kunst-tieren, duii sie durch die längste
Zeitdauer keine Veränderungen erfahren hehen. Du Unhewulite ist überhaupt zeitlos.
Der wichtigste und auch befiemrlenrlshe Charakter der neychienhen Fixierung ist der,
duii elle Eindrix e einerseits in der nämlichen An erhalten sind, wie eie uufgennmnren
Wurden. und iiherdiee noch in in den Formen, die sie hei den weit9r— Entwick-
lungen .ngennrnnien haben, ein Verhiiimie. welches sich durch keinen Vergleich une
einer .ndeeen Sphäre erläutern Mit Der Theorie nufuige ließe sich also jeder
frühere Zustand des Gedächrnisinhaltes wieder für die Erinnerung herstellen, auch
wenn deinen Elemente alle ursprünglichen Beziehungen längst gegen neuere ein.
getznscht haben.Freud. IV. im
S.
506 Zur Psychopat/lologie des Jlltagskbem
besprochenen Fehlleistungen erkennt man auch hier zwei Typen
des psychischen Vorganges; der Gegenwille kehrt sich entweder
direkt gegen den Vorsatz (bei Absichten von einigem Belang)
oder er ist dem Vorsatz selbst wesensfremd und stellt seine
Verbindung mit ihm durch eine äußerliche Assoziation her
(bei fast indifferenten Vorsätzen).Derselbe Konflikt beherrscht die Phänomene des Vergreifens.
Der Impuls, der sich in der Störung der Handlung äußert, ist
häufig ein Gegenimpuls, doch noch öfter ein überhaupt fremder,
der nur die Gelegenheit benützt, sich bei der Ausführung der
Handlung durch eine Störung derselben zum Ausdruck zu bringen.
Die Fälle, in denen die Störung durch einen inneren Wider-
spruch erfolgt, sind die bedeutsameren und betreffen auch die
wichtigeren Vertichtungen.Der innere Konflikt tritt dann bei den Zufalls- oder Symptom-
handlungen immer mehr zurück. Diese vom Bewußtsein gering
geschätzten oder ganz übersehenen motorischen Äußerungen
dienen so mannigfachen unbewußten oder zurückgehaltenen
Regungen zum Ausdruck; sie stellen meist Phantasien oder
Wünsche symbolisch dar.Zur ersten Frage, welcher Herkunft die Gedanken und Regungen
seien, die sich in den Fehlleistungen zum Ausdruck bringen, läßt
sich sagen, daß in einer Reihe von Fällen die Herkunft der
störenden Gedanken von unterdrückte‘n Regungen des Seelenlebens
leicht nachzuweisen ist. Egoistische, eifersüchtige, feindseliga
Gefühle und Impulse, auf denen der Druck der moralischtm
Eniehung lastet, bedienen sich bei Gesunden nicht selten des
Weges der Fehlleistungen, um ihre unleugbar vorhandene, aber
von höheren seelischen Instanzen nicht anerkannte Macht irgendwie
zu äußern. Das Gewährenlassen dieser Fehl- und Zufallshandlungen
entspricht zum guten Teile einer bequemen Duldung des
Unmoralischen. Unter diesen unterdrückten Regungen spielen die
mannigfachen sexuellen Strömungen keine geringfügige Rolle. EsS.
XII. thzrminirmur, Zufalls— und Abzrglauben, Gesichtspunkte 507
ist ein Zufall des Materials, wenn gerade sie so selten unter
den durch die Analyse aufgedeckten Gedanken in meinen
Beispielen erscheinen. Da ich vorwiegend Beispiele aus meinem
eigenen Seelenleben der Analyse unterzogen habe, so war die
Auswahl von vornherein parteiisch und auf den Ausschluß des
Sexuellen gerichtet. Andere Male scheinen es höchst harmlose
Einwendungen und Rücksichten zu sein, aus denen die störenden
Gedanken entspringen.Wir stehen nun vor der Beantwortung der zweiten Frage,
welche psychologischen Bedingungen dafiir gelten, daß ein Gedanke
seinen Ausdruck nicht in voller Form, sondern in gleichsam
parasitärer, als Modifikation und Störung eines anderen suchen
müsse. Es liegt nach den auffälligsten Beispielen von Fehlhandlung
nahe, diese Bedingungen in einer Beziehung zur Bewußtseins-
fähigkeit zu suchen, in dem mehr oder minder entschieden
ausgeprägten Charakter des „Verdrängten“. Aber die Verfolgung
durch die Reihe der Beispiele löst diesen Charakter in immer
mehr verschwommene Andeutungen auf. Die Neigung, über etwas
als zeitrauhend hinwegzukommen, — die Erwägung, daß der
betreffende Gedanke nicht eigentlich zur intendierten Sache gehört,
* scheinen als Motive für die Zurückdrängung eines Gedankens,
der dann auf den Ausdruck durch Störung eines anderen
angewiesen ist, dieselbe Rolle zu spielen wie die moralische
Verurteilung einer unhotmäßigen Gefühlsregung oder die Abkunft
von völlig unbewul3ten Gedankenzügen. Eine Einsicht in die
allgemeine Natur der Bedingtheit von Fehl- und Zufallsleistungen
läßt sich auf diese Weise nicht gewinnen. Einer einzigen bedeut-
samen Tatsache wird man hei diesen Untersuchungen habhaft; je
harmloser die Motivierung der Fehlleistung ist, je weniger anstößig
und damm weniger bewußtseinsuniähig der Gedanke ist, der sich
in ihr zum Ausdruck bringt, desto leichter wird auch die Auf—
lösung des Phänomens, wenn man ihm seine Aufmerksamkeit
zugewendet hat; die leichtesten Fälle des Versprechens werden„'
S.
503 Zur Psychoputhnlogiz des Alltagslth
sofort bemerkt und spontan korrigiert. Wo es sich um Motiv-ierung
durch wirklich verdrängte Regungen handelt, da bedarf es zur
Lösung einer sorgfältigen Analyse, die selbst zeitweise auf
Schwierigkeiten stoßen oder mißlingen kann..Es ist also wohl berechtigt, das Ergebnis dieser letzten Unter-
suchung als einen Hinweis darauf zu nehmen, daß die befriedigende
Aufklärung für die psychologischen Bedingungen der Fehl- und
Zufallshandlungen auf einem anderen Wege und von anderer
Seite her zu gewinnen ist. Der nachsichtige Leser möge daher in
diesen Auseinandersetzungen den Nachweis der Bruchflächen sehen,
an denen dieses Thema ziemlich künstlich aus einem größeren
Zusammenhange herausgelöst wurde.G ) Einige Worte sollen zum mindesten die Richtung nach
diesem weiteren Zusammenhänge andeuten. Der Mechanismus
der Fehl- und Zufallsbandlungen, wie wir ihn durch die Anwendung
der Analyse kennen gelernt haben, zeigt in den wesentlichsten
Punkten eine Übereinstimmung mit dem Mechanismus der
Traumhildung, den ich in dem Abschnitt „Traumarbeit“ meines
Buches über die Traumdeutung auseinandergesetzt habe. Die
Verdichtungen und Kompromißbildungen (Kontaminationen) findet
man hier wie dort; die Situation ist die nämliche, daß unbewußte
Gedanken sich auf ungewöhnlichen Wegen, über äußere Assozia-
tionen, als Modifikation von anderen Gedanken zum Ausdruck
bringen. Die Ungereimtheiten, Absurditäten und Irrtümer des
Trauminhaltes, denen zufolge der Traum kaum als Produkt
psychischer Leistung anerkannt wird, entstehen auf dieselbe Weise
freilich mit freierer Benutzung der vorhandenen Mittel7 wie die
gemeinen Fehler unseres Alltagslebens; hier wie dort löst sich
der Anschein inkorrekter Funktion durch die
eigentümliche Interferenz zweier oder mehrerer
korrekter Leistungen. Aus diesem Zusammentreffen ist ein
wichtiger Schluß zu ziehen: Die eigentümliche Arbeitsweise,S.
XII. Dz!4rminisnwr‚ afau- und Aber;lmbm‚ Gm'chtspunhe 509
deren auffälligste Leistung wir im Trauminhelt erkennen, darf
nicht auf den Schlafzustand des Seelenlehens zurückgeführt werden,
wenn wir in den Fehlhandlungen so reichliche Zeugnisse für
ihre Wirksamkeit während des wachen Lebens besitzen. Derselbe
Zusammenhang verbietet uns auch, tiefg-reii'enden Zerfall der
Seelentätigkeit, krankhafte Zustände der Funktion als die Bedingung
dieser uns ahnorm und fremdartig erscheinenden psychischen
Vorgänge anzusehen.‘Die richtige Beurteilung der sonderharen psychischen Arbeit,
welche die Fehlleistung wie die Traumbilder entstehen läßt,
wird uns erst ermöglicht, wenn wir erfahren haben, daß die
psychoneurotischen Symptome, speziell die psychischen Bildungen
der Hysterie und der Zwangsneurose‚ in ihrem Mechanimnus
alle wesentlichen Züge dieeer Arbeitsweise wiederholen. An dieser
Stelle schlüsse sich also die Fortsetzung unserer Untersuchungen
an. Für uns hat es aber noch ein besonderes Interesse, die Fehl-,
Zufalls- und Symptomhandlungen in dem Lichte dieser letzten
Analogie zu betrachten. Wenn wir sie den Leistungen der
Psychoneurosen, den neurotischen Symptomen, gleichstellen,
gewinnen zwei oft wiederkehrende Behauptungen, daß die Grenze
zwischen nervöser Norm und Ahnormitiit eine fließende, und daß
wir alle ein wenig nervös seien, Sinn und Unterlage. Man kann
sich vor aller ärztlichen Erfahrung verschiedene Typen von
solcher bloß angedeuteter Nervosität — von formt: frustu der
Neurosen ——- konstruieren: Fälle, in denen nur wenige Symptome,
oder diese selten oder nicht heftig auftreten, die Abschwächung
also in die Zahl, in die Intensität, in die zeitliche Ausbreitung
der krenkhaften Erscheinungen verlegen; vielleicht würde man
aber gerade den Typus nicht ernten, welcher als der häufigste
den Übergang zwischen Gesundheit und Krankheit zu vermitteln
scheint. Der uns vorliegende Typus, dessen Krankheitsdußerungen
die Fehl— und Symptomhandlungen sind, zeichnet sich nämlich;) Vgl. n.... „Traumdeutung“, s. 559. (7. Aufl., s. 449.)
S.
Zur Prychopazhohgie des Alltagxlcbßm
dadurch aus, daß die Symptome in die mindest wichtigen
psychischen Leistungen verlegt sind, während alles, was höheren
psychischen Wert beanspruchen kann, frei von Störung var sich
geht. Die gegeanige Unterbringung der Symptome, ihr Hervor-
treten an den wichtigsten individuellen und sozialen leistungen,
so daß sie Nahrungsaufnahme und Sexualverkehr, Berul'sarbeit
und Geselligkeit zu stören vermögen, kommt den schweren
Fällen von Neurose zu und charakterisiert diese besser als etwa
die Mannigfaltigkeit oder die Lebheftigkeit der Krankheits-
äußerungen.Der gemeinsame Charakter aber der leichtesten wie der schwer-
sten Fälle, an dem auch die F ehl— und Zufallshandlungen Anteil
haben, liegt in der Rückführharkeit der Phänomene
auf unvollkommen unterdrücktes psychisches
Material, das, vom Bewußtsein abgedrängt, doch
nicht jeder Fähigkeit, sich zu äußern, beraubt
w o r d e n i s t.
freudgs4
267
–310