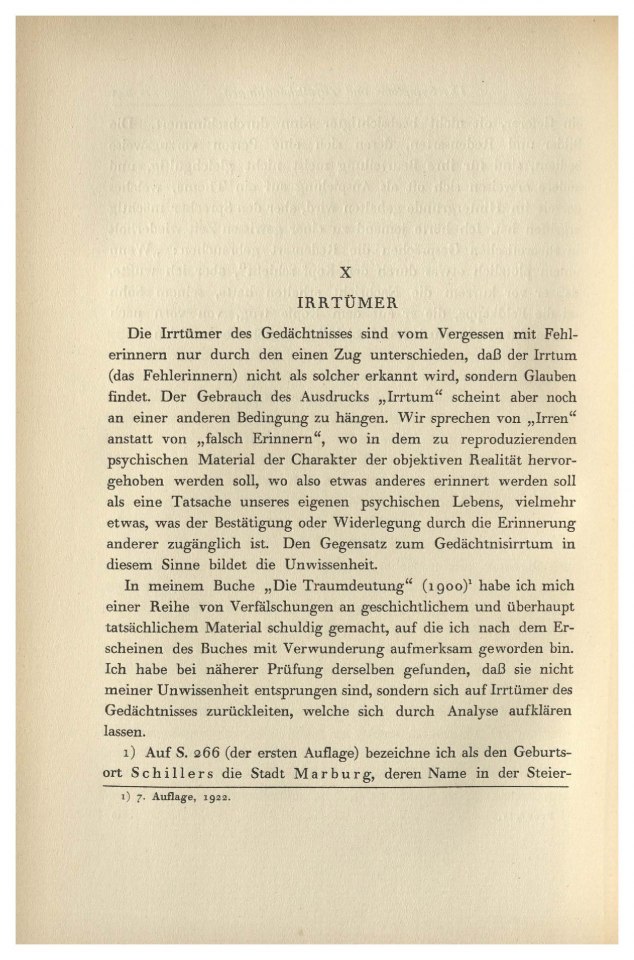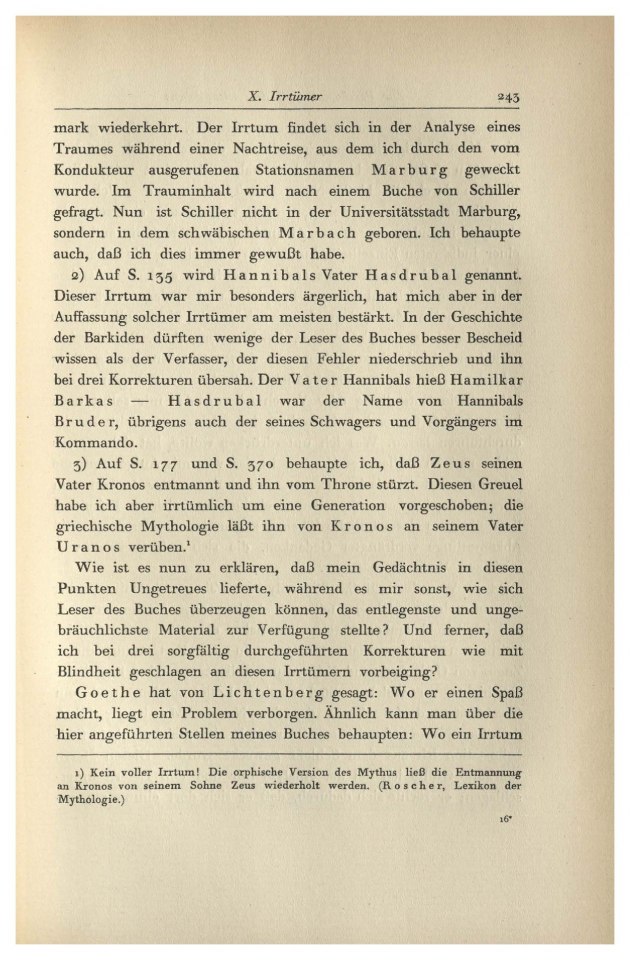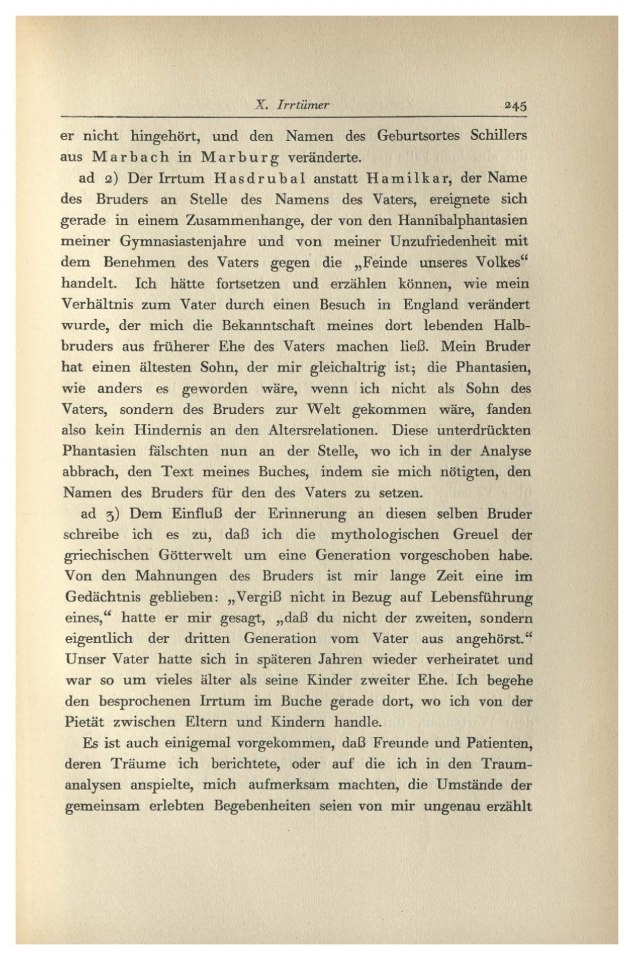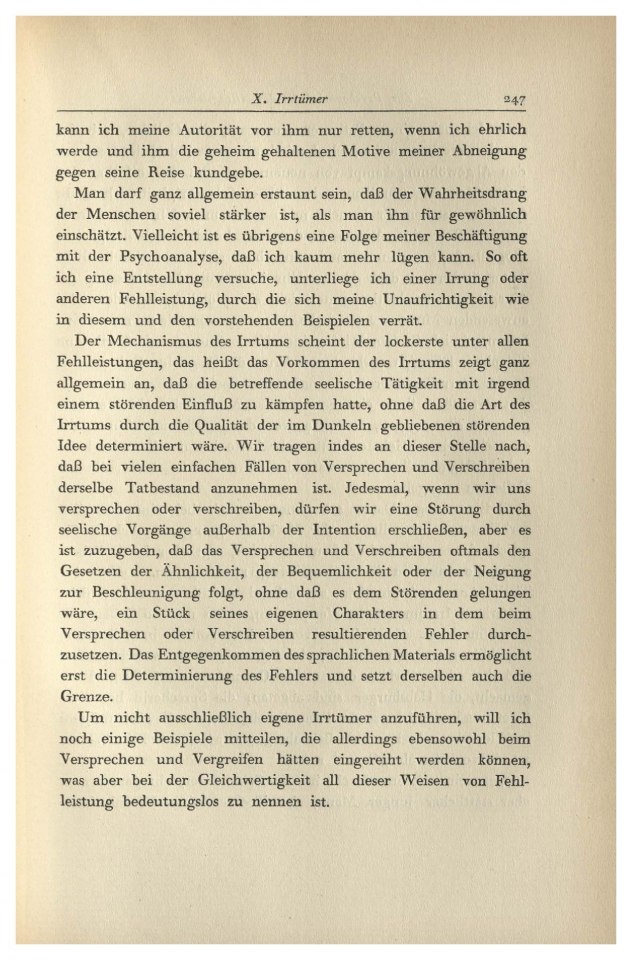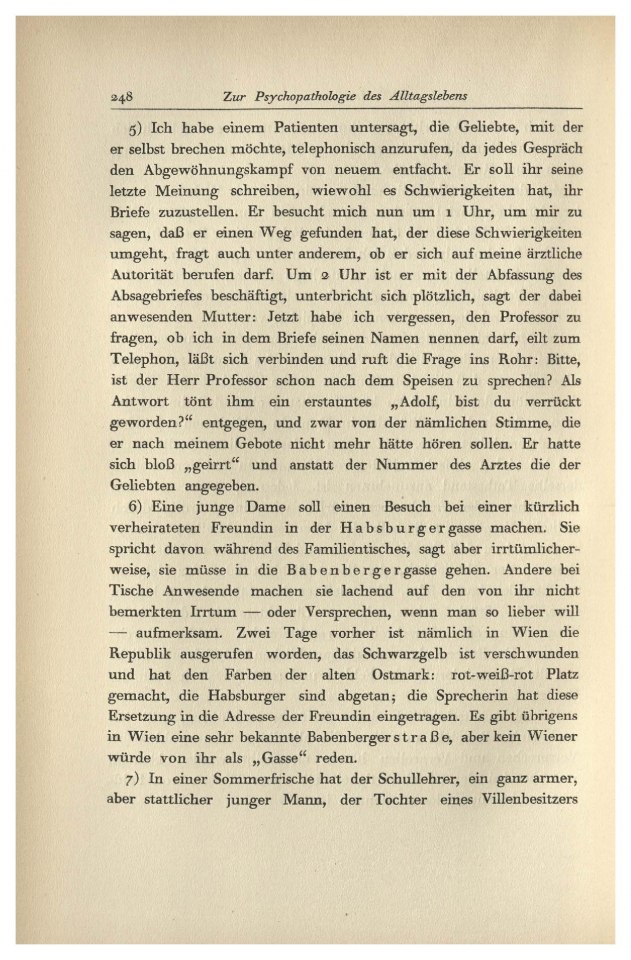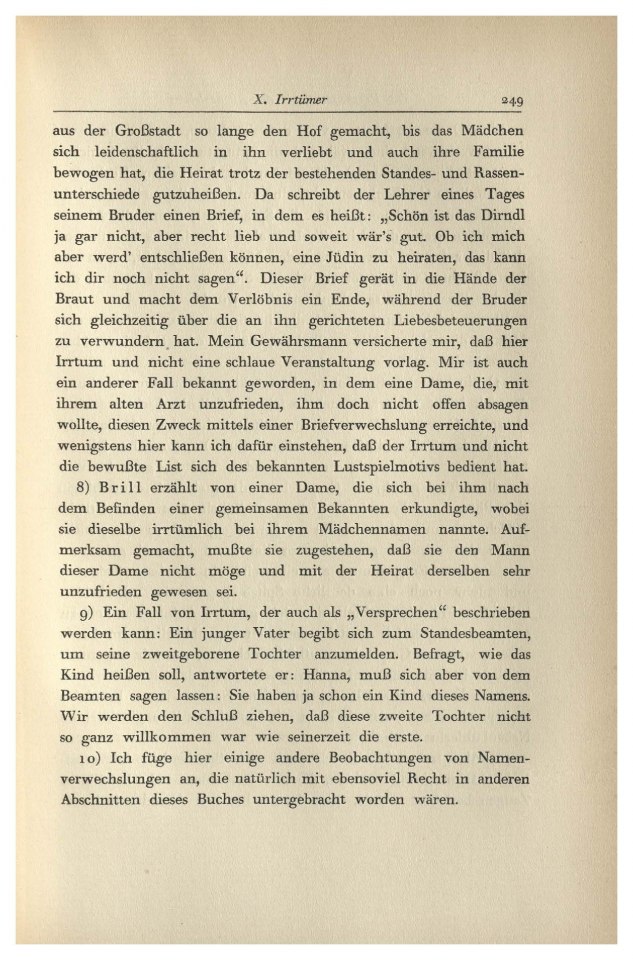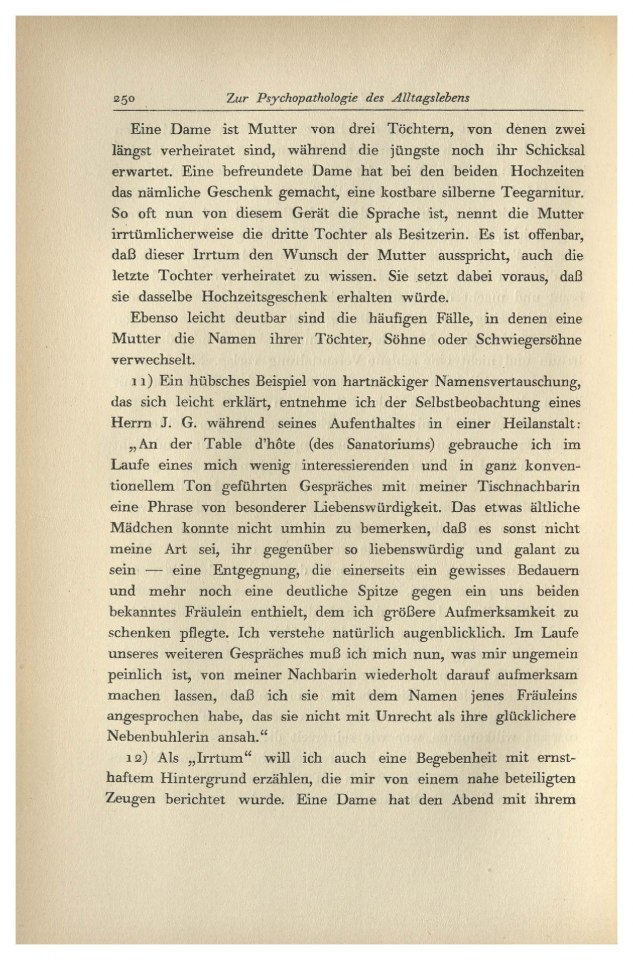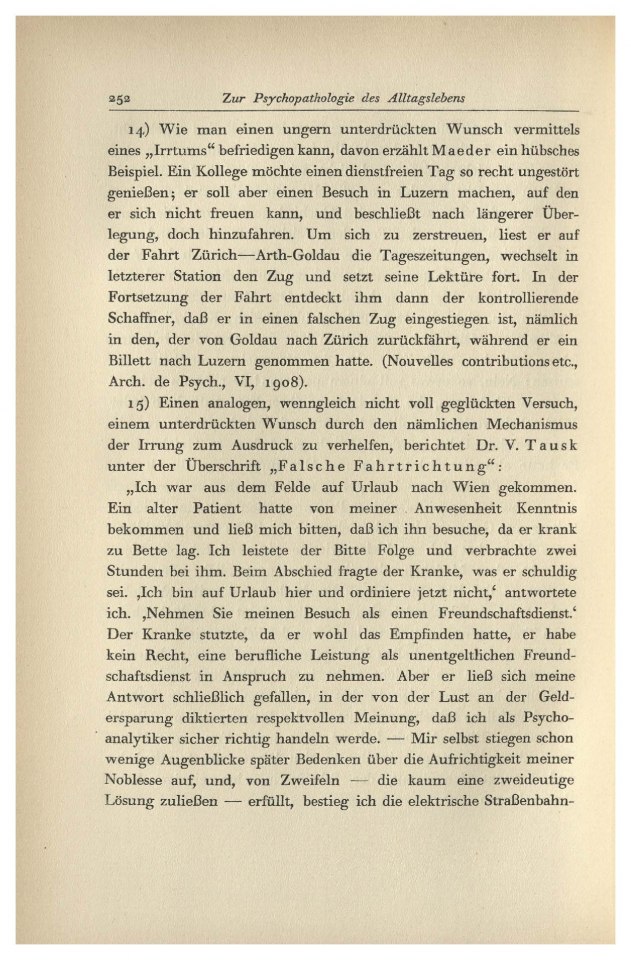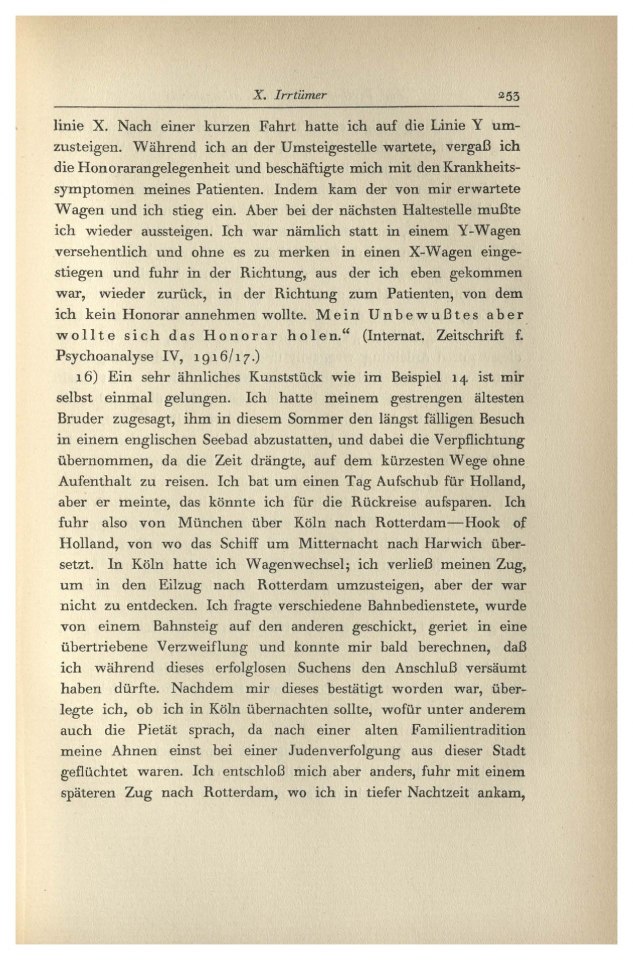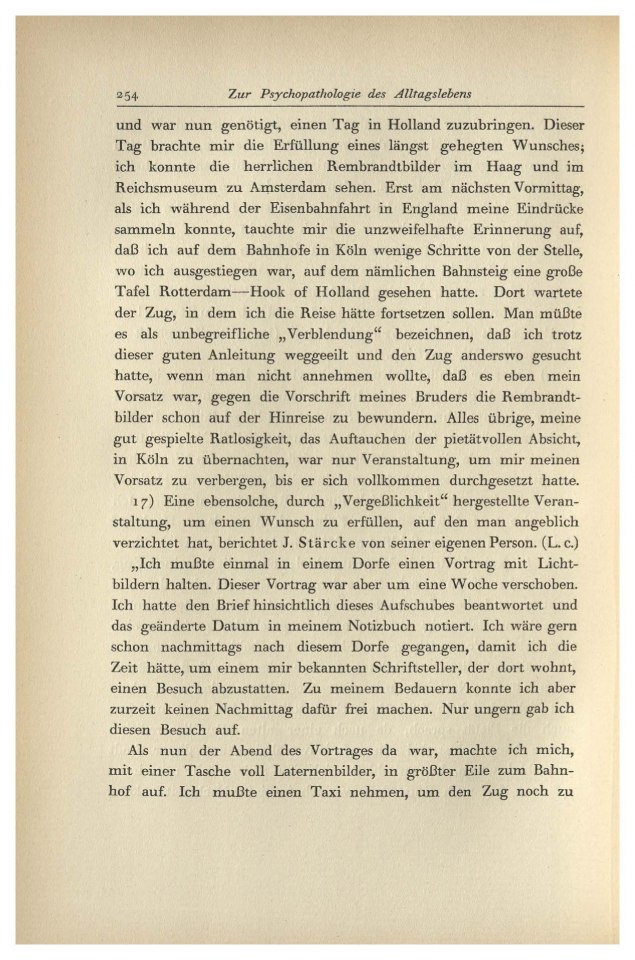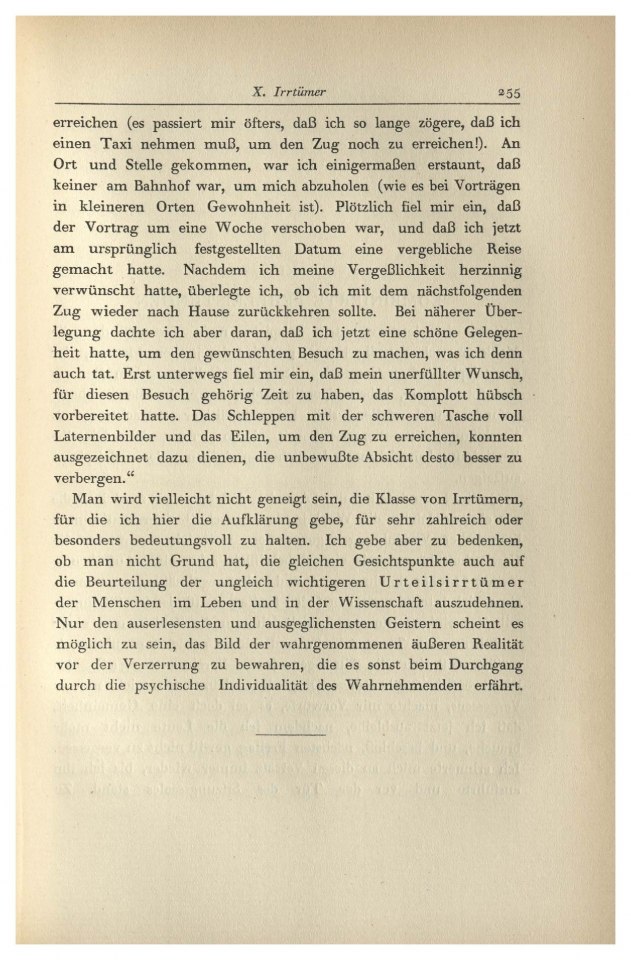S.
IRRTÜMER
Die Irrtümer des Gedächtnisses sind vom Vergessen mit Fehl-
erinnern nur durch den einen Zug unterschieden, daß der Irrtum
(das Fehlerinnern) nicht als solcher erkannt wird, sondern Glauben
findet. Der Gebrauch des Ausdrucks „Irrtum" scheint aber noch
an einer anderen Bedingung zu hängen. Wir sprechen von,,Irren"
anstatt von falsch Erinnern", wo in dem. zu reproduzierenden
psychischen Material der Charakter der objektiven Realität hervor-
gehoben werden soll, wo also etwas anderes erinnert werden soll
als eine Tatsache unseres eigenen psychischen Lebens, vielmehr
etwas, was der Bestätigung oder Widerlegung durch die Erinnerung
anderer zugänglich ist. Den Gegensatz zum Gedächtnisirrtum in
diesem Sinne bildet die Unwissenheit.
In meinem Buche „Die Traumdeutung" (1900)' habe ich mich
einer Reihe von Verfälschungen an geschichtlichem und überhaupt
tatsächlichem Material schuldig gemacht, auf die ich nach dem Er-
scheinen des Buches mit Verwunderung aufmerksam geworden bin.
Ich habe bei näherer Prüfung derselben gefunden, daß sie nicht
meiner Unwissenheit entsprungen sind, sondern sich auf Irrtümer des
Gedächtnisses zurückleiten, welche sich durch Analyse aufklären
lassen.
1) Auf S. 266 (der ersten Auflage) bezeichne ich als den Geburts-
ort Schillers die Stadt Marburg, deren Name in der Steier-
1) 7. Auflage, 1922.
S.
X. Irrtümer
243
mark wiederkehrt. Der Irrtum findet sich in der Analyse eines
Traumes während einer Nachtreise, aus dem ich durch den vom
Kondukteur ausgerufenen Stationsnamen Marburg geweckt
wurde. Im Trauminhalt wird nach einem Buche von Schiller
gefragt. Nun ist Schiller nicht in der Universitätsstadt Marburg,
sondern in dem schwäbischen Marbach geboren. Ich behaupte
auch, daß ich dies immer gewußt habe.
2) Auf S. 135 wird Hannibals Vater Hasdrubal genannt.
Dieser Irrtum war mir besonders ärgerlich, hat mich aber in der
Auffassung solcher Irrtümer am meisten bestärkt. In der Geschichte
der Barkiden dürften wenige der Leser des Buches besser Bescheid
wissen als der Verfasser, der diesen Fehler niederschrieb und ihn
bei drei Korrekturen übersah. Der Vater Hannibals hieß Hamilkar
Barkas
Hasdrubal war der Name von Hannibals
Bruder, übrigens auch der seines Schwagers und Vorgängers im
Kommando.
3) Auf S. 177 und S. 370 behaupte ich, daß Zeus seinen
Vater Kronos entmannt und ihn vom Throne stürzt. Diesen Greuel
habe ich aber irrtümlich um eine Generation vorgeschoben; die
griechische Mythologie läßt ihn von Kronos an seinem Vater
Uranos verüben."
Wie ist es nun zu erklären, daß mein Gedächtnis in diesen
Punkten Ungetreues lieferte, während es mir sonst, wie sich
Leser des Buches überzeugen können, das entlegenste und unge-
bräuchlichste Material zur Verfügung stellte? Und ferner, daß
ich bei drei sorgfältig durchgeführten Korrekturen wie mit
Blindheit geschlagen an diesen Irrtümern vorbeiging?
Goethe hat von Lichtenberg gesagt: Wo er einen Spaß
macht, liegt ein Problem verborgen. Ähnlich kann man über die
hier angeführten Stellen meines Buches behaupten: Wo ein Irrtum
1) Kein voller Irrtum! Die orphische Version des Mythus ließ die Entmannung
an Kronos von seinem Sohne Zeus wiederholt werden. (Roscher, Lexikon der
Mythologie.)
16"
S.
Zur Psychopathologie des Alltagslebens
244
vorliegt, da steckt eine Verdrängung dahinter. Richtiger gesagt:
eine Unaufrichtigkeit, eine Entstellung, die schließlich auf Ver-
drängtem fußt. Ich bin bei der Analyse der dort mitgeteilten
Träume durch die bloße Natur der Themata, auf welche sich
die Traumgedanken beziehen, genötigt gewesen, einerseits die
Analyse irgendwo vor ihrer Abrundung abzubrechen, anderseits
einer indiskreten Einzelheit durch leise Entstellung die Schärfe zu
benehmen. Ich konnte nicht anders und hatte auch keine andere
Wahl, wenn ich überhaupt Beispiele und Belege vorbringen
wollte; meine Zwangslage leitete sich mit Notwendigkeit aus
der Eigenschaft der Träume ab, Verdrängtem, d. h. Bewußtseins-
unfähigem Ausdruck zu geben. Es dürfte trotzdem genug übrig
geblieben sein, woran empfindlichere Seelen Anstoß genommen
haben. Die Entstellung oder Verschweigung der mir selbst noch
bekannten fortsetzenden Gedanken hat sich nun nicht spurlos
durchführen lassen. Was ich unterdrücken wollte, hat sich oftmals
wider meinen Willen den Zugang in das von mir Aufgenommene
erkämpft und ist darin als von mir unbemerkter Irrtum zum
Vorschein gekommen. In allen drei hervorgehobenen Beispielen
liegt übrigens das nämliche Thema zugrunde; die Irrtümer sind
Abkömmlinge verdrängter Gedanken, die sich mit meinem ver-
storbenen Vater beschäftigen.
ad 1) Wer den auf S. 266 analysierten Traum durchliest, wird
teils unverhüllt erfahren, teils aus Andeutungen erraten können,
daß ich bei Gedanken abgebrochen habe, die eine unfreundliche
Kritik am Vater enthalten hätten. In der Fortsetzung dieses
Zuges von Gedanken und Erinnerungen liegt nun eine ärgerliche
Geschichte, in welcher Bücher eine Rolle spielen, und ein
Geschäftsfreund des Vaters, der den Namen Marburg führt,
denselben Namen, durch dessen Ausruf in der gleichnamigen Süd-
bahnstation ich aus dem Schlafe geweckt wurde. Diesen Herrn
Marburg wollte ich bei der Analyse mir und den Lesern unter-
schlagen; er rächte sich dadurch, daß er sich dort einmengte, wo
S.
X. Irrtümer
245
er nicht hingehört, und den Namen des Geburtsortes Schillers
aus Marbach in Marburg veränderte.
ad 2) Der Irrtum Hasdrubal anstatt Hamilkar, der Name
des Bruders an Stelle des Namens des Vaters, ereignete sich
gerade in einem Zusammenhange, der von den Hannibalphantasien
meiner Gymnasiastenjahre und von meiner Unzufriedenheit mit
dem Benehmen des Vaters gegen die „Feinde unseres Volkes"
handelt. Ich hätte fortsetzen und erzählen können, wie mein
Verhältnis zum Vater durch einen Besuch in England verändert
wurde, der mich die Bekanntschaft meines dort lebenden Halb-
bruders aus früherer Ehe des Vaters machen ließ. Mein Bruder
hat einen ältesten Sohn, der mir gleichaltrig ist; die Phantasien,
wie anders es geworden wäre, wenn ich nicht als Sohn des
Vaters, sondern des Bruders zur Welt gekommen wäre, fanden
also kein Hindernis an den Altersrelationen. Diese unterdrückten
Phantasien fälschten nun an der Stelle, wo ich in der Analyse
abbrach, den Text meines Buches, indem sie mich nötigten, den
Namen des Bruders für den des Vaters zu setzen.
ad 3) Dem Einfluß der Erinnerung an diesen selben Bruder
schreibe ich es zu, daß ich die mythologischen Greuel der
griechischen Götterwelt um eine Generation vorgeschoben habe.
Von den Mahnungen des Bruders ist mir lange Zeit eine im
Gedächtnis geblieben: „Vergiß nicht in Bezug auf Lebensführung
eines," hatte er mir gesagt, daß du nicht der zweiten, sondern
eigentlich der dritten Generation vom Vater aus angehörst."
Unser Vater hatte sich in späteren Jahren wieder verheiratet und
war so um vieles älter als seine Kinder zweiter Ehe. Ich begehe
den besprochenen Irrtum im Buche gerade dort, wo ich von der
Pietät zwischen Eltern und Kindern handle.
Es ist auch einigemal vorgekommen, daß Freunde und Patienten,
deren Träume ich berichtete, oder auf die ich in den Traum-
analysen anspielte, mich aufmerksam machten, die Umstände der
gemeinsam erlebten Begebenheiten seien von mir ungenau erzählt
S.
Zur Psychopathologie des Alltagslebens
246
worden. Das wären nun wiederum historische Irrtümer. Ich habe
die einzelnen Fälle nach der Richtigstellung nachgeprüft und mich
gleichfalls überzeugt, daß meine Erinnerung des Sachlichen nur
dort ungetreu war, wo ich in der Analyse etwas mit Absicht
entstellt oder verhehlt hatte. Auch hier wieder ein unbe-
merkter Irrtum als Ersatz für eine absichtliche
Verschweigung oder Verdrängung.
Von diesen Irrtümern, die der Verdrängung entspringen, heben
sich scharf andere ab, die auf wirklicher Unwissenheit beruhen.
So war es z. B. Unwissenheit, wenn ich auf einem Ausflug in
die Wachau den Aufenthalt des Revolutionärs Fischhof
berührt zu haben glaubte. Die beiden Orte haben nur den Namen
gemein; das Emmersdorf Fischhofs liegt in Kärnten. Ich
wußte es aber nicht anders.
4) Noch ein beschämender und lehrreicher Irrtum, ein Beispiel
von temporärer Ignoranz, wenn man so sagen darf. Ein Patient
mahnte mich eines Tages, ihm die zwei versprochenen Bücher
über Venedig mitzugeben, aus denen er sich für seine Osterreise
vorbereiten wollte. Ich habe sie bereit gelegt, erwiderte ich, und
ging in das Bibliothekszimmer, um sie zu holen. In Wahrheit
hatte ich aber vergessen, sie herauszusuchen, denn ich war mit
der Reise meines Patienten, in der ich eine unnötige Störung
der Behandlung und eine materielle Schädigung des Arztes erblickte,
nicht recht einverstanden. Ich halte also in der Bibliothek rasche
Umschau nach den beiden Büchern, die ich ins Auge gefaßt hatte.
"Venedig als Kunststätte" ist das eine; außerdem aber muß ich
noch ein historisches Werk in einer ähnlichen Sammlung besitzen.
Richtig, da ist es: „Die Mediceer", ich nehme es und bringe es
dem Wartenden, um dann beschämt den Irrtum einzugestehen.
Ich weiß doch wirklich, daß die Medici nichts mit Venedig zu
tun haben, aber es erschien mir für eine kurze Weile gar nicht
unrichtig. Nun muß ich Gerechtigkeit üben; da ich dem Patienten
so häufig seine eigenen Symptomhandlungen vorgehalten habe,
S.
X. Irrtümer
247
kann ich meine Autorität vor ihm nur retten, wenn ich ehrlich
werde und ihm die geheim gehaltenen Motive meiner Abneigung
gegen seine Reise kundgebe.
Man darf ganz allgemein erstaunt sein, daß der Wahrheitsdrang
der Menschen soviel stärker ist, als man ihn für gewöhnlich
einschätzt. Vielleicht ist es übrigens eine Folge meiner Beschäftigung
mit der Psychoanalyse, daß ich kaum mehr lügen kann. So oft
ich eine Entstellung versuche, unterliege ich einer Irrung oder
anderen Fehlleistung, durch die sich meine Unaufrichtigkeit wie
in diesem und den vorstehenden Beispielen verrät.
Der Mechanismus des Irrtums scheint der lockerste unter allen.
Fehlleistungen, das heißt das Vorkommen des Irrtums zeigt ganz
allgemein an, daß die betreffende seelische Tätigkeit mit irgend
einem störenden Einfluß zu kämpfen hatte, ohne daß die Art des
Irrtums durch die Qualität der im Dunkeln gebliebenen störenden
Idee determiniert wäre. Wir tragen indes an dieser Stelle nach,
daß bei vielen einfachen Fällen von Versprechen und Verschreiben
derselbe Tatbestand anzunehmen ist. Jedesmal, wenn wir uns
versprechen oder verschreiben, dürfen wir eine Störung durch
seelische Vorgänge außerhalb der Intention erschließen, aber es
ist zuzugeben, daß das Versprechen und Verschreiben oftmals den
Gesetzen der Ähnlichkeit, der Bequemlichkeit oder der Neigung
zur Beschleunigung folgt, ohne daß es dem Störenden gelungen
wäre, ein Stück seines eigenen Charakters in dem beim
Versprechen oder Verschreiben resultierenden Fehler durch-
zusetzen. Das Entgegenkommen des sprachlichen Materials ermöglicht
erst die Determinierung des Fehlers und setzt derselben auch die
Grenze.
Um nicht ausschließlich eigene Irrtümer anzuführen, will ich
noch einige Beispiele mitteilen, die allerdings ebensowohl beim
Versprechen und Vergreifen hätten eingereiht werden können,
was aber bei der Gleichwertigkeit all dieser Weisen von Fehl-
leistung bedeutungslos zu nennen ist.
S.
Zur Psychopathologie des Alltagslebens
248
5) Ich habe einem Patienten untersagt, die Geliebte, mit der
er selbst brechen möchte, telephonisch anzurufen, da jedes Gespräch
den Abgewöhnungskampf von neuem entfacht. Er soll ihr seine
letzte Meinung schreiben, wiewohl es Schwierigkeiten hat, ihr
Briefe zuzustellen. Er besucht mich nun um 1 Uhr, um mir zu
sagen, daß er einen Weg gefunden hat, der diese Schwierigkeiten
umgeht, fragt auch unter anderem, ob er sich auf meine ärztliche
Autorität berufen darf. Um 2 Uhr ist er mit der Abfassung des
Absagebriefes beschäftigt, unterbricht sich plötzlich, sagt der dabei
anwesenden Mutter: Jetzt habe ich vergessen, den Professor zu
fragen, ob ich in dem Briefe seinen Namen nennen darf, eilt zum
Telephon, läßt sich verbinden und ruft die Frage ins Rohr: Bitte,
ist der Herr Professor schon nach dem Speisen zu sprechen? Als
Antwort tönt ihm ein erstauntes ,,Adolf, bist du verrückt
geworden?" entgegen, und zwar von der nämlichen Stimme, die
er nach meinem Gebote nicht mehr hätte hören sollen. Er hatte
sich bloẞ „geirrt" und anstatt der Nummer des Arztes die der
Geliebten angegeben.
6) Eine junge Dame soll einen Besuch bei einer kürzlich
verheirateten Freundin in der Habsburger gasse machen. Sie
spricht davon während des Familientisches, sagt aber irrtümlicher-
weise, sie müsse in die Babenbergergasse gehen. Andere bei
Tische Anwesende machen sie lachend auf den von ihr nicht.
bemerkten Irrtum oder Versprechen, wenn man so lieber will
aufmerksam. Zwei Tage vorher ist nämlich in Wien die
Republik ausgerufen worden, das Schwarzgelb ist verschwunden
und hat den Farben der alten Ostmark: rot-weiß-rot Platz
gemacht, die Habsburger sind abgetan; die Sprecherin hat diese
Ersetzung in die Adresse der Freundin eingetragen. Es gibt übrigens
in Wien eine sehr bekannte Babenbergerstraße, aber kein Wiener
würde von ihr als „Gasse" reden.
7) In einer Sommerfrische hat der Schullehrer, ein ganz armer,
aber stattlicher junger Mann, der Tochter eines Villenbesitzers
S.
X. Irrtümer
249
aus der Großstadt so lange den Hof gemacht, bis das Mädchen
sich leidenschaftlich in ihn verliebt und auch ihre Familie
bewogen hat, die Heirat trotz der bestehenden Standes- und Rassen-
unterschiede gutzuheißen. Da schreibt der Lehrer eines Tages
seinem Bruder einen Brief, in dem es heißt: „Schön ist das Dirndl
ja gar nicht, aber recht lieb und soweit wär's gut. Ob ich mich
aber werd' entschließen können, eine Jüdin zu heiraten, das kann.
ich dir noch nicht sagen". Dieser Brief gerät in die Hände der
Braut und macht dem Verlöbnis ein Ende, während der Bruder
sich gleichzeitig über die an ihn gerichteten Liebesbeteuerungen
zu verwundern hat. Mein Gewährsmann versicherte mir, daß hier
Irrtum und nicht eine schlaue Veranstaltung vorlag. Mir ist auch
ein anderer Fall bekannt geworden, in dem eine Dame, die, mit
ihrem alten Arzt unzufrieden, ihm doch nicht offen absagen
wollte, diesen Zweck mittels einer Briefverwechslung erreichte, und
wenigstens hier kann ich dafür einstehen, daß der Irrtum und nicht
die bewußte List sich des bekannten Lustspielmotivs bedient hat.
8) Brill erzählt von einer Dame, die sich bei ihm nach
dem Befinden einer gemeinsamen Bekannten erkundigte, wobei
sie dieselbe irrtümlich bei ihrem Mädchennamen nannte. Auf-
merksam gemacht, mußte sie zugestehen, daß sie den Mann
dieser Dame nicht möge und mit der Heirat derselben sehr
unzufrieden gewesen sei.
9) Ein Fall von Irrtum, der auch als „Versprechen" beschrieben
werden kann: Ein junger Vater begibt sich zum Standesbeamten,
um seine zweitgeborene Tochter anzumelden. Befragt, wie das
Kind heißen soll, antwortete er: Hanna, muß sich aber von dem
Beamten sagen lassen: Sie haben ja schon ein Kind dieses Namens.
Wir werden den Schluß ziehen, daß diese zweite Tochter nicht
so ganz willkommen war wie seinerzeit die erste.
10) Ich füge hier einige andere Beobachtungen von Namen-
verwechslungen an, die natürlich mit ebensoviel Recht in anderen
Abschnitten dieses Buches untergebracht worden wären.
S.
Zur Psychopathologie des Alltagslebens
250
Eine Dame ist Mutter von drei Töchtern, von denen zwei
längst verheiratet sind, während die jüngste noch ihr Schicksal
erwartet. Eine befreundete Dame hat bei den beiden Hochzeiten
das nämliche Geschenk gemacht, eine kostbare silberne Teegarnitur.
So oft nun von diesem Gerät die Sprache ist, nennt die Mutter
irrtümlicherweise die dritte Tochter als Besitzerin. Es ist offenbar,
daß dieser Irrtum den Wunsch der Mutter ausspricht, auch die
letzte Tochter verheiratet zu wissen. Sie setzt dabei voraus, daß
sie dasselbe Hochzeitsgeschenk erhalten würde.
Ebenso leicht deutbar sind die häufigen Fälle, in denen eine
Mutter die Namen ihrer Töchter, Söhne oder Schwiegersöhne
verwechselt.
11) Ein hübsches Beispiel von hartnäckiger Namensvertauschung,
das sich leicht erklärt, entnehme ich der Selbstbeobachtung eines
Herrn J. G. während seines Aufenthaltes in einer Heilanstalt:
An der Table d'hôte (des Sanatoriums) gebrauche ich im
Laufe eines mich wenig interessierenden und in ganz konven-
tionellem Ton geführten Gespräches mit meiner Tischnachbarin
eine Phrase von besonderer Liebenswürdigkeit. Das etwas ältliche
Mädchen konnte nicht umhin zu bemerken, daß es
sonst nicht
meine Art sei, ihr gegenüber so liebenswürdig und galant zu
sein eine Entgegnung, die einerseits ein gewisses Bedauern
und mehr noch eine deutliche Spitze gegen ein uns beiden
bekanntes Fräulein enthielt, dem ich größere Aufmerksamkeit zu
schenken pflegte. Ich verstehe natürlich augenblicklich. Im Laufe
unseres weiteren Gespräches muß ich mich nun, was mir ungemein
peinlich ist, von meiner Nachbarin wiederholt darauf aufmerksam
machen lassen, daß ich sie mit dem Namen jenes Fräuleins
angesprochen habe, das sie nicht mit Unrecht als ihre glücklichere
Nebenbuhlerin ansah.".
12) Als Irrtum" will ich auch eine Begebenheit mit ernst-
haftem Hintergrund erzählen, die mir von einem nahe beteiligten
Zeugen berichtet wurde. Eine Dame hat den Abend mit ihrem
S.
X. Irrtümer
251
Manne und in Gesellschaft von zwei Fremden im Freien zugebracht.
Einer dieser beiden Fremden ist ihr intimer Freund, wovon aber
die anderen nichts wissen und nichts wissen dürfen. Die Freunde
begleiten das Ehepaar bis vor die Haustür. Während man auf
das Öffnen der Tür wartet, wird Abschied genommen. Die Dame
verneigt sich gegen den Fremden, reicht ihm die Hand und
spricht einige verbindliche Worte. Dann greift sie nach dem Arm
ihres heimlich Geliebten, wendet sich zu ihrem Manne und will
ihn in gleicher Weise verabschieden. Der Mann geht auf die
Situation ein, zieht den Hut und sagt überhöflich: Küss' die Hand,
gnädige Frau. Die erschrockene Frau läßt den Arm des Geliebten
fahren und hat noch Zeit, ehe der Hausmeister erscheint, zu
seufzen: Nein, so etwas soll einem passieren! Der Mann gehörte
zu jenen Eheherren, die eine Untreue ihrer Frau außerhalb jeder
Möglichkeit verlegen wollen. Er hatte wiederholt geschworen, in
einem solchen Falle würde mehr als ein Leben in Gefahr sein.
Er hatte also die stärksten inneren Abhaltungen, um die Heraus-
forderung, die in dieser Irrung lag, zu bemerken.
13) Eine Irrung eines meiner Patienten, die durch eine Wieder-
holung zum Gegensinn besonders lehrreich wird: Der überbedenkliche
junge Mann hat sich nach langwierigen inneren Kämpfen dazu
gebracht, dem Mädchen, das ihn seit langem liebt wie er sie,
die Zusage der Ehe zu geben. Er begleitet die ihm Verlobte
nach Hause, verabschiedet sich von ihr, steigt überglücklich in
einen Tramway wagen und verlangt von der Schaffnerin zwei
Fahrkarten. Etwa ein halbes Jahr später ist er bereits verheiratet,
kann sich aber noch nicht recht in sein Eheglück finden. Er
zweifelt, ob er recht getan hat zu heiraten, vermißt frühere
freundschaftliche Beziehungen, hat an den Schwiegereltern allerlei
auszusetzen. Eines Abends holt er seine junge Frau vom Hause
ihrer Eltern ab, steigt mit ihr in den Wagen der Straßenbahn
und begnügt sich damit, der Schaffnerin eine einzige Karte
abzuverlangen.
S.
Zur Psychopathologie des Alltagslebens
252
14) Wie man einen ungern unterdrückten Wunsch vermittels
eines,,Irrtums" befriedigen kann, davon erzählt Maeder ein hübsches
Beispiel. Ein Kollege möchte einen dienstfreien Tag so recht ungestört
genießen; er soll aber einen Besuch in Luzern machen, auf den
er sich nicht freuen kann, und beschließt nach längerer Über-
legung, doch hinzufahren. Um sich zu zerstreuen, liest er auf
der Fahrt Zürich-Arth-Goldau die Tageszeitungen, wechselt in
letzterer Station den Zug und setzt seine Lektüre fort. In der
Fortsetzung der Fahrt entdeckt ihm dann der kontrollierende
Schaffner, daß er in einen falschen Zug eingestiegen ist, nämlich
in den, der von Goldau nach Zürich zurückfährt, während er ein
Billett nach Luzern genommen hatte. (Nouvelles contributions etc.,
Arch. de Psych., VI, 1908).
15) Einen analogen, wenngleich nicht voll geglückten Versuch,
einem unterdrückten Wunsch durch den nämlichen Mechanismus
der Irrung zum Ausdruck zu verhelfen, berichtet Dr. V. Tausk
unter der Überschrift „Falsche Fahrtrichtung":
„Ich war aus dem Felde auf Urlaub nach Wien gekommen.
Ein alter Patient hatter von meiner Anwesenheit Kenntnis
bekommen und ließ mich bitten, daß ich ihn besuche, da er krank
zu Bette lag. Ich leistete der Bitte Folge und verbrachte zwei
Stunden bei ihm. Beim Abschied fragte der Kranke, was er schuldig
sei.,Ich bin auf Urlaub hier und ordiniere jetzt nicht,' antwortete
ich. Nehmen Sie meinen Besuch als einen Freundschaftsdienst."
Der Kranke stutzte, da er wohl das Empfinden hatte, er habe
kein Recht, eine berufliche Leistung als unentgeltlichen Freund-
schaftsdienst in Anspruch zu nehmen. Aber er ließ sich meine
Antwort schließlich gefallen, in der von der Lust an der Geld-
ersparung diktierten respektvollen Meinung, daß ich als Psycho-
analytiker sicher richtig handeln werde. Mir selbst stiegen schon
wenige Augenblicke später Bedenken über die Aufrichtigkeit meiner
Noblesse auf, und, von Zweifeln die kaum eine zweideutige
Lösung zuließen erfüllt, bestieg ich die elektrische Straßenbahn-
S.
X. Irrtümer
253
linie X. Nach einer kurzen Fahrt hatte ich auf die Linie Y um-
zusteigen. Während ich an der Umsteigestelle wartete, vergaß ich
die Honorarangelegenheit und beschäftigte mich mit den Krankheits-
symptomen meines Patienten. Indem kam der von mir erwartete
Wagen und ich stieg ein. Aber bei der nächsten Haltestelle mußte
ich wieder aussteigen. Ich war nämlich statt in einem Y-Wagen
versehentlich und ohne es zu merken in einen X-Wagen einge-
stiegen und fuhr in der Richtung, aus der ich eben gekommen
war, wieder zurück, in der Richtung zum Patienten, von dem
ich kein Honorar annehmen wollte. Mein Unbewußtes aber
wollte sich das Honorar holen." (Internat. Zeitschrift f.
Psychoanalyse IV, 1916/17.)
16) Ein sehr ähnliches Kunststück wie im Beispiel 14. ist mir
selbst einmal gelungen. Ich hatte meinem gestrengen ältesten
Bruder zugesagt, ihm in diesem Sommer den längst fälligen Besuch
in einem englischen Seebad abzustatten, und dabei die Verpflichtung
übernommen, da die Zeit drängte, auf dem kürzesten Wege ohne,
Aufenthalt zu reisen. Ich bat um einen Tag Aufschub für Holland,
aber er meinte, das könnte ich für die Rückreise aufsparen. Ich
fuhr also von München über Köln nach Rotterdam-Hook of
Holland, von wo das Schiff um Mitternacht nach Harwich über-
setzt. In Köln hatte ich Wagenwechsel; ich verließ meinen Zug,
um in den Eilzug nach Rotterdam umzusteigen, aber der war
nicht zu entdecken. Ich fragte verschiedene Bahnbedienstete, wurde
von einem Bahnsteig auf den anderen geschickt, geriet in eine
übertriebene Verzweiflung und konnte mir bald berechnen, daß
ich während dieses erfolglosen Suchens den Anschluß versäumt
haben dürfte. Nachdem mir dieses bestätigt worden war, über-
legte ich, ob ich in Köln übernachten sollte, wofür unter anderem
auch die Pietät sprach, da nach einer alten Familientradition
meine Ahnen einst bei einer Judenverfolgung aus dieser Stadt.
geflüchtet waren. Ich entschloß mich aber anders, fuhr mit einem
späteren Zug nach Rotterdam, wo ich in tiefer Nachtzeit ankam,
S.
Zur Psychopathologie des Alltagslebens
254
und war nun genötigt, einen Tag in Holland zuzubringen. Dieser
Tag brachte mir die Erfüllung eines längst gehegten Wunsches;
ich konnte die herrlichen Rembrandtbilder im Haag und im
Reichsmuseum zu Amsterdam sehen. Erst am nächsten Vormittag,
als ich während der Eisenbahnfahrt in England meine Eindrücke
sammeln konnte, tauchte mir die unzweifelhafte Erinnerung auf,
daß ich auf dem Bahnhofe in Köln wenige Schritte von der Stelle,
wo ich ausgestiegen war, auf dem nämlichen Bahnsteig eine große
Tafel Rotterdam-Hook of Holland gesehen hatte. Dort wartete
der Zug, in dem ich die Reise hätte fortsetzen sollen. Man müßte
als unbegreifliche Verblendung" bezeichnen, daß ich trotz
dieser guten Anleitung weggeeilt und den Zug anderswo gesucht
hatte, wenn man nicht annehmen wollte, daß es eben mein
Vorsatz war, gegen die Vorschrift meines Bruders die Rembrandt-
bilder schon auf der Hinreise zu bewundern. Alles übrige, meine
gut gespielte Ratlosigkeit, das Auftauchen der pietätvollen Absicht,
in Köln zu übernachten, war nur Veranstaltung, um mir meinen
Vorsatz zu verbergen, bis er sich vollkommen durchgesetzt hatte.
17) Eine ebensolche, durch „Vergeßlichkeit" hergestellte Veran-
staltung, um einen Wunsch zu erfüllen, auf den man angeblich
verzichtet hat, berichtet J. Stärcke von seiner eigenen Person. (L. c.)
,,Ich mußte einmal in einem Dorfe einen Vortrag mit Licht-
bildern halten. Dieser Vortrag war aber um eine Woche verschoben.
Ich hatte den Brief hinsichtlich dieses Aufschubes beantwortet und
das geänderte Datum in meinem Notizbuch notiert. Ich wäre gern
schon nachmittags nach diesem Dorfe gegangen, damit ich die
Zeit hätte, um einem mir bekannten Schriftsteller, der dort wohnt,
einen Besuch abzustatten. Zu meinem Bedauern konnte ich aber
zurzeit keinen Nachmittag dafür frei machen. Nur ungern gab ich
diesen Besuch auf.
es
Als nun der Abend des Vortrages da war, machte ich mich,
mit einer Tasche voll Laternenbilder, in größter Eile zum Bahn-
hof auf. Ich mußte einen Taxi nehmen, um den Zug noch zu
S.
X. Irrtümer
255
erreichen (es passiert mir öfters, daß ich so lange zögere, daß ich
einen Taxi nehmen muß, um den Zug noch zu erreichen!). An
Ort und Stelle gekommen, war ich einigermaßen erstaunt, daß
keiner am Bahnhof war, um mich abzuholen (wie es bei Vorträgen
in kleineren Orten Gewohnheit ist). Plötzlich fiel mir ein, daß
der Vortrag um eine Woche verschoben war, und daß ich jetzt
am ursprünglich festgestellten Datum eine vergebliche Reise
gemacht hatte. Nachdem ich meine Vergeßlichkeit herzinnig
verwünscht hatte, überlegte ich, ob ich mit dem nächstfolgenden
Zug wieder nach Hause zurückkehren sollte. Bei näherer Über-
legung dachte ich aber daran, daß ich jetzt eine schöne Gelegen-
heit hatte, um den gewünschten Besuch zu machen, was ich denn
auch tat. Erst unterwegs fiel mir ein, daß mein unerfüllter Wunsch,
für diesen Besuch gehörig Zeit zu haben, das Komplott hübsch
vorbereitet hatte. Das Schleppen mit der schweren Tasche voll
Laternenbilder und das Eilen, um den Zug zu erreichen, konnten
ausgezeichnet dazu dienen, die unbewußte Absicht desto besser zu
verbergen."
Man wird vielleicht nicht geneigt sein, die Klasse von Irrtümern,
für die ich hier die Aufklärung gebe, für sehr zahlreich oder
besonders bedeutungsvoll zu halten. Ich gebe aber zu bedenken,
ob man nicht Grund hat, die gleichen Gesichtspunkte auch auf
die Beurteilung der ungleich wichtigeren Urteilsirrtümer
der Menschen im Leben und in der Wissenschaft auszudehnen.
Nur den auserlesensten und ausgeglichensten Geistern scheint es
möglich zu sein, das Bild der wahrgenommenen äußeren Realität.
vor der Verzerrung zu bewahren, die es sonst beim Durchgang
durch die psychische Individualität des Wahrnehmenden erfährt.
freudgs4
242
–255