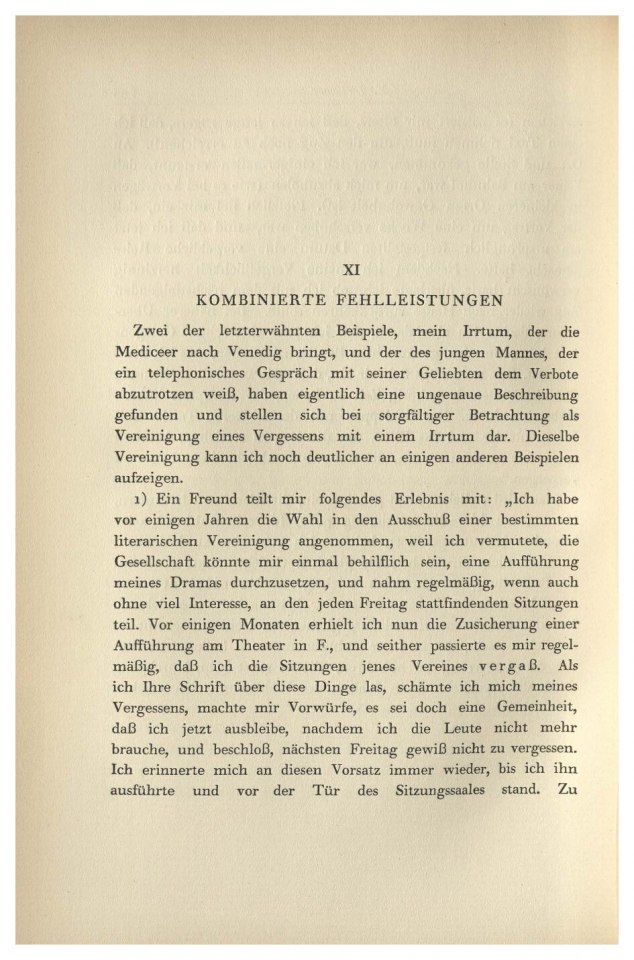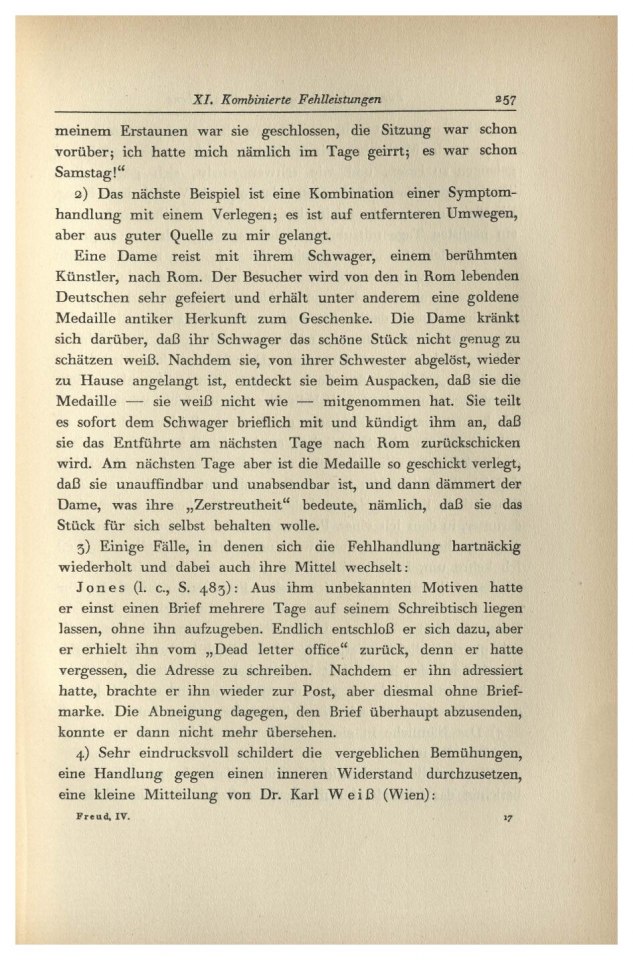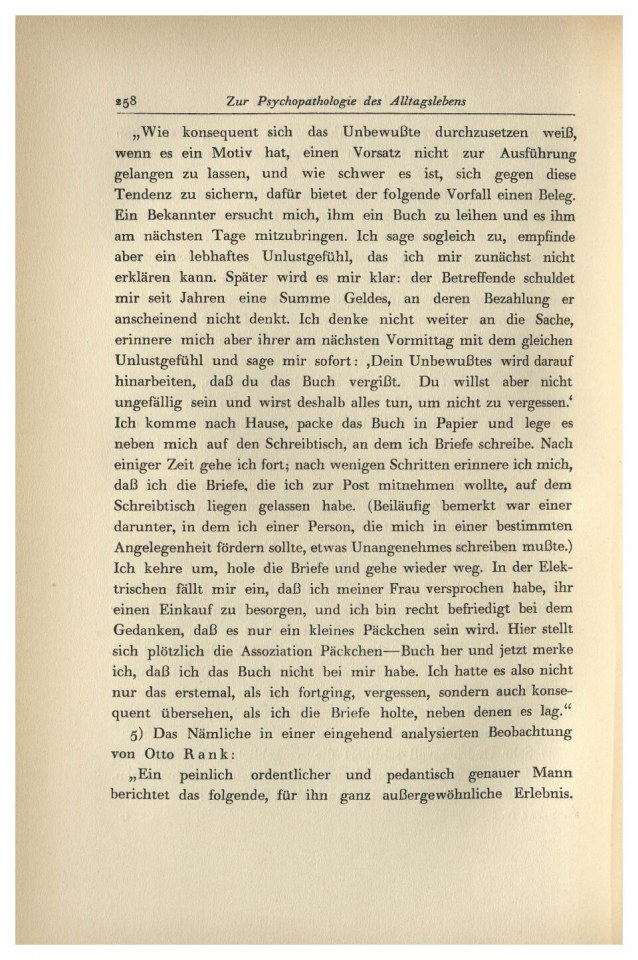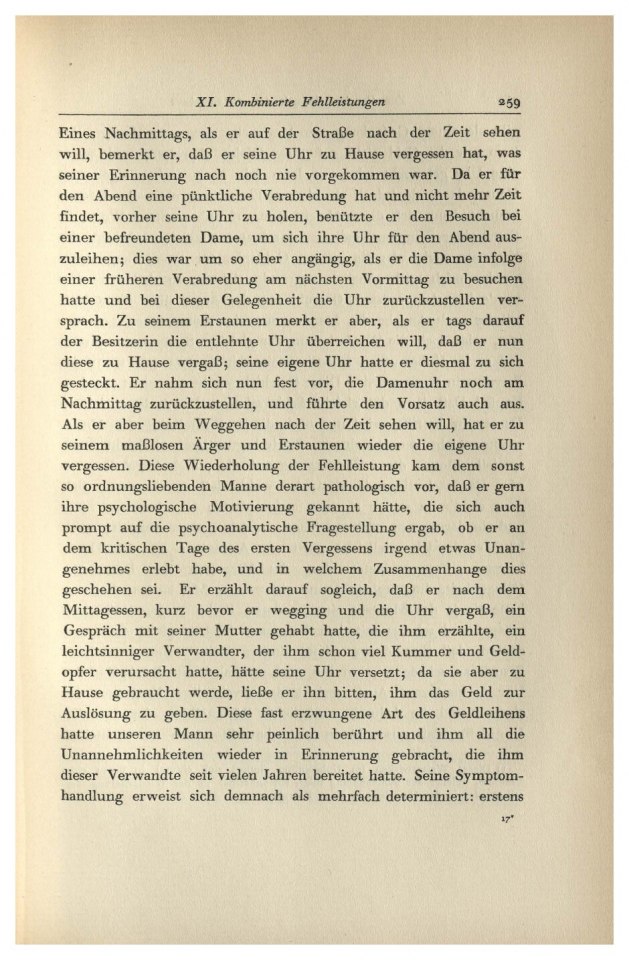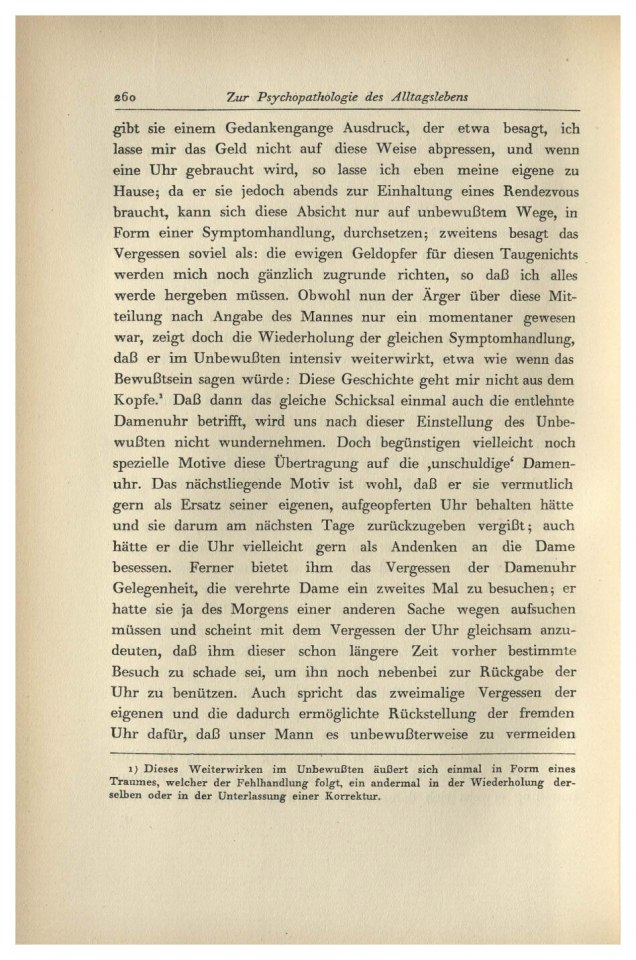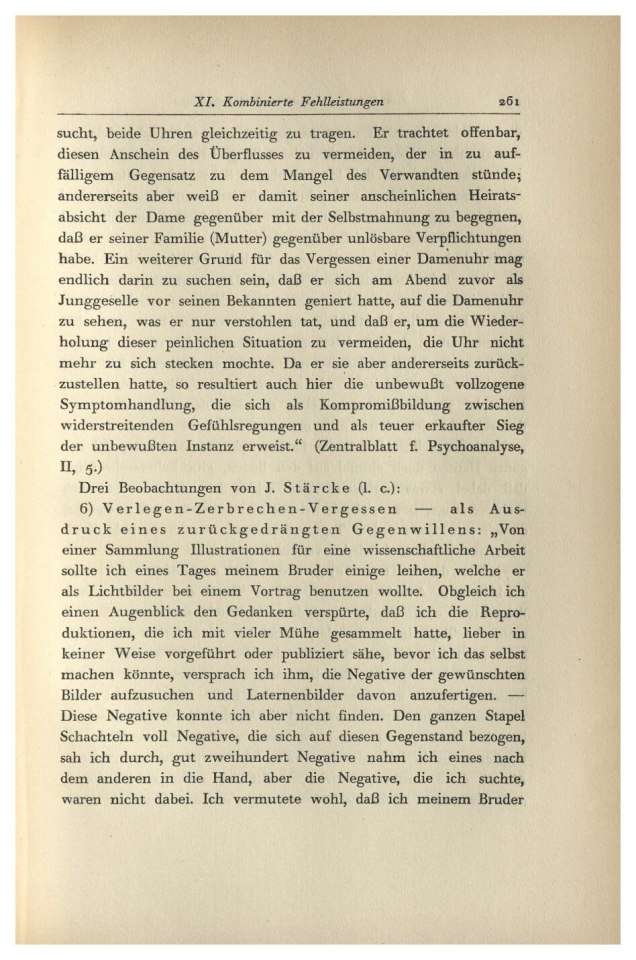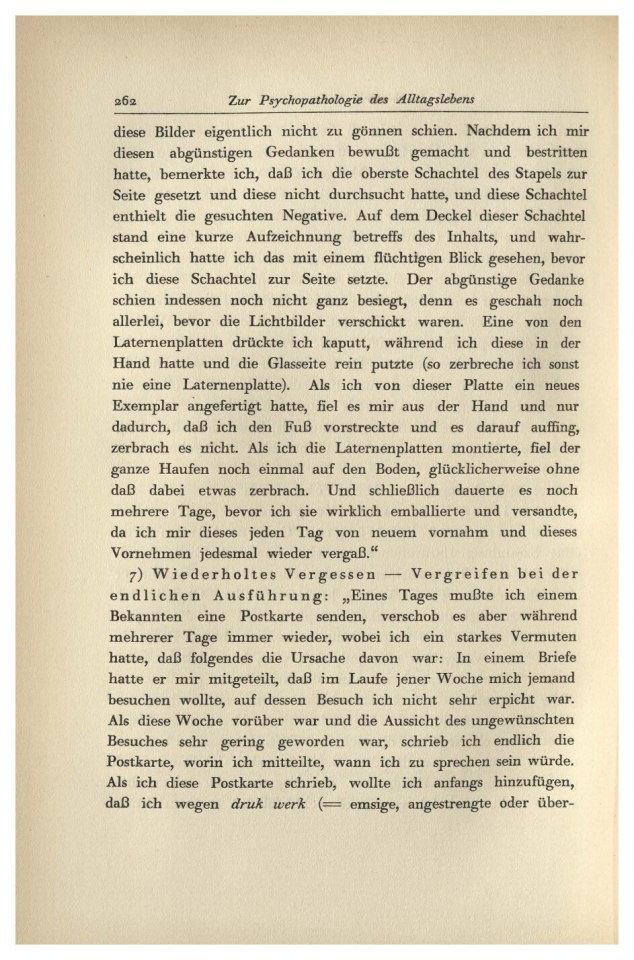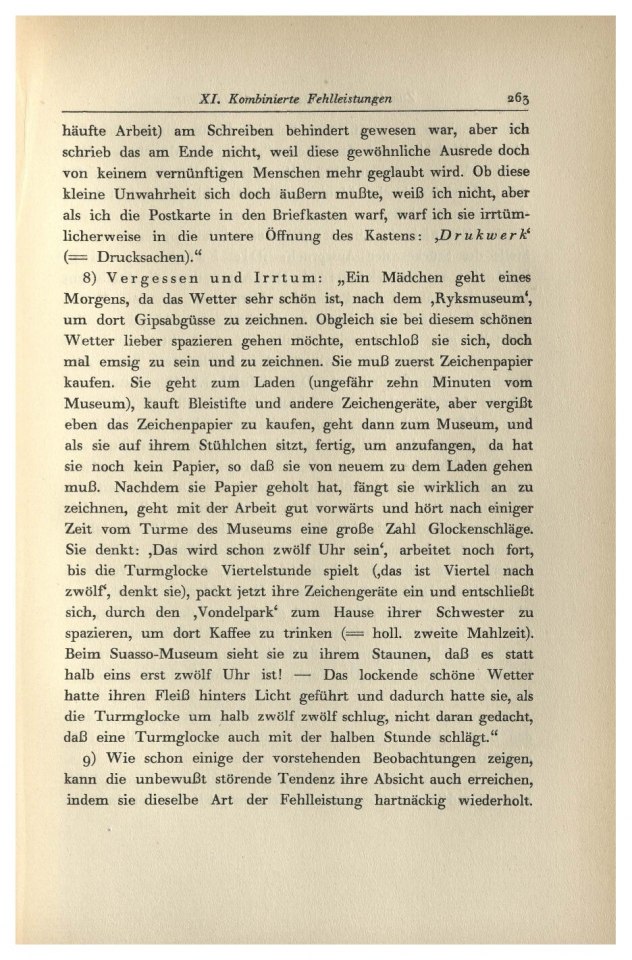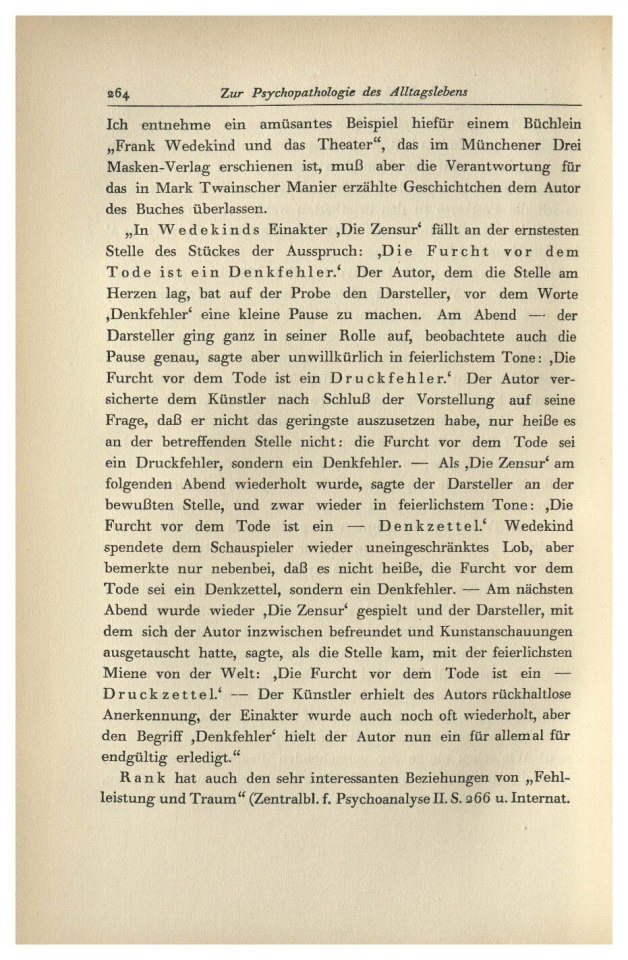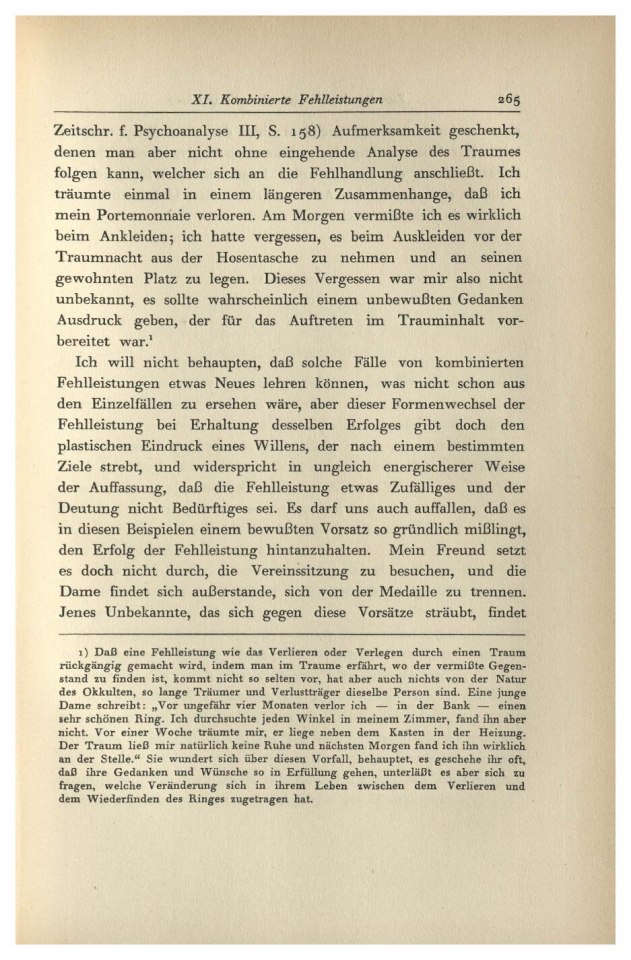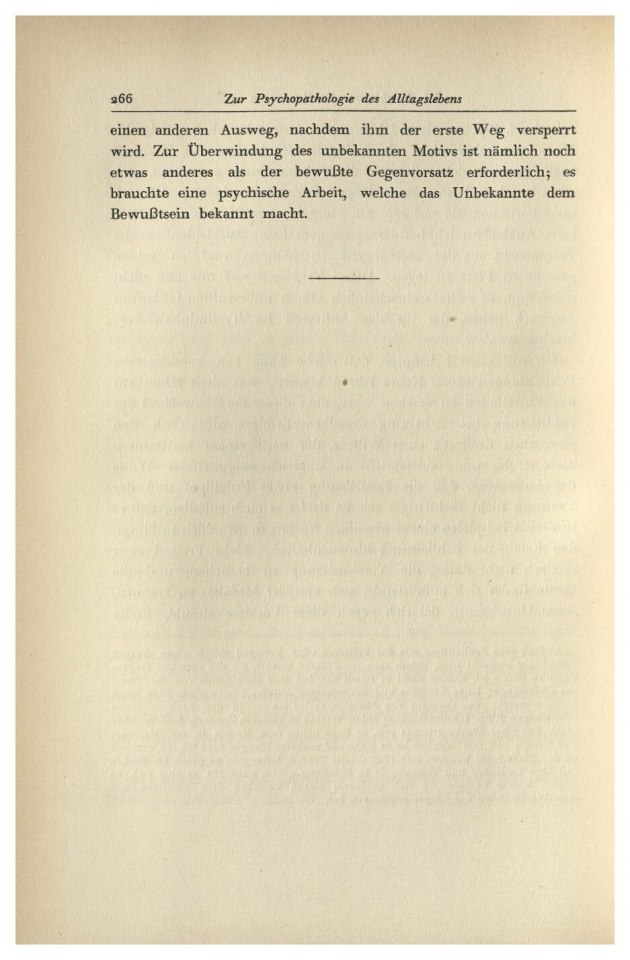S.
[256]
XI
KOMBINIERTE FEHLLEISTUNGEN
Zwei der letzterwähnten Beispiele, mein Irrtum, der die
Mediceer nach Venedig bringt, und der des jungen Mannes, der
ein telephonisches Gespräch mit seiner Geliebten dem Verbote
abzutrotzen weiß, haben eigentlich eine ungenaue Beschreibung
gefunden und stellen sich bei sorgfältiger Betrachtung als
Vereinigung eines Vergessens mit einem Irrtum dar. Dieselbe
Vereinigung kann ich noch deutlicher an einigen anderen Beispielen
aufzeigen.1) Ein Freund teilt mir folgendes Erlebnis mit: „Ich habe
vor einigen Jahren die Wahl in den Ausschuß einer bestimmten
literarischen Vereinigung angenommen, weil ich vermutete, die
Gesellschaft könnte mir einmal behilflich sein, eine Aufführung
meines Dramas durchzusetzen, und nahm regelmäßig, wenn auch
ohne viel Interesse, an den jeden Freitag stattfindenden Sitzungen
teil. Vor einigen Monaten erhielt ich nun die Zusicherung einer
Aufführung am Theater in F., und seither passierte es mir regel-
mäßig, daß ich die Sitzungen jenes Vereines vergaß. Als
ich Ihre Schrift über diese Dinge las, schämte ich mich meines
Vergessens, machte mir Vorwürfe, es sei doch eine Gemeinheit,
daß ich jetzt ausbleibe, nachdem ich die Leute nicht mehr
brauche, und beschloß, nächsten Freitag gewiß nicht zu vergessen.
Ich erinnerte mich an diesen Vorsatz immer wieder, bis ich ihn
ausführte und vor der Tür des Sitzungssaales stand. ZuS.
257
meinem Erstaunen war sie geschlossen, die Sitzung war schon
vorüber; ich hatte mich nämlich im Tage geirrt; es war schon
Samstag!“2) Das nächste Beispiel ist eine Kombination einer Symptom-
handlung mit einem Verlegen; es ist auf entfernteren Umwegen,
aber aus guter Quelle zu mir gelangt.Eine Dame reist mit ihrem Schwager, einem berühmten
Künstler, nach Rom. Der Besucher wird von den in Rom lebenden
Deutschen sehr gefeiert und erhält unter anderem eine goldene
Medaille antiker Herkunft zum Geschenke. Die Dame kränkt
sich darüber, daß ihr Schwager das schöne Stück nicht genug zu
schätzen weiß. Nachdem sie, von ihrer Schwester abgelöst, wieder
zu Hause angelangt ist, entdeckt sie beim Auspacken, daß sie die
Medaille — sie weiß nicht wie — mitgenommen hat. Sie teilt
es sofort dem Schwager brieflich mit und kündigt ihm an, daß
sie das Entführte am nächsten Tage nach Rom zurückschicken
wird. Am nächsten Tage aber ist die Medaille so geschickt verlegt,
daß sie unauffindbar und unabsendbar ist, und dann dämmert der
Dame, was ihre „Zerstreutheit“ bedeute, nämlich, daß sie das
Stück für sich selbst behalten wolle.3) Einige Fälle, in denen sich die Fehlhandlung hartnäckig
wiederholt und dabei auch ihre Mittel wechselt:Jones (l. c., S. 483): Aus ihm unbekannten Motiven hatte
er einst einen Brief mehrere Tage auf seinem Schreibtisch liegen
lassen, ohne ihn aufzugeben. Endlich entschloß er sich dazu, aber
er erhielt ihn vom „Dead letter office“ zurück, denn er hatte
vergessen, die Adresse zu schreiben. Nachdem er ihn adressiert
hatte, brachte er ihn wieder zur Post, aber diesmal ohne Brief-
marke. Die Abneigung dagegen, den Brief überhaupt abzusenden,
konnte er dann nicht mehr übersehen.4.) Sehr eindrucksvoll schildert die vergeblichen Bemühungen,
eine Handlung gegen einen inneren Widerstand durchzusetzen,
eine kleine Mitteilung von Dr. Karl Weiß (Wien):S.
258
„Wie konsequent sich das Unbewußte durchzusetzen weiß,
wenn es ein Motiv hat, einen Vorsatz nicht zur Ausführung
gelangen zulassen, und wie schwer es ist, sich gegen diese
Tendenz zu sichern, dafür bietet der folgende Vorfall einen Beleg.
Ein Bekannter ersucht mich, ihm ein Buch zu leihen und es ihm
am nächsten Tage mitzubringen. Ich sage sogleich zu, empfinde
aber ein lebhaftes Unlustgefühl, das ich mir zunächst nicht
erklären kann. Später wird es mir klar: der Betreffende schuldet
mir seit Jahren eine Summe Geldes, an deren Bezahlung er
anscheinend nicht denkt. Ich denke nicht weiter an die Sache,
erinnere mich aber ihrer am nächsten Vormittag mit dem gleichen
Unlustgefühl und sage mir sofort: ‚Dein Unbewußtes wird darauf
hinarbeiten, daß du das Buch vergißt. Du willst aber nicht
ungefällig sein und wirst deshalb alles tun, um nicht zu vergessen.‘
Ich komme nach Hause, packe das Buch in Papier und lege es
neben mich auf den Schreibtisch, an dem ich Briefe schreibe. Nach
einiger Zeit gehe ich fort; nach wenigen Schritten erinnere ich mich,
daß ich die Briefe, die ich zur Post mitnehmen wollte, auf dem
Schreibtisch liegen gelassen habe. (Beiläufig bemerkt war einer
darunter, in dem ich einer Person, die mich in einer bestimmten
Angelegenheit fördern sollte, etwas Unangenehmes schreiben mußte.)
Ich kehre um, hole die Briefe und gehe wieder weg. In der Elek-
trischen fällt mir ein, daß ich meiner Frau versprochen habe, ihr
einen Einkauf zu besorgen, und ich bin recht befriedigt bei dem
Gedanken, daß es nur ein kleines Päckchen sein wird. Hier stellt
sich plötzlich die Assoziation Päckchen—Buch her und jetzt merke
ich, daß ich das Buch nicht bei mir habe. Ich hatte es also nicht
nur das erstemal, als ich fortging, vergessen, sondern auch konse-
quent übersehen, als ich die Briefe holte, neben denen es lag.“5) Das Nämliche in einer eingehend analysierten Beobachtung
von Otto Rank:„Ein peinlich ordentlicher und pedantisch genauer Mann
berichtet das folgende, für ihn ganz außergewöhnliche Erlebnis.S.
259
Eines Nachmittags, als er auf der Straße nach der Zeit sehen
will, bemerkt er, daß er seine Uhr zu Hause vergessen hat, was
seiner Erinnerung nach noch nie vorgekommen war. Da er für
den Abend eine pünktliche Verabredung hat und nicht mehr Zeit
findet, vorher seine Uhr zu holen, benützte er den Besuch bei
einer befreundeten Dame, um sich ihre Uhr für den Abend aus-
zuleihen; dies war um so eher angängig, als er die Dame infolge
einer früheren Verabredung am nächsten Vormittag zu besuchen
hatte und bei dieser Gelegenheit die Uhr zurückzustellen ver-
sprach. Zu seinem Erstaunen merkt er aber, als er tags darauf
der Besitzerin die entlehnte Uhr überreichen will, daß er nun
diese zu Hause vergaß; seine eigene Uhr hatte er diesmal zu sich
gesteckt. Er nahm sich nun fest vor, die Damenuhr noch am
Nachmittag zurückzustellen, und führte den Vorsatz auch aus.
Als er aber beim Weggehen nach der Zeit sehen will, hat er zu
seinem maßlosen Ärger und Erstaunen wieder die eigene Uhr
vergessen. Diese Wiederholung der Fehlleistung kam dem sonst
so ordnungsliebenden Manne derart pathologisch vor, daß er gern
ihre psychologische Motivierung gekannt hätte, die sich auch
prompt auf die psychoanalytische Fragestellung ergab, ob er an
dem kritischen Tage des ersten Vergessens irgend etwas Unan-
genehmes erlebt habe, und in welchem Zusammenhange dies
geschehen sei. Er erzählt darauf sogleich, daß er nach dem
Mittagessen, kurz bevor er wegging und die Uhr vergaß, ein
Gespräch mit seiner Mutter gehabt hatte, die ihm erzählte, ein
leichtsinniger Verwandter, der ihm schon viel Kummer und Geld-
opfer verursacht hatte, hätte seine Uhr versetzt; da sie aber zu
Hause gebraucht werde, ließe er ihn bitten, ihm das Geld zur
Auslösung zu geben. Diese fast erzwungene Art des Geldleihens
hatte unseren Mann sehr peinlich berührt und ihm all die
Unannehmlichkeiten wieder in Erinnerung gebracht, die ihm
dieser Verwandte seit vielen Jahren bereitet hatte. Seine Symptom-
handlung erweist sich demnach als mehrfach determiniert: erstensS.
260
gibt sie einem Gedankengange Ausdruck, der etwa besagt, ich
lasse mir das Geld nicht auf diese Weise abpressen, und wenn
eine Uhr gebraucht wird, so lasse ich eben meine eigene zu
Hause; da er sie jedoch abends zur Einhaltung eines Rendezvous
braucht, kann sich diese Absicht nur auf unbewußtem Wege, in
Form einer Symptomhandlung, durchsetzen; zweitens besagt das
Vergessen soviel als: die ewigen Geldopfer für diesen Taugenichts
werden mich noch gänzlich zugrunde richten, so daß ich alles
werde hergeben müssen. Obwohl nun der Ärger über diese Mit-
teilung nach Angabe des Mannes nur ein momentaner gewesen
war, zeigt doch die Wiederholung der gleichen Symptomhandlung,
daß er im Unbewußten intensiv weiterwirkt, etwa wie wenn das
Bewußtsein sagen würde: Diese Geschichte geht mir nicht aus dem
Kopfe.1 Daß dann das gleiche Schicksal einmal auch die entlehnte
Damenuhr betrifft, wird uns nach dieser Einstellung des Unbe-
wußten nicht wundernehmen. Doch begünstigen vielleicht noch
spezielle Motive diese Übertragung auf die ‚unschuldige‘ Damen-
uhr. Das nächstliegende Motiv ist wohl, daß er sie vermutlich
gern als Ersatz seiner eigenen, aufgeopferten Uhr behalten hätte
und sie darum am nächsten Tage zurückzugeben vergißt; auch
hätte er die Uhr vielleicht gern als Andenken an die Dame
besessen. Ferner bietet ihm das Vergessen der Damenuhr
Gelegenheit, die verehrte Dame ein zweites Mal zu besuchen; er
hatte sie ja des Morgens einer anderen Sache wegen aufsuchen
müssen und scheint mit dem Vergessen der Uhr gleichsam anzu-
deuten, daß ihm dieser schon längere Zeit vorher bestimmte
Besuch zu schade sei, um ihn noch nebenbei zur Rückgabe der
Uhr zu benützen. Auch spricht das zweimalige Vergessen der
eigenen und die dadurch ermöglichte Rückstellung der fremden
Uhr dafür, daß unser Mann es unbewußterweise zu vermeiden1) Dieses Weiterwirken im Unbewußten äußert sich einmal in Form eines
Traumes, welcher der Fehlhandlung folgt, ein andermal in der Wiederholung der-
selben oder in der Unterlassung einer Korrektur.S.
261
sucht, beide Uhren gleichzeitig zu tragen. Er trachtet offenbar,
diesen Anschein des Überflusses zu vermeiden, der in zu auf-
fälligem Gegensatz zu dem Mangel des Verwandten stünde;
andererseits aber weiß er damit seiner anscheinlichen Heirats-
absicht der Dame gegenüber mit der Selbstmahnung zu begegnen,
daß er seiner Familie (Mutter) gegenüber unlösbare Verpflichtungen
habe. Ein weiterer Grund für das Vergessen einer Damenuhr mag
endlich darin zu suchen sein, daß er sich am Abend zuvor als
Junggeselle vor seinen Bekannten geniert hatte, auf die Damenuhr
zu sehen, was er nur verstohlen tat, und daß er, um die Wieder-
holung dieser peinlichen Situation zu vermeiden, die Uhr nicht
mehr zu sich stecken mochte. Da er sie aber andererseits zurück-
zustellen hatte, so resultiert auch hier die unbewußt vollzogene
Symptomhandlung, die sich als Kompromißbildung zwischen
widerstreitenden Gefühlsregungen und als teuer erkaufter Sieg
der unbewußten Instanz erweist.“ (Zentralblatt f. Psychoanalyse,
II, 5.)Drei Beobachtungen von J. Stärcke (l. c.):
6) Verlegen-Zerbrechen-Vergessen — als Aus-
druck eines zurückgedrängten Gegenwillens: „Von
einer Sammlung Illustrationen für eine wissenschaftliche Arbeit
sollte ich eines Tages meinem Bruder einige leihen, welche er
als Lichtbilder bei einem Vortrag benutzen wollte. Obgleich ich
einen Augenblick den Gedanken verspürte, daß ich die Repro-
duktionen, die ich mit vieler Mühe gesammelt hatte, lieber in
keiner Weise vorgeführt oder publiziert sähe, bevor ich das selbst
machen könnte, versprach ich ihm, die Negative der gewünschten
Bilder aufzusuchen und Laternenbilder davon anzufertigen. —
Diese Negative konnte ich aber nicht finden. Den ganzen Stapel
Schachteln voll Negative, die sich auf diesen Gegenstand bezogen,
sah ich durch, gut zweihundert Negative nahm ich eines nach
dem anderen in die Hand, aber die Negative, die ich suchte,
waren nicht dabei. Ich vermutete wohl, daß ich meinem BruderS.
262
diese Bilder eigentlich nicht zu gönnen schien. Nachdem ich mir
diesen abgünstigen Gedanken bewußt gemacht und bestritten
hatte, bemerkte ich, daß ich die oberste Schachtel des Stapels zur
Seite gesetzt und diese nicht durchsucht hatte, und diese Schachtel
enthielt die gesuchten Negative. Auf dem Deckel dieser Schachtel
stand eine kurze Aufzeichnung betreffs des Inhalts, und wahr-
scheinlich hatte ich das mit einem flüchtigen Blick gesehen, bevor
ich diese Schachtel zur Seite setzte. Der abgünstige Gedanke
schien indessen noch nicht ganz besiegt, denn es geschah noch
allerlei, bevor die Lichtbilder verschickt waren. Eine von den
Laternenplatten drückte ich kaputt, während ich diese in der
Hand hatte und die Glasseite rein putzte (so zerbreche ich sonst
nie eine Laternenplatte). Als ich von dieser Platte ein neues
Exemplar angefertigt hatte, fiel es mir aus der Hand und nur
dadurch, daß ich den Fuß vorstreckte und es darauf auffing,
zerbrach es nicht. Als ich die Laternenplatten montierte, fiel der
ganze Haufen noch einmal auf den Boden, glücklicherweise ohne
daß dabei etwas zerbrach. Und schließlich dauerte es noch
mehrere Tage, bevor ich sie wirklich emballierte und versandte,
da ich mir dieses jeden Tag von neuem vornahm und dieses
Vornehmen jedesmal wieder vergaß.“7) Wiederholtes Vergessen — Vergreifen bei der
endlichen Ausführung: „Eines Tages mußte ich einem
Bekannten eine Postkarte senden, verschob es aber während
mehrerer Tage immer wieder, wobei ich ein starkes Vermuten
hatte, daß folgendes die Ursache davon war: In einem Briefe
hatte er mir mitgeteilt, daß im Laufe jener Woche mich jemand
besuchen wollte, auf dessen Besuch ich nicht sehr erpicht war.
Als diese Woche vorüber war und die Aussicht des ungewünschten
Besuches sehr gering geworden war, schrieb ich endlich die
Postkarte, worin ich mitteilte, wann ich zu sprechen sein würde.
Als ich diese Postkarte schrieb, wollte ich anfangs hinzufügen,
daß ich wegen druk werk (= emsige, angestrengte oder über-S.
263
häufte Arbeit) am Schreiben behindert gewesen war, aber ich
schrieb das am Ende nicht, weil diese gewöhnliche Ausrede doch
von keinem vernünftigen Menschen mehr geglaubt wird. Ob diese
kleine Unwahrheit sich doch äußern mußte, weiß ich nicht, aber
als ich die Postkarte in den Briefkasten warf, warf ich sie irrtüm-
licherweise in die untere Öffnung des Kastens: ‚Drukwerk‘
(= Drucksachen).“8) Vergessen und Irrtum: „Ein Mädchen geht eines
Morgens, da das Wetter sehr schön ist, nach dem ‚Ryksmuseum‘,
um dort Gipsabgüsse zu zeichnen. Obgleich sie bei diesem schönen
Wetter lieber spazieren gehen möchte, entschloß sie sich, doch
mal emsig zu sein und zu zeichnen. Sie muß zuerst Zeichenpapier
kaufen. Sie geht zum Laden (ungefähr zehn Minuten vom
Museum), kauft Bleistifte und andere Zeichengeräte, aber vergißt
eben das Zeichenpapier zu kaufen, geht dann zum Museum, und
als sie auf ihrem Stühlchen sitzt, fertig, um anzufangen, da hat
sie noch kein Papier, so daß sie von neuem zu dem Laden gehen
muß. Nachdem sie Papier geholt hat, fängt sie wirklich an zu
zeichnen, geht mit der Arbeit gut vorwärts und hört nach einiger
Zeit vom Turme des Museums eine große Zahl Glockenschläge.
Sie denkt: ‚Das wird schon zwölf Uhr sein‘, arbeitet noch fort,
bis die Turmglocke Viertelstunde spielt. (‚das ist Viertel nach
zwölf‘, denkt sie), packt jetzt ihre Zeichengeräte ein und entschließt
sich, durch den ‚Vondelpark‘ zum Hause ihrer Schwester zu
spazieren, um dort Kaffee zu trinken (= holl. zweite Mahlzeit).
Beim Suasso-Museum sieht sie zu ihrem Staunen, daß es statt
halb eins erst zwölf Uhr ist! — Das lockende schöne Wetter
hatte ihren Fleiß hinters Licht geführt und dadurch hatte sie, als
die Turmglocke um halb zwölf zwölf schlug, nicht daran gedacht,
daß eine Turmglocke auch mit der halben Stunde schlägt.“9) Wie schon einige der vorstehenden Beobachtungen zeigen,
kann die unbewußt störende Tendenz ihre Absicht auch erreichen,
indem sie dieselbe Art der Fehlleistung hartnäckig wiederholt.S.
264
Ich entnehme ein amüsantes Beispiel hiefür einem Büchlein
„Frank Wedekind und das Theater“, das im Münchener Drei
Masken-Verlag erschienen ist, muß aber die Verantwortung für
das in Mark Twainscher Manier erzählte Geschichtchen dem Autor
des Buches überlassen.„In Wedekinds Einakter ‚Die Zensur‘ fällt an der ernstesten
Stelle des Stückes der Ausspruch: ‚Die Furcht vor dem
Tode ist ein Denkfehler.‘ Der Autor, dem die Stelle am
Herzen lag, bat auf der Probe den Darsteller, vor dem Worte
‚Denkfehler‘ eine kleine Pause zu machen. Am Abend — der
Darsteller ging ganz in seiner Rolle auf, beobachtete auch die
Pause genau, sagte aber unwillkürlich in feierlichstem Tone: ‚Die
Furcht vor dem Tode ist ein Druckfehler.‘ Der Autor ver-
sicherte dem Künstler nach Schluß der Vorstellung auf seine
Frage, daß er nicht das geringste auszusetzen habe, nur heiße es
an der betreffenden Stelle nicht: die Furcht vor dem Tode sei
ein Druckfehler, sondern ein Denkfehler. — Als ‚Die Zensur‘ am
folgenden Abend wiederholt wurde, sagte der Darsteller an der
bewußten Stelle, und zwar wieder in feierlichstem Tone: ‚Die
Furcht vor dem Tode ist ein — Denkzettel.‘ Wedekind
spendete dem Schauspieler wieder uneingeschränktes Lob, aber
bemerkte nur nebenbei, daß es nicht heiße, die Furcht vor dem
Tode sei ein Denkzettel, sondern ein Denkfehler. — Am nächsten
Abend wurde wieder ‚Die Zensur‘ gespielt und der Darsteller, mit
dem sich der Autor inzwischen befreundet und Kunstanschauungen
ausgetauscht hatte, sagte, als die Stelle kam, mit der feierlichsten
Miene von der Welt: ‚Die Furcht vor dem Tode ist ein —
Druckzettel.‘ — Der Künstler erhielt des Autors rückhaltlose
Anerkennung, der Einakter wurde auch noch oft wiederholt, aber
den Begriff ‚Denkfehler‘ hielt der Autor nun ein für allemal für
endgültig erledigt.“Rank hat auch den sehr interessanten Beziehungen von „Fehl-
leistung und Traum“ (Zentralbl. f. Psychoanalyse II. S. 266 u. Internat.S.
265
Zeitschr. f. Psychoanalyse III, S. 158) Aufmerksamkeit geschenkt,
denen man aber nicht ohne eingehende Analyse des Traumes
folgen kann, welcher sich an die Fehlhandlung anschließt. Ich
träumte einmal in einem längeren Zusammenhange, daß ich
mein Portemonnaie verloren. Am Morgen vermißte ich es wirklich
heim Ankleiden; ich hatte vergessen, es beim Auskleiden vor der
Traumnacht aus der Hosentasche zu nehmen und an seinen
gewohnten Platz zu legen. Dieses Vergessen war mir also nicht
unbekannt, es sollte wahrscheinlich einem unbewußten Gedanken
Ausdruck geben, der für das Auftreten im Trauminhalt vor-
bereitet war.1Ich will nicht behaupten, daß solche Fälle von kombinierten
Fehlleistungen etwas Neues lehren können, was nicht schon aus
den Einzelfällen zu ersehen wäre, aber dieser Formenwechsel der
Fehlleistung bei Erhaltung desselben Erfolges gibt doch den
plastischen Eindruck eines Willens, der nach einem bestimmten
Ziele strebt, und widerspricht in ungleich energischerer Weise
der Auffassung, daß die Fehlleistung etwas Zufälliges und der
Deutung nicht Bedürftiges sei. Es darf uns auch auffallen, daß es
in diesen Beispielen einem bewußten Vorsatz so gründlich mißlingt,
den Erfolg der Fehlleistung hintanzuhalten. Mein Freund setzt
es doch nicht durch, die Vereinssitzung zu besuchen, und die
Dame findet sich außerstande, sich von der Medaille zu trennen.
Jenes Unbekannte, das sich gegen diese Vorsätze sträubt, findet1) Daß eine Fehlleistung wie das Verlieren oder Verlegen durch einen Traum
rückgängig gemacht wird, indem man im Traum erfährt, wo der vermißte Gegen-
stand zu finden ist, kommt nicht so selten vor, hat aber auch nichts von der Natur
des Okkulten, so lange Träumer und Verlustträger dieselbe Person sind. Eine junge
Dame schreibt: „Vor ungefähr vier Monaten verlor ich — in der Bank — einen
sehr schönen Ring. Ich durchsuchte jeden Winkel in meinem Zimmer, fand ihn aber
nicht. Vor einer Woche träumte mir, er liege neben dem Kasten in der Heizung.
Der Traum ließ mir natürlich keine Ruhe und nächsten Morgen fand ich ihn wirklich
an der Stelle.“ Sie wundert sich über diesen Vorfall, behauptet, es geschehe ihr oft,
daß ihre Gedanken und Wünsche so in Erfüllung gehen, unterläßt es aber sich zu
fragen, welche Veränderung sich in ihrem Leben zwischen dem Verlieren und
dem Wiederfinden des Ringes zugetragen hat.S.
freudgs4
256
–266