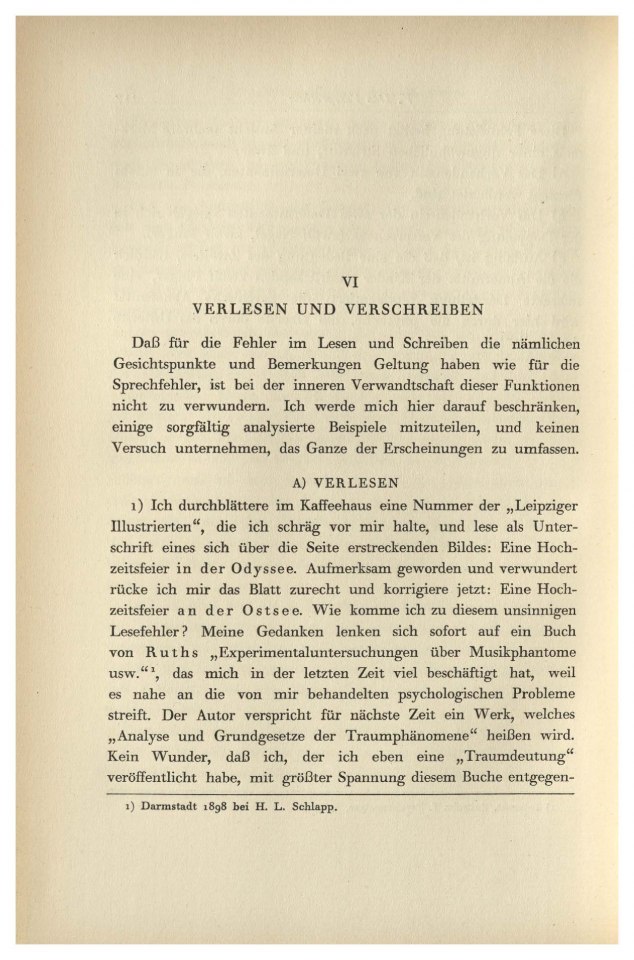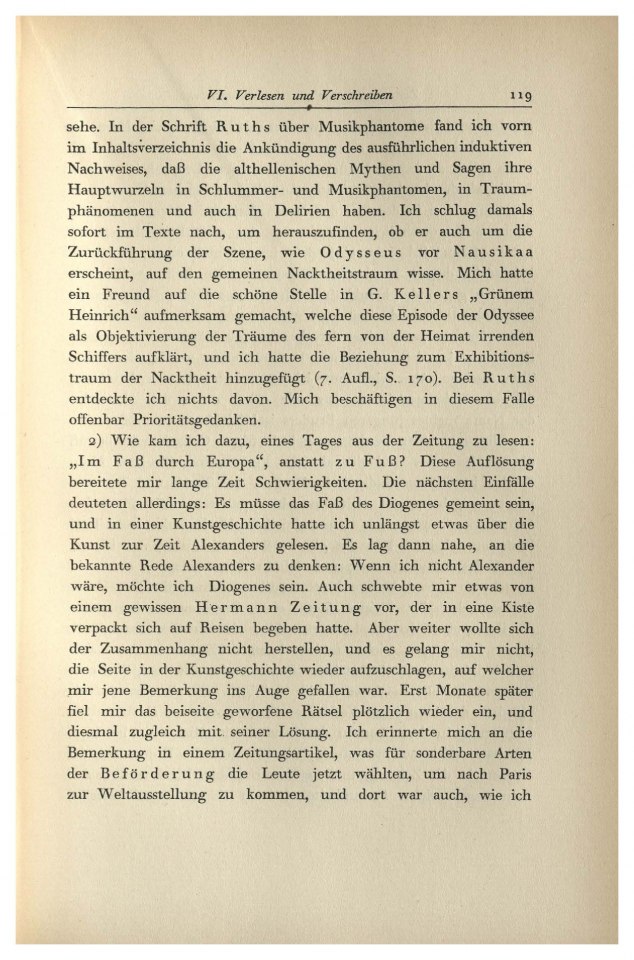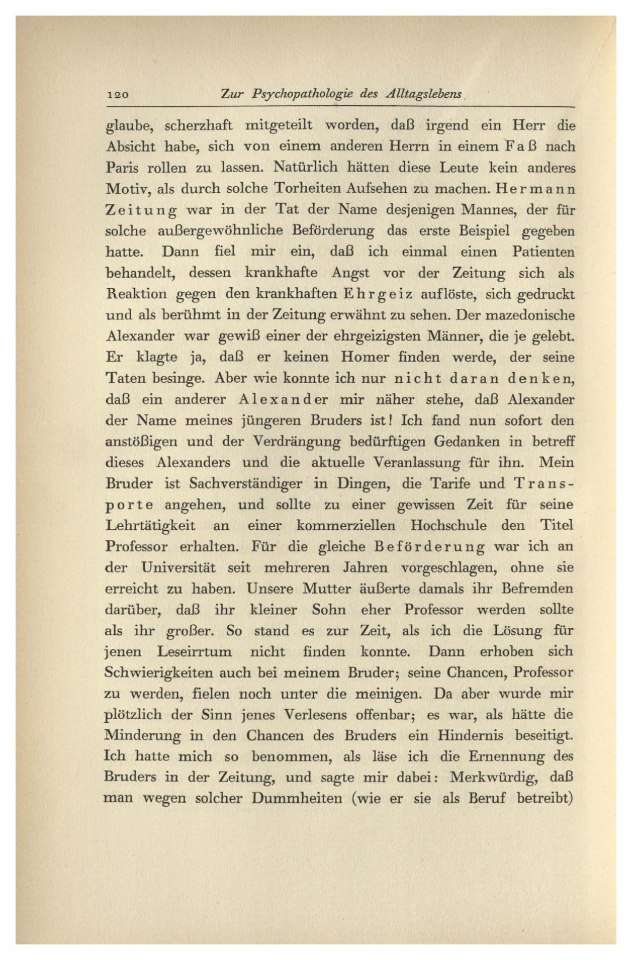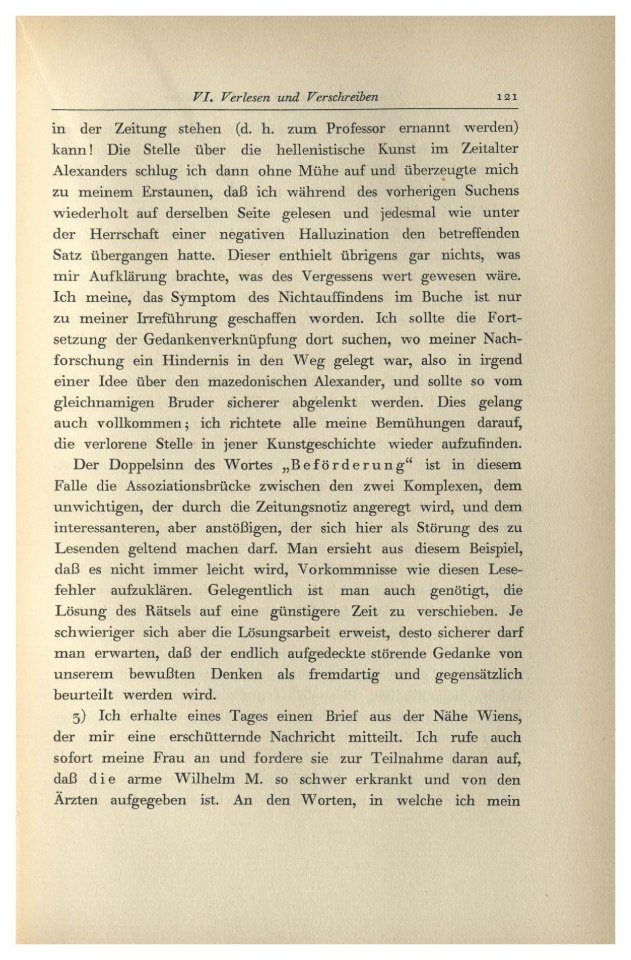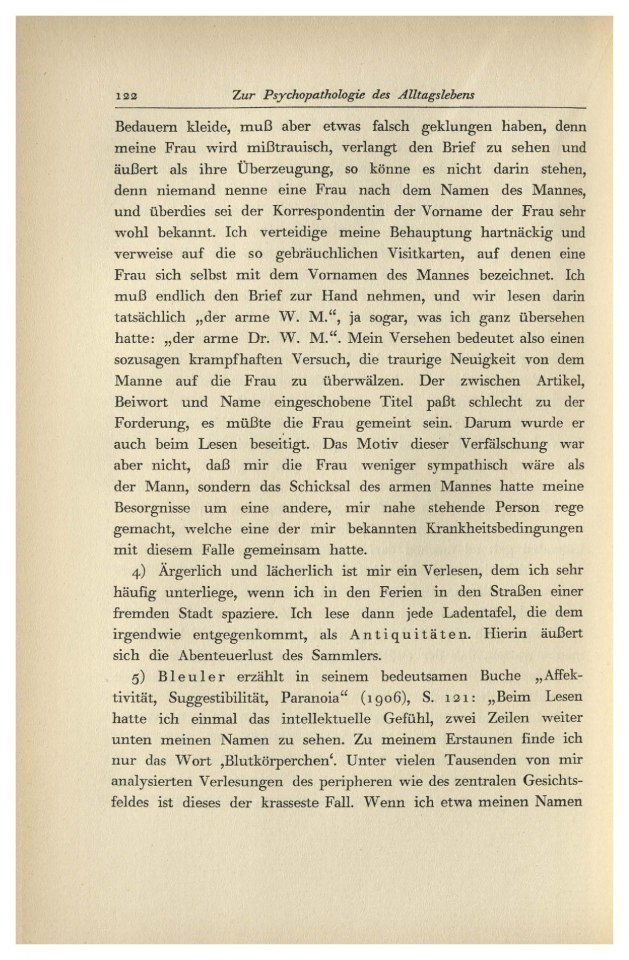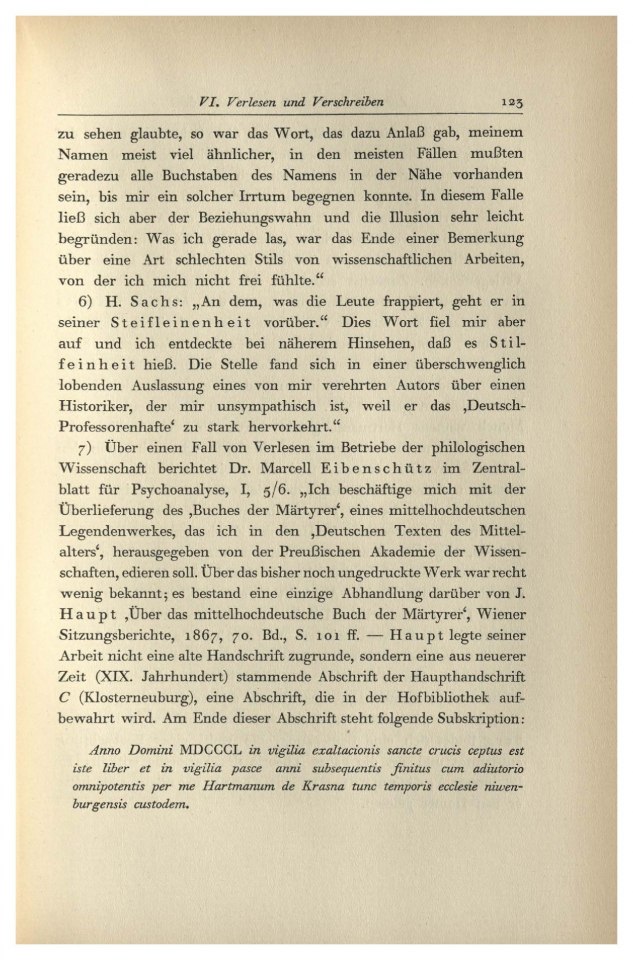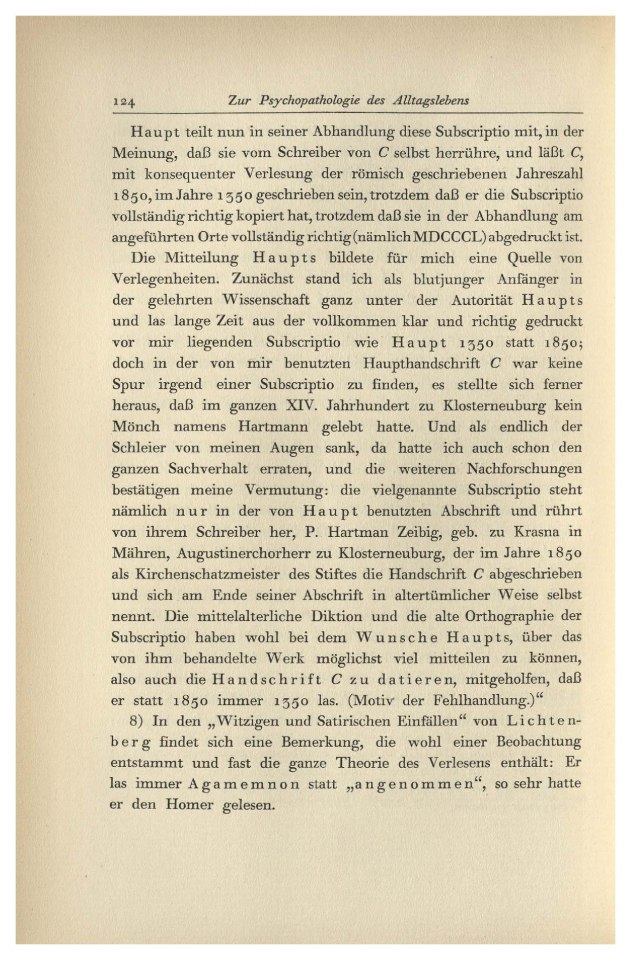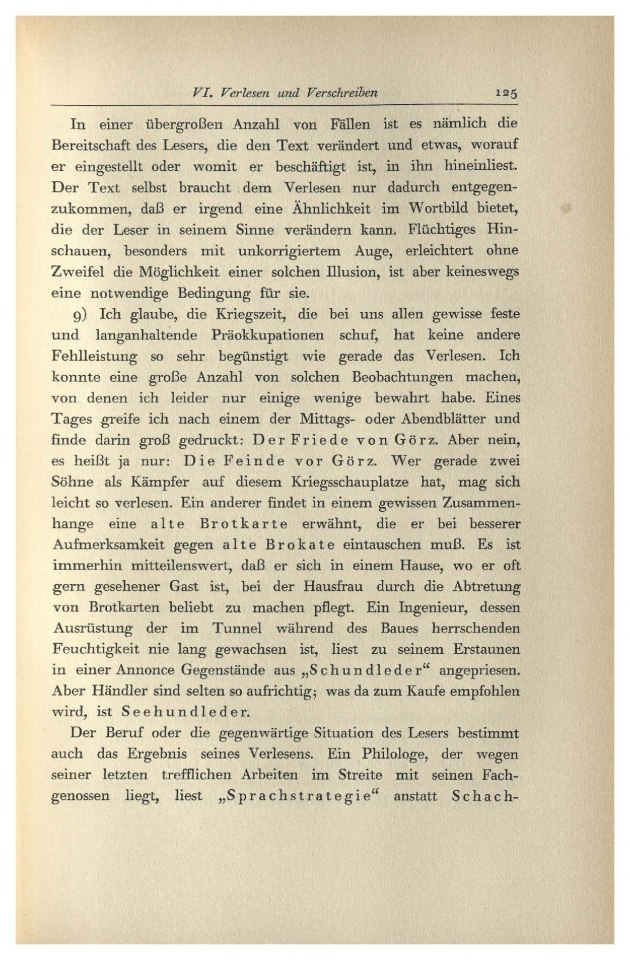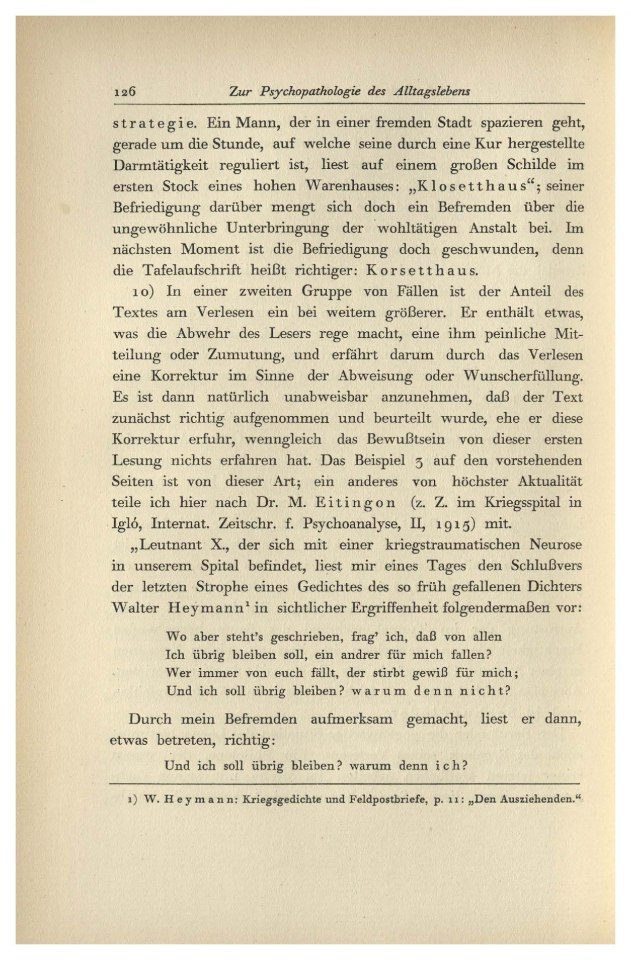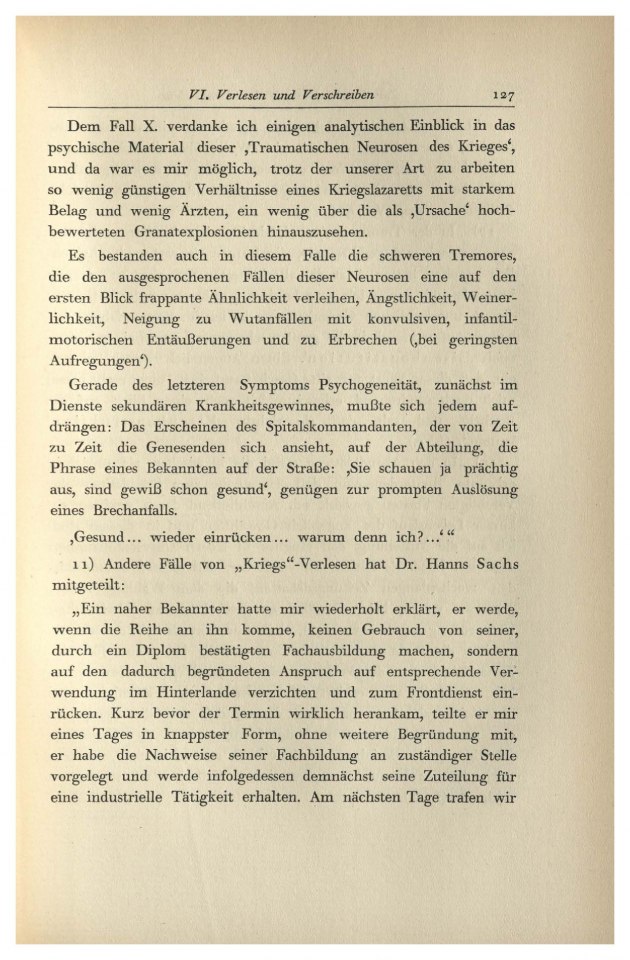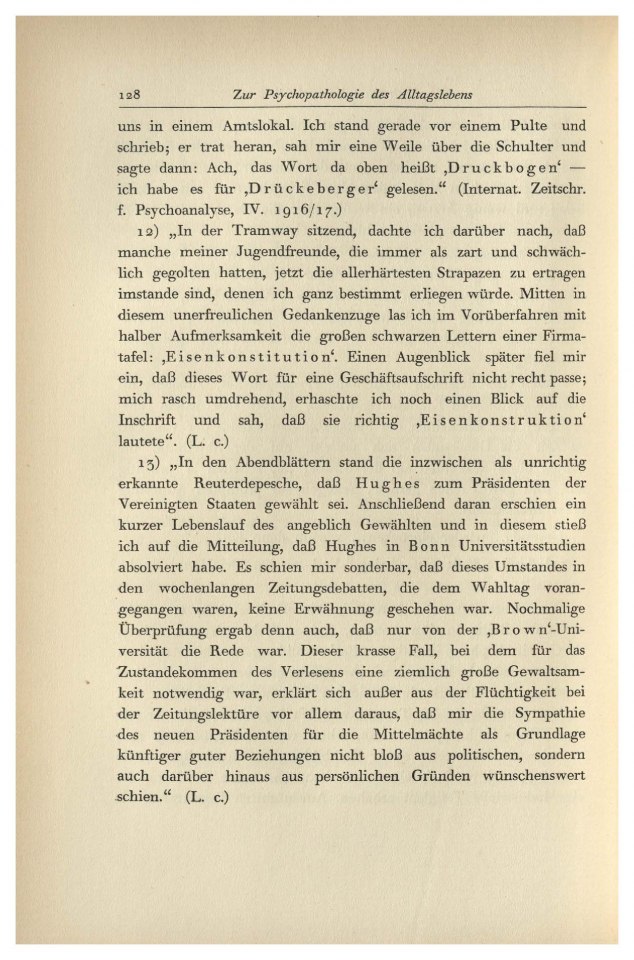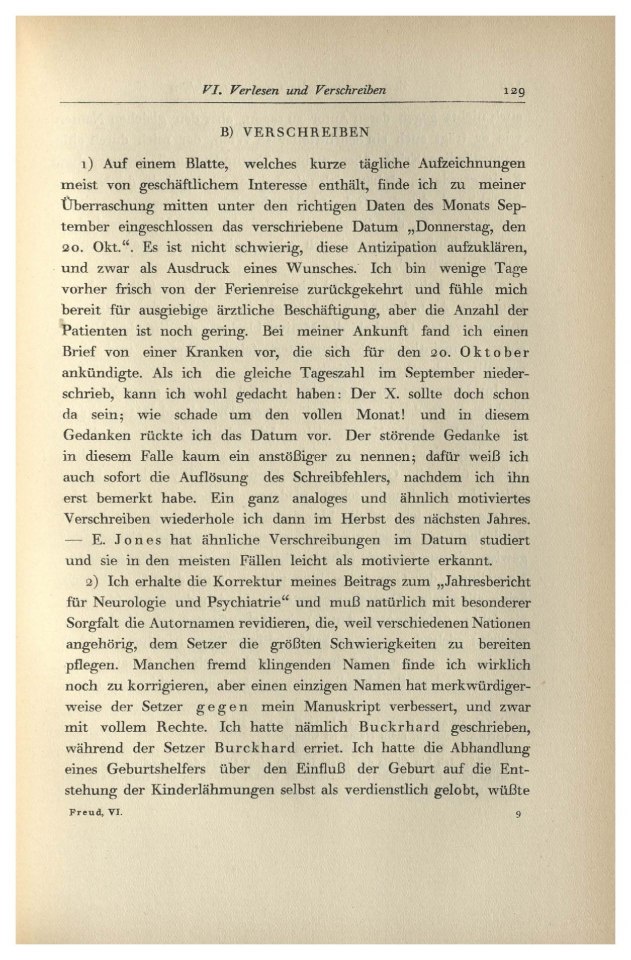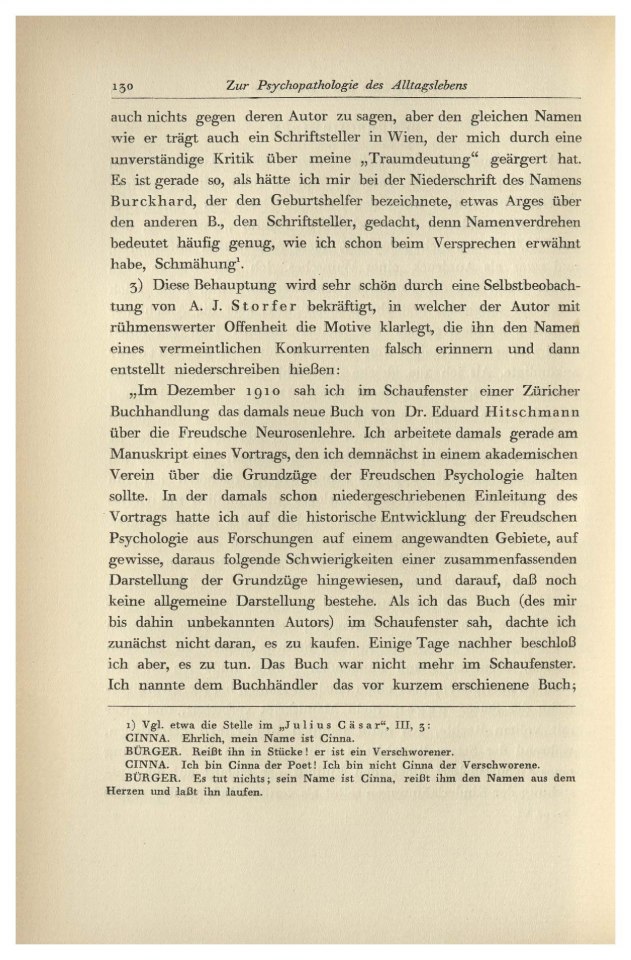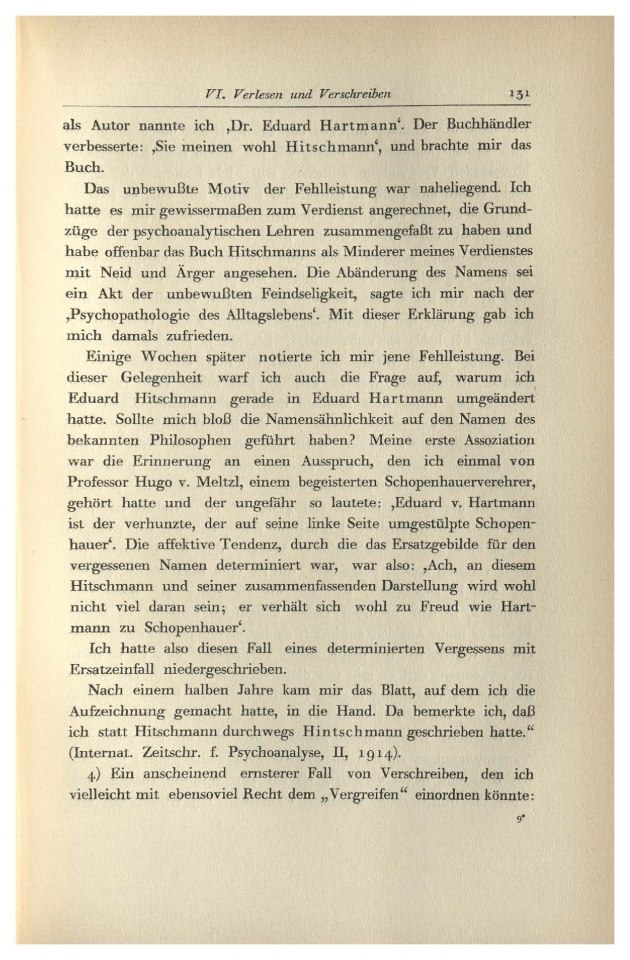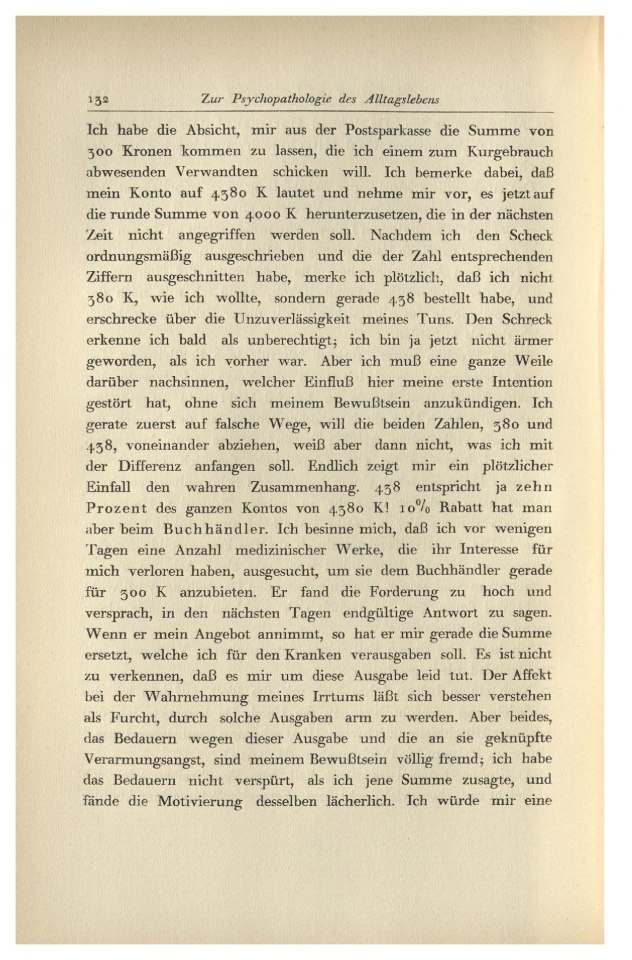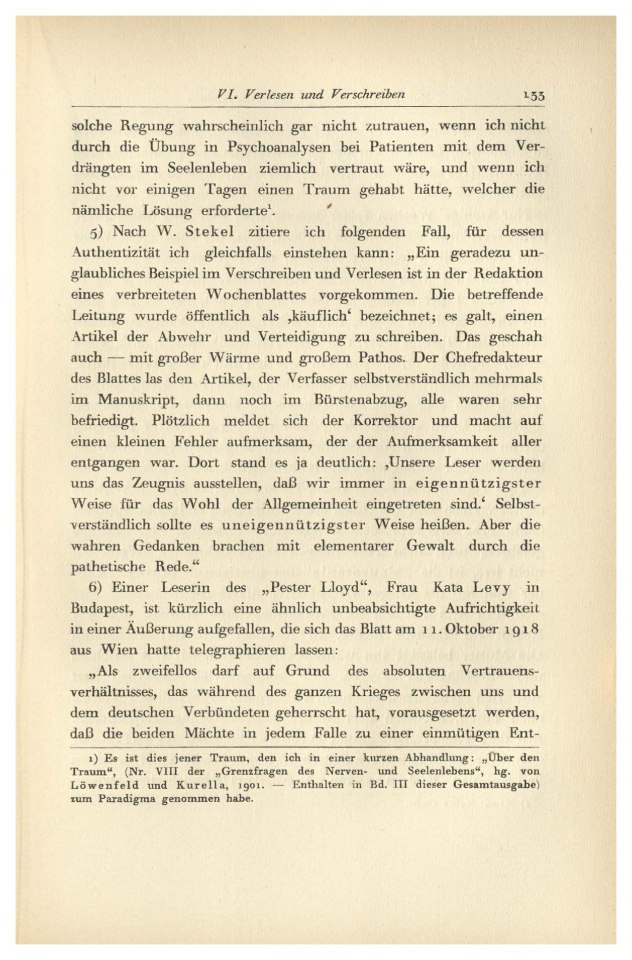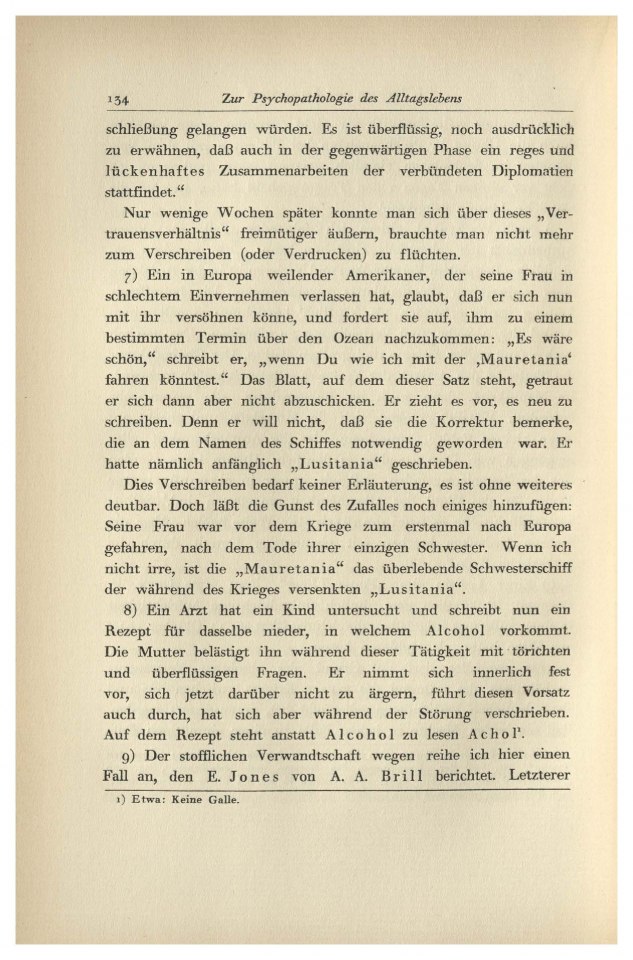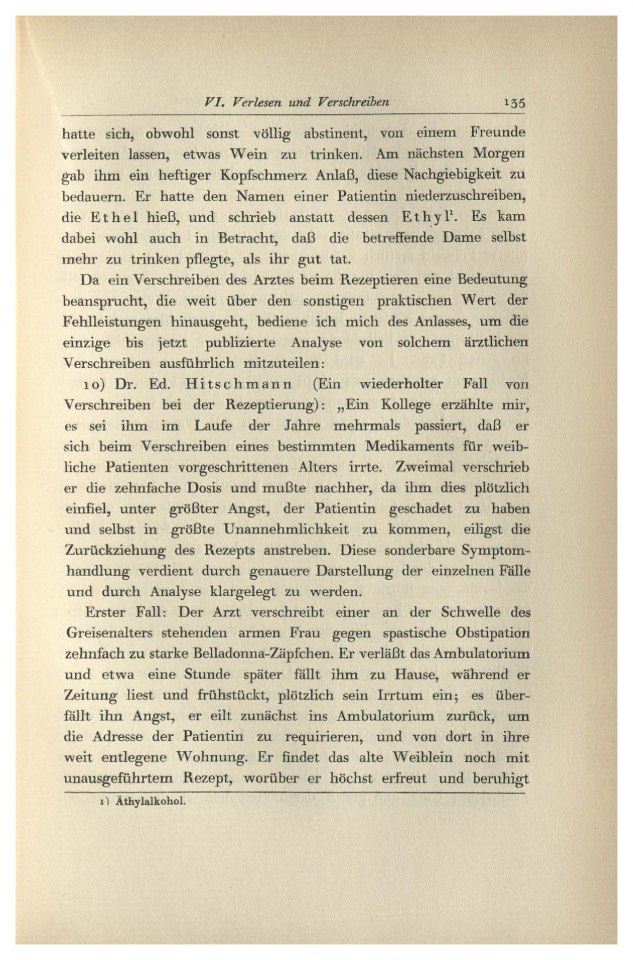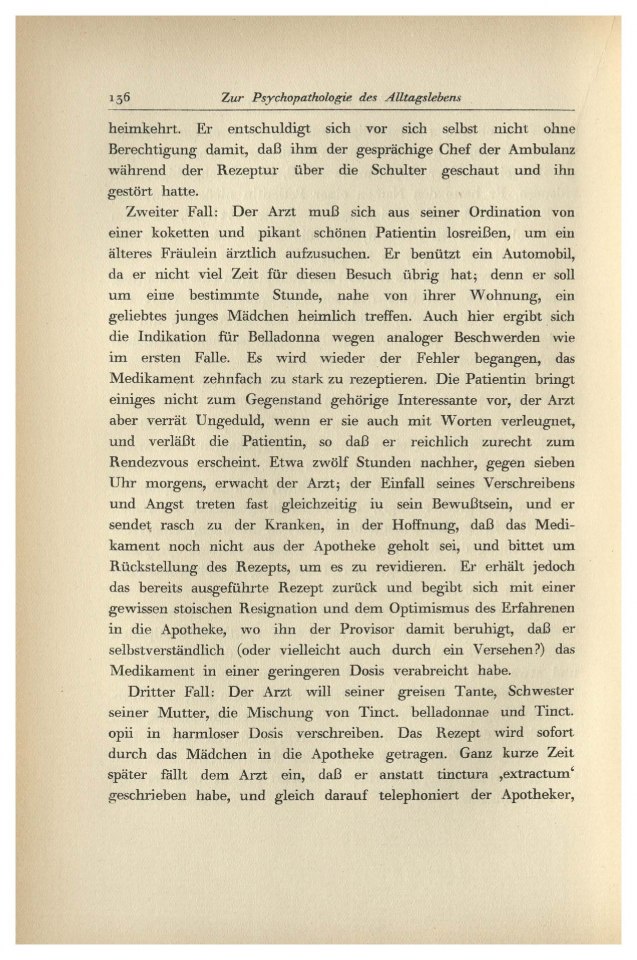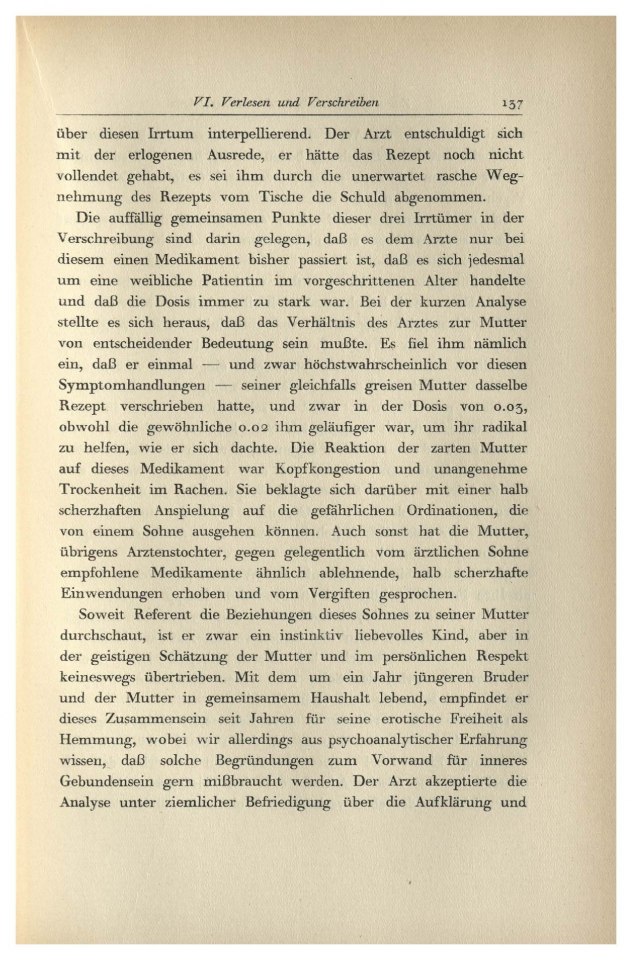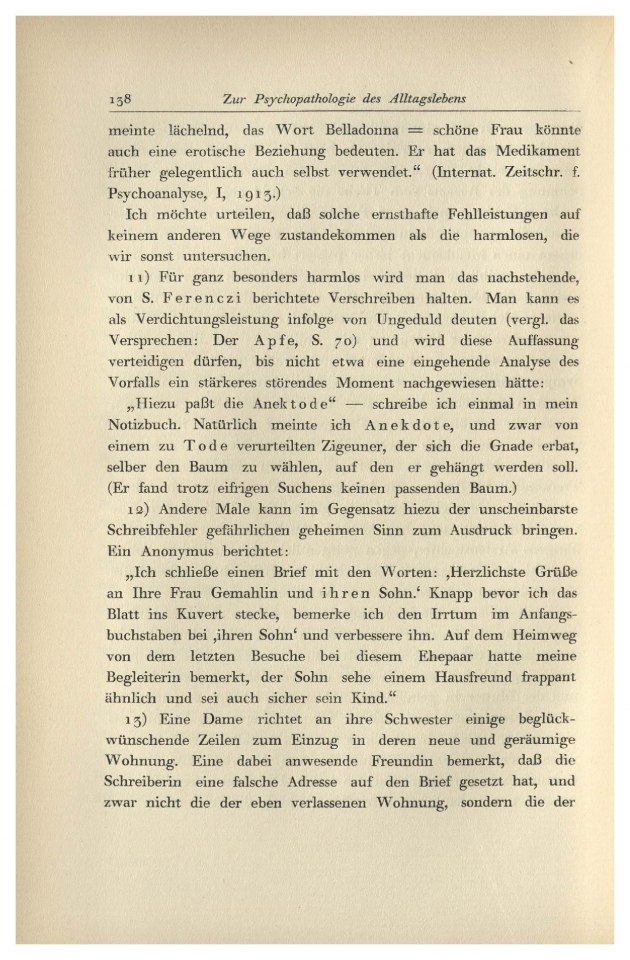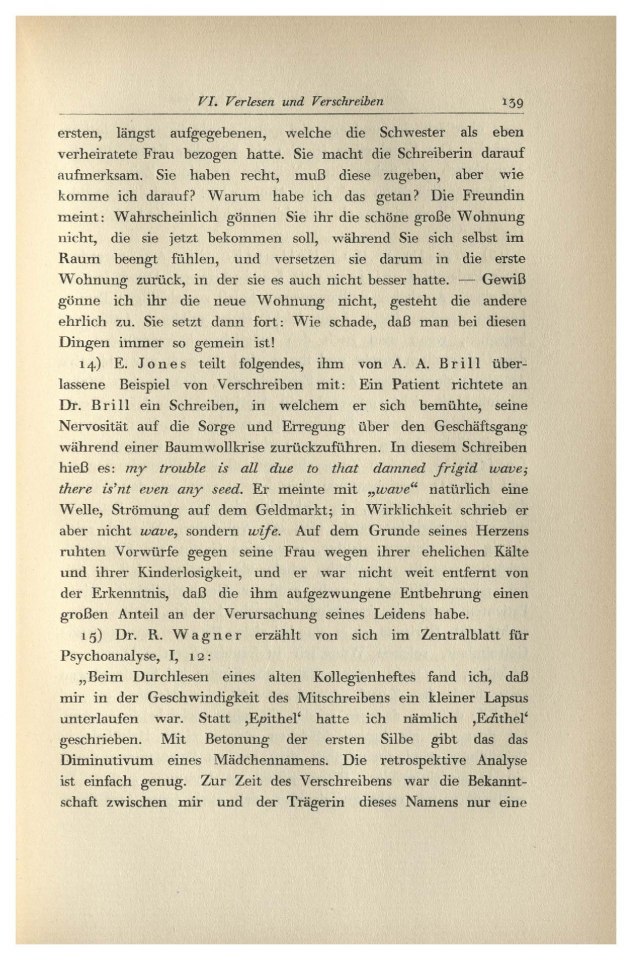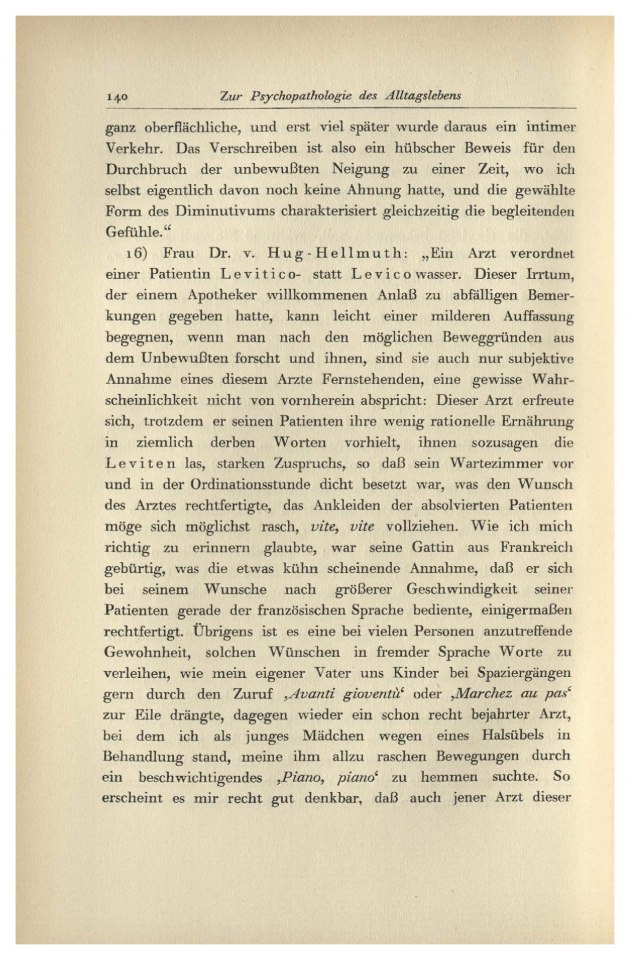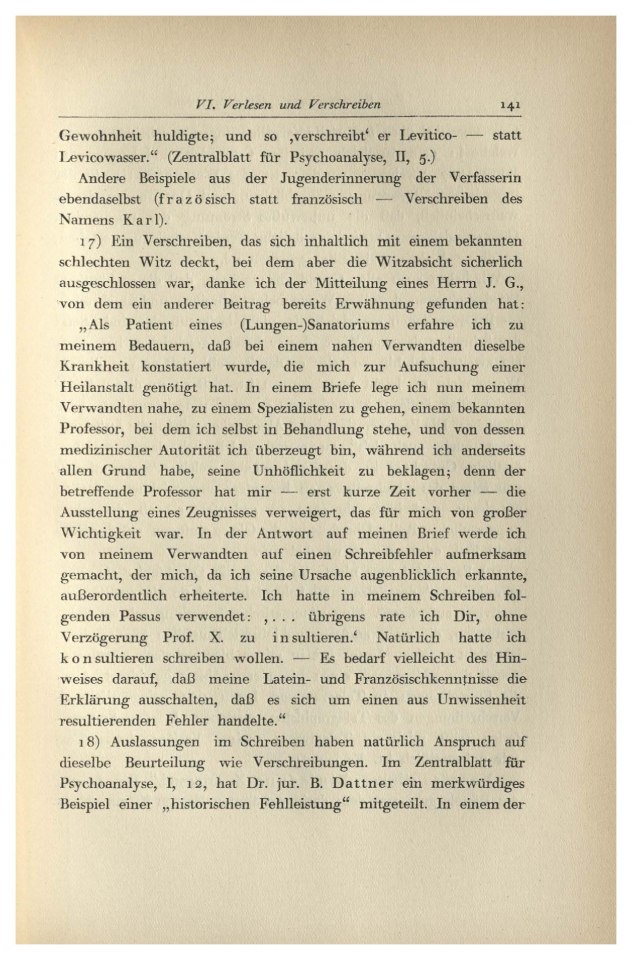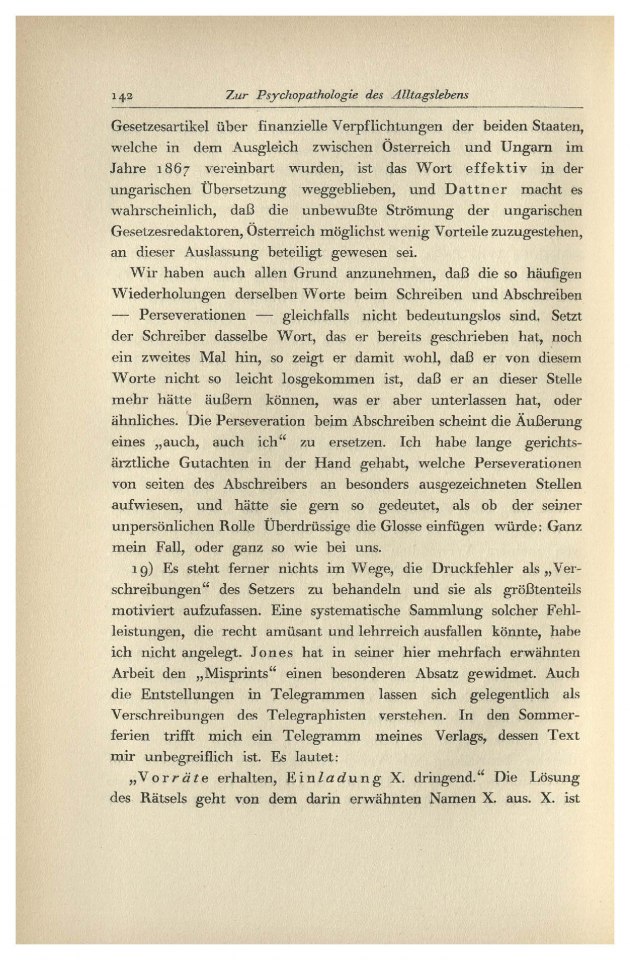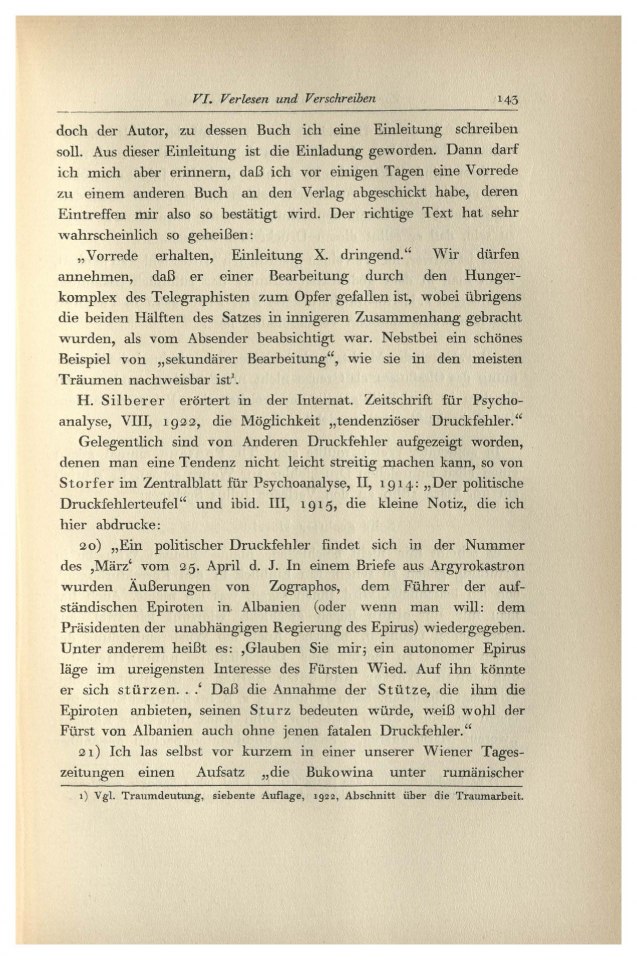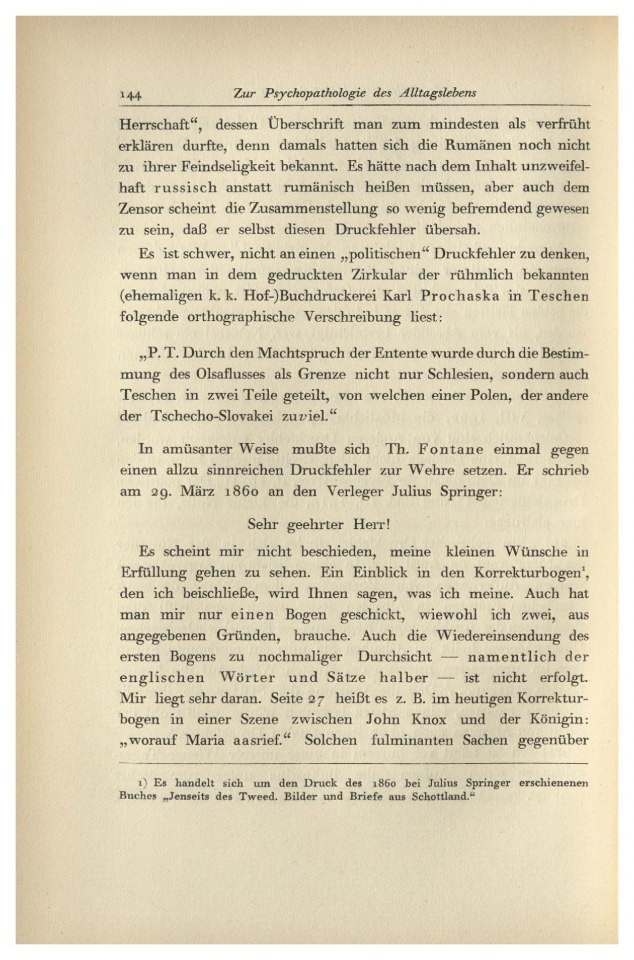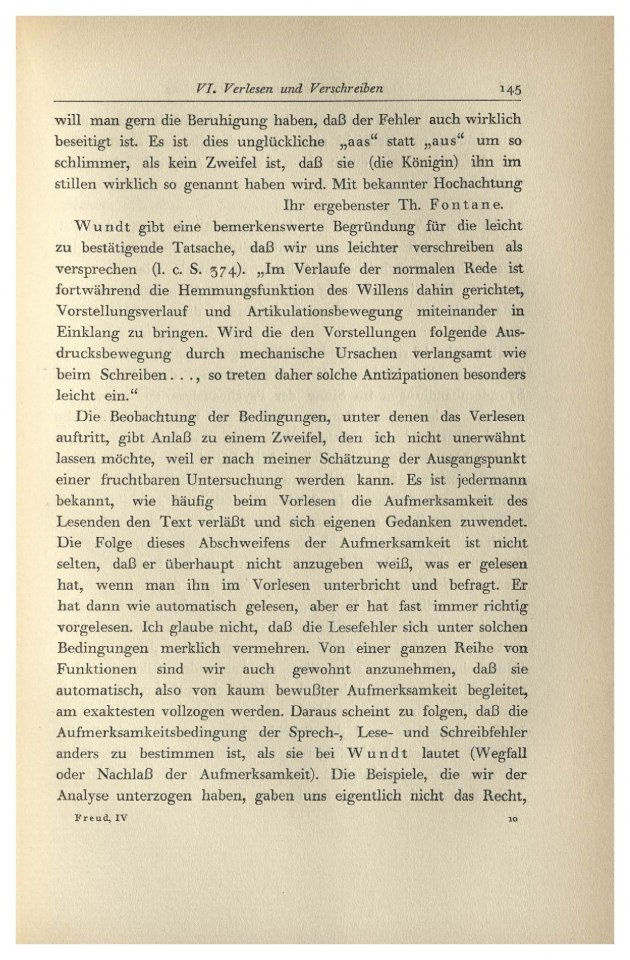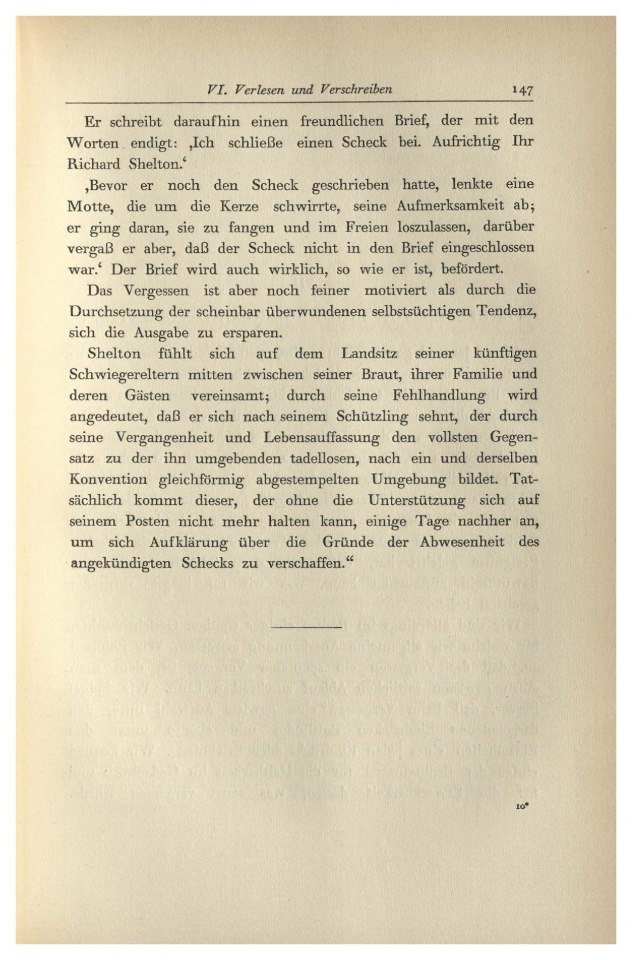S.
[118]
VI
VERLESEN UND VERSCHREIBEN
Daß für die Fehler im Lesen und Schreiben die nämlichen
Gesichtspunkte und Bemerkungen Geltung haben wie für die
Sprechfehler, ist bei der inneren Verwandtschaft dieser Funktionen
nicht zu verwundern. Ich werde mich hier darauf beschränken,
einige sorgfältig analysierte Beispiele mitzuteilen, und keinen
Versuch unternehmen, das Ganze der Erscheinungen zu umfassen.A) VERLESEN
1) Ich durchblättere im Kaffeehaus eine Nummer der „Leipziger
Illustrierten“, die ich schräg vor mir halte, und lese als Unter-
schrift eines sich über die Seite erstreckenden Bildes: Eine Hoch-
zeitsfeier in der Odyssee. Aufmerksam geworden und verwundert
rücke ich mir das Blatt zurecht und korrigiere jetzt: Eine Hoch-
zeitsfeier an der Ostsee. Wie komme ich zu diesem unsinnigen
Lesefehler? Meine Gedanken lenken sich sofort auf ein Buch
von Ruths „Experimentaluntersuchungen über Musikphantome
usw.“1, das mich in der letzten Zeit viel beschäftigt hat, weil
es nahe an die von mir behandelten psychologischen Probleme
streift. Der Autor verspricht für nächste Zeit ein Werk, welches
„Analyse und Grundgesetze der Traumphänomene“ heißen wird.
Kein Wunder, daß ich, der ich eben eine „Traumdeutung“
veröffentlicht habe, mit größter Spannung diesem Buche entgegen-1) Darmstadt 1898 bei H. L. Schlapp.
S.
VI. Verlesen und Verschraüeni 119
sehe. In der Schrift Ruths über Musikphantome fand ich vom
im Inhaltsirerzeichnis die Ankündigung des ausführlichen induktiven
Nachweises, daß die althellenischen Mythen und Sagen ihre
Hauptwuizeln in Schlummer— und Musikphantomen, in Traum-
phänomenen und auch in Delirien haben. Ich schlug damals
sofort im Tei(te nach, um herauszufinden, ob er auch um die
Zurückführung der Szene, wie Odysseus vor Nausikaa
erscheint, auf den gemeinen Nacktheitstraum wisse. Mich hatte
ein Freund auf die schöne Stelle in G. Kellers „Grünem
Heinrich“ aufmerksam gemacht, welche diese Episode der Odyssee
als Objektivierung der Träume des fern von der Heimat irrenden
Schiffers aufklärt, und ich hatte die Beziehung zum Exhibitions-
traum der Nacktheit hinzugefügt (7. Aufl., S. 170). Bei Ruths
entdeckte ich nichts davon. Mich beschäftigen in diesem Falle
offenbar Prioritätsgedanken.2) Wie kam ich dazu., eines Tages aus der Zeitung zu lesen:
„Im F aß durch Europa“, anstatt zu F uß? Diese Auflösung
bereitete mir lange Zeit Schwierigkeiten. Die nächsten Einiälle
deuteten allerdings: Es müsse das Faß des Diogenes gemeint sein,
und in einer Kunstgeschichte hatte ich unlängst etwas über die
Kunst zur Zeit Alexanders gelesen. Es lag dann nahe, an die
bekannte Rede Alexanders zu denken: Wenn ich nicht Alexander
wäre, möchte ich Diogenes sein. Auch schwebte mir etwas von
einem gewissen Hermann Zeitung vor, der in eine Kiste
verpackt sich auf Reisen begehen hatte. Aber weiter wollte sich
der Zusammenhang nicht herstellen, und es gelang mir nicht,
die Seite in der Kunstgeschichte wieder aufzuschlagen, auf welcher
mir jene Bemerkung ins Auge gefallen war. Erst Monate später
fiel mir das beiseite geworfene Rätsel plötzlich wieder ein, und
diesmal zugleich mit. seiner Lösung. Ich erinnerte mich an die
Bemerkung in einem Zeitungsartikel, was für sonderbare Arten
der Beförderung die Leute jetzt wählten, um nach Paris
zur Weltausstellung zu kommen, und dort war auch, wie ichS.
mo Zur Psychopatholagü: des Alltagslebens_
glaube, scherzhaft mitgeteilt werden, daß irgend ein Herr die
Absicht habe, sich von einem anderen Herrn in einem Faß nach
Paris rollen zu lassen. Natürlich hätten diese Leute kein anderes
Motiv, als durch solche Torheiten Aufsehen zu machen. Hermann
Zeitung war in der Tal: der Name desjenigen Mannes, der für
solche außergewöhnliche Beförderung das erste Beispiel gegeben
hatte. Dann fiel mir ein, daß ich einmal einen Patienten
behandelt, dessen krankhafte Angst vor der Zeitung sich als
Reaktion gegen den krankhaften Ehrgeiz auflöste, sich gedruckt
und als berühmt in der Zeitung erwähnt zu sehen. Der mazedonische
Alexander war gewiß einer der ehrgeizigsten Männer, die je gelebt
Er klagte ja, daß er keinen Homer finden werde, der seine
Taten besinge. Aber wie konnte ich nur nicht daran denken,
daß ein anderer Alexander mir näher stehe, daß Alexander
der Name meines jüngeren Bruders ist! Ich fand nun sofort den
anstößigen und der Verdrängung bedürftigen Gedanken in betrefl"
dieses Alexanders und die aktuelle Veranlassung für ihn. Mein
Bruder ist Sachverständiger in Dingen, die Tarife und Trans-
porte angehen, und sollte zu einer gewissen Zeit für seine
Lehrtätigkeit an einer kommerziellen Hochschule den Titel
Professor erhalten. Für die gleiche Beförderung war ich an
der Universität seit mehreren Jahren vorgeschlagen, ohne sie
erreicht zu haben. Unsere Mutter äußerte damals ihr Befremden
darüber, daß ihr kleiner Sohn eher Professor werden sollte
als ihr großer. So stand es zur Zeit, als ich die Lösung für
jenen Leseirrtum nicht finden konnte. Dann erhoben sich
Schwierigkeiten auch bei meinem Bruder; seine Chancen, Professor
zu werden, fielen noch unter die meinigen. Da aber wurde mir
plötzlich der Sinn jenes Verlesens offenbar; es war, als hätte die
Minderung in den Chancen des Bruders ein Hindernis beseitigt.
Ich hatte mich so henommen, als läse ich die Ernennung des
Bruders in der Zeitung, und sagte mir dabei: Merkwürdig, daß
man wegen solcher Dummheiten (wie er sie als Beruf betreibt)S.
VI. Verlesen und Verschrzüßen 19,1
in der Zeitung stehen (d. h. zum Professor ernannt werden)
kann! Die Stelle über die hellenistische Kunst im Zeitalter
Alexanders schlug ich dann ohne Mühe auf und überzeugte mich
zu meinem Erstaunen, daß ich während des vorherigen Suchens
wiederholt auf derselben Seite gelesen und jedesmal wie unter
der Herrschaft einer negativen Halluzination den betrefienden
Satz übergangen hatte. Dieser enthielt übrigens gar nichts, was
mir Aufklärung brachte, was des Vergessens wert gewesen wäre.
Ich meine, das Symptom des Nichtauffindens im Buche ist nur
zu meiner Irrefüh.rung geschaffen worden. Ich sollte die Fort—
setzung der Gedankenverknüpfung dort suchen, wo meiner Nach-
forschung ein Hindernis in den Weg gelegt war, also in irgend
einer Idee über den mazedonischen Alexander, und sollte so vom
gleichnamigen Bruder sicherer abgelenkt werden. Dies gelang
auch vollkommen; ich richtete alle meine Bemühungen darauf,
die verlorene Stelle in jener Kunstgeschichte wieder aufzufinrlen.Der Doppelsinn des Wortes „Beförderung“ ist in diesem
Falle die Assoziationsbriicke zwischen den zwei Komplexen, dem
unwichtigen, der durch die Zeitungsnmiz angeregt wird, und dem
interessanteren, aber anstößigen, der sich hier als Störung des zu
Lesenden geltend machen darf. Man ersieht aus diesem Beispiel,
daß es nicht immer leicht wird, Vorkommnisse wie diesen Lese-
fehler aufzuklären. Gelegentlich ist man auch genötigt, die
Lösung des Rätsels auf eine günstigere Zeit zu verschieben. Je
schwieriger sich aber die Lösungsarbeit erweist, desto sicherer darf
man erwarten, daß der endlich aufgedeckte störende Gedanke von
unserem bewußten Denken als fremdartig und 'gegensätzlich
beurteilt werden wird.5) Ich erhalte eines Tages einen Brief aus der Nähe Wiens,
der mir eine erschütternde Nachricht mitteilt. Ich rufe auch
sofort meine Frau an und fordere sie zur Teilnahme daran auf,
daß die arme Wilhelm M. so schwer erkrankt und von den
Ärzten aufgegeben ist. An den Worten, in welche ich meinS.
122 Zur Psychopathologie des Alltagsleben:
Bedauern kleide, muß aber etwas falsch geklungen haben, denn
meine Frau wird mißtrauisch, verlangt den Brief zu sehen und
äußert als ihre Überzeugung, so könne es nicht darin stehen,
denn niemand nenne eine Frau nach dem Namen des Mannes,
und überdies sei der Korrespondentin der Vorname der Frau sehr
wohl bekannt. Ich verteidige meine Behauptung hartnäckig und
verweise auf die so gebräuchlichen Visitkarten, auf denen eine
Frau sich selbst mit dem Vornamen des Mannes bezeichnet. Ich
muß endlich den Brief zur Hand nehmen, und wir lesen darin
tatsächlich „der arme W. M.“, ja sogar, was ich ganz übersehen
hatte: „der arme Dr. W. M.“. Mein Versehen bedeutet also einen
sozusagen krampfhaften Versuch, die traurige Neuigkeit von dem
Marine auf die Frau zu überwälzen. Der zwischen Artikel,
Beiwort und Name eingeschobene Titel paßt schlecht zu der
Forderung, es müßte die Frau gemeint sein; Darum wurde er
auch beim Lesen beseitigt. Das Motiv dieser Verfälschung war
aber nicht, daß mir die Frau weniger sympathisch wäre als
der Mann, sondern das Schicksal des armen Mannes hatte meine
Besorgnisse um eine andere, mir nahe stehende Person rege
gemacht, welche eine der mir bekannten Krankheitsbedingungen
mit diesem Falle gemeinsam hatte.4) Ärgerlich und lächerlich ist mir ein Verlesen, dem ich sehr
häufig unterliege, wenn ich in den Ferien in den Straßen einer
fremden Stadt spaziere. Ich lese dann jede Ladentafel, die dem
irgendwie entgegenkommt, als Antiquitäten. Hierin äußert
sich die Abenteuerlust des Sammler-s.5) Bleuler erzählt in seinem bedeutsamen Buche „Affek-
tivität, Suggestibilität, Paranoia“ (1906), S. 121: „Beim Lesen
hatte ich einmal das intellektuelle Gefühl, zwei Zeilen weiter
unten meinen Namen zu sehen. Zu meinem Erstaunen finde ich
nur das Wort ,Blutkörperchen‘. Unter vielen Tausenden von mir
analysierten Verlesungen des peripheren wie des zentralen Gesichts—
feldes ist dieses der krasseste Fall. Wenn ich etwa meinen NamenS.
VI. Verlesen und Verscbreiben 125
zu sehen glaubte, so war das Wort, das dazu Anlaß gab, meinem
Namen meist viel ähnlicher, in den meisten Fällen mußten
geradezu alle Buchstaben des Namens in der Nähe vorhanden
sein, bis mir ein solcher Irrtum begegnen konnte. In diesem Falle
ließ sich aber der Beziehungswahn und die Illusion sehr leicht
begründen: Was ich gerade las, war das Ende einer Bemerkung
über eine Art schlechten Stils von wissenschaftlichen Arbeiten,
von der ich mich nicht frei fühlte.“6) H. Sachs: „An dem, was die Leute frappiert, geht er in
seiner Steifleinenheit vorüber.“ Dies Wort fiel mir aber
auf und ich entdeckte bei näherem Hinsehen, daß es Stil-
feinheit hieß. Die Stelle fand sich in einer überschwenglich
lebenden Auslassung eines von mir verehrten Autors über einen
Historiker, der mir unsympathisch ist, weil er das ‚Deutsch-
Professorenhafte‘ zu stark hervorkehrt.“7) Über einen Fall von Verlesen im Betriebe der philologischen
Wissenschaft berichtet Dr. Marcell Eibenschütz im Zentral-
blatt für Psychoanalyse, I, 5/6. „Ich beschäftige mich mit. der
Überlieferung des ‚Buches der Märtyrer‘, eines mittelhochdeutschen
Legendenwerkes, das ich in den ‚Deutschen Texten des Mittel—
alters‘, herausgegeben von der Preußischen Akademie der Wissen—
schaften, edieren soll. Über das bisher noch ungedruckte Werk war recht
wenig bekannt; es bestand eine einzige Abhandlung darüber von I.
Haupt ‚Über das mittelhochdeutsche Buch der Märtyrer‘, Wiener
Sitzungsberichte, 1867, 70. Bd., S. 101 ff. — Haupt legte seiner
Arbeit nicht eine alte Handschrift zugrunde, sondern eine aus neuerer
Zeit (XIX. Jahrhundert) stammende Abschrift der Haupthandschrift
C (Klosterneuburg), eine Abschrift, die in der Hofbibliothek auf-
bewahrt wird. Am Ende dieser Abschrift steht folgende Subskription:Anno Domz'ni MDCCCL in vigilia czaltaa'onis sancze Urucis ceptua est
isle liber er in uigilia pam: anni subsequentis finitux cum adiutaria
omnipotentix per me Hartmamun. de Krama tum: temporis eaclesie niwen-
burgensis autoriem.S.
124 Zur Psychopathalogie des Alltagslebens
Haupt teilt nun in seiner Abhandlung diese Subscriptio mit, in der
Meinung, daß sie vom Schreiber von C selbst herrühr'e, und läßt C,
mit konsequenter Verlesung der römisch geschriebenen Jahreszahl
1850,im1ahre 1550 geschrieben sein, trotzdem daß er die Subscriptio
Vollständig richtig kopiert hat, trotzdem daß sie in der Abhandlung am
angeführten Orte vollständig richtig (nämlich MDCCCL) abgedmckt ist.Die Mitteilung Haupts bildete für mich eine Quelle von
Verlegenheiten. Zunächst stand ich als blutjunger Anfänger in
der gelehrten Wissenschaft ganz unter der Autorität Haupts
und las lange Zeit aus der vollkommen klar und richtig gedruckt
vor mir liegenden Subscriptio wie Haupt 1550 statt 1850;
doch in der von mir benutzten Haupthandschrift C war keine
Spur irgend einer Subscriptio zu finden, es stellte sich ferner
heraus, daß im ganzen XIV. Jahrhundert zu Klosterneuburg kein
Mönch namens Hartmann gelebt hatte. Und als endlich der
Schleier von meinen Augen sank, da hatte ich auch schon den
ganzen Sachverhalt erraten, und die weiteren Nachforschungen
bestätigen meine Vermutung: die vielgenannte Subscriptio steht
nämlich nur in der von Haupt benutzten Abschrift und rührt
von ihrem Schreiber her, P. Hartman Zeibig, geb. zu Krasna in
Mähren, Augustinerchorherr zu Klosterneuburg, der im Jahre 1850
als Kirchenschatzmeister des Stiftes die Handschrift C abgeschrieben
und sich am Ende seiner Abschrift in altenümlicher Weise selbst
nennt. Die mittelalterliche Diktion und die alte Orthographie der
Subscriptio haben wohl bei dem Wunsche Haupts, über das
von ihm behandelte Werk möglichst viel mitteilen zu können,
also auch die Handschrift C zu datieren, mitgeholfen, daß
er statt 1850 immer 1550 las. (Motiv der Fehlhandlung.)“8) In den „Witzigen und Satirischen Einfällen“ von Lichten-
berg findet sich eine Bemerkung, die wohl einer Beobachtung
entstammt und fast die ganze Theorie des Verlesens enthält: Er
las immer Agamemnon statt „angenommen“, so sehr hatte
er den Homer gelesen.S.
VI. Verlesm und Verschrziben 125
In einer übergroßen Anzahl von Fällen ist es nämlich die
Bereitschaft des Lesers, die den Text verändert und etwas, worauf
er eingestellt oder womit er beschäftigt ist, in ihn hineinliest.
Der Text selbst braucht dem Verlesen nur dadurch entgegen—
zukommen, daß er irgend eine Ähnlichkeit im Wortbild bietet,
die der Leser in seinem Sinne verändern kann. Flüchtiges Hin-
schauen, besonders mit unkonigiertem Auge, erleichtert ohne
Zweifel die Möglichkeit einer solchen Illusion, ist aber keineswegs
eine notwendige Bedingung für sie.9) Ich glaube, die Kriegszeit, die bei uns allen gewisse feste
und langanhaltende Präokkupationen schuf, hat keine andere
Fehlleistung so sehr begünstigt wie gerade das Verlesen. Ich
konnte eine große Anzahl von solchen Beobachtungen machen,
von denen ich leider nur einige wenige bewahrt habe. Eines
Tages greife ich nach einem der Mittags— oder Abendblätter und
finde darin groß gedruckt: Der Friede von Görz. Aber nein,
es heißt ja nur: Die Feinde vor Görz. Wer gerade zwei
Söhne als Kämpfer auf diesem Kriegsscheuplatze hat, mag sich
leicht so verlesen. Ein anderer findet in einem gewissen Zusammen—
hange eine alte Brotkarte erwähnt, die er bei besserer
Aufmerksamkeit gegen alte Brokate eintauschen muß. Es ist
immerhin mitteilenswert, daß er sich in einem Hause, wo er oft
gern gesehener Gast ist, bei der Hausfrau durch die Abtretung
von Brotkarten beliebt zu machen pflegt. Ein Ingenieur, dessen
Ausrüstung der im Tunnel während des Baues herrschenden
Feuchtigkeit nie lang gewachsen ist, liest zu seinem Erstaunen
in einer Annonce Gegenstände aus „Schundleder“ angepriesen.
Aber Händler sind selten so aufrichtig; was da zum Kaufe empfohlen
wird, ist Seehundleder.Der Beruf oder die gegenwärtige Situation des Lesers bestimmt
auch das Ergebnis seines Verlesens. Ein _Philologe, der wegen
seiner letzten trefflichen Arbeiten im Streite mit seinen Fach-
genossen liegt, liest „Sprachstrategie“ anstatt Schach-S.
196 Zur Psychopathologiz des Alltagsleben:
strategie. Ein Mann, der in einer fremden Stadt spazieren geht,
gerade um die Stunde, auf welche seine durch eine Kur hergestellte
Danntätigkeit reguliert ist, liest auf einem großen Schilde im
ersten Stock eines hohen Warenhauses: „Klosetthaus“; seiner
Befriedigung darüber mengt sich doch ein Befremden über die
ungewöhnliche Unterbringung der iwohltätigen Anstalt bei. Im
nächsten Moment ist die Befriedigung doch geschwunden, denn
die Tafelaufschrift heißt richtiger: Korsetthaus.10) In einer zweiten Gruppe von Fällen ist der Anteil des
Textes am Verlesen ein bei weitem größerer. Er enthält etwas,
was die Abwehr des Lesers rege macht, eine ihm peinliche Mit-
teilung oder Zurnntung, und erfährt darum durch das Verlesen
eine Korrektur im Sinne der Abweisung oder Wunscherfüllung.
Es ist dann natürlich unabweisbar anzunehmen, daß der Text
zunächst richtig aufgenommen und beurteilt wurde, ehe er diese
Korrektur erfuhr, wenngleich das Bewußtsein von dieser ersten
Lesung nichts erfahren hat. Das Beispiel 5 auf den vorstehenden
Seiten ist von dieser Art; ein anderes von höchster Aktualität
teile ich hier nach Dr. M. Eitingon (z. Z. im Kriegsspital in
Iglö, Internat. Zeitschr. f. Psychoanalyse, IL 1915) mit.„Leutnant X., der sich rnit einer kriegstraumatischen Neurose
in unserem Spital befindet, liest mir eines Tages den Schlußvers
der letzten Strophe eines Gedichtes des so früh gefallenen Dichters
Walter Heymann‘ in sichtlicher Ergriffenheit folgendermaßen vor:Wo aber steht’s geschrieben, frag’ ich, daß von allen
Ich übrig bleiben soll, ein and.rer für mich fallen?
Wer immer von euch fällt, der stirbt gewiß für mich;
Und ich soll übrig bleiben? warum denn nicht?
Durch mein Befremden aufmerksam gemacht, liest er dann,
etwas betreten, richtig:Und ich soll übrig bleiben? _warum denn ich?
]) W. H e y m a n n: Kriegsgedichte und. Feldpostbriefe‚ p. 11: „Den Ausziehenden.“
S.
VI. Verlesen und Verscl1räben 127
Dem Fall X. verdanke ich einigen analytischen Einblick in das
psychische Material dieser ,Traumatischen Neurosen des Krieges‘,
und da war es mir möglich, trotz der unserer Art zu arbeiten
so wenig günstigen Verhältnisse eines Kriegslazaretts mit starkem
Belag und wenig Ärzten, ein wenig über die als ,Ursache‘ hoch—
bewerteten Granatexplosionen hinauszusehen.Es bestanden auch in diesem Falle die schweren Tremores,
die den ausgesprochenen Fällen dieser Neurosen eine auf den
ersten Blick frappante Ähnlichkeit verleihen, Ängstlichkeit, Weiner-
lichkeit, Neigung zu Wutanf‘ällen mit konvulsiven, infantil—
motorischen Entäußerungen und zu Erbrechen (‚bei geringsten
Aufregungen‘). 'Gerade des letzteren Symptoms Psychogeneität, zunächst im
Dienste sekundären Krankheitsgewinnes, mußte sich jedem auf-
drärigen: Das Erscheinen des Spitalskommandanten, der von Zeit
zu Zeit die Genesenden äch ansieht, auf der Abteilung, die
Phrase eines Bekannten ‚auf der Straße: ‚Sie schauen ja prächtig
aus, sind gewiß schon gesund‘, genügen zur prompten Auslösung
eines Brechanfalls.‚Gesund... wieder einrücken... warum denn ich?...‘ “
11) Andere Fälle von „Kriegs“-Verlesen hat Dr. Hanns Sachs
mitgeteilt: „„Ein naher Bekannter hatte mir wiederholt erklärt, er werde,
wenn die Reihe an ihn komme, keinen Gebrauch von seiner,
durch ein Diplom bestätigten Fachausbildung machen, sondern
auf den dadurch begründeten Anspruch auf entsprechende Ver;
wendung im Hinterlande verzichten und zum Frontdienst ein-
rücken. Kurz bevor der Termin wirklich herankam, teilte er mir
eines Tages in knappster Form, ohne weitere Begründung mit,
er habe die Nachweise seiner Fachbildung an zuständiger Stelle
vorgelegt und werde infolgedessen demnächst seine Zuteilung für
eine industrielle Tätigkeit erhalten. Am nächsten Tage trafen WirS.
128 Zur Psychopathalogfe des Alltagslebens
uns in einem Amtslokal. Ich stand gerade vor einem Pulte und
schrieb; er trat heran, sah mir eine Weile über die Schulter und
sagte dann: Ach, das Wort da oben heißt ‚Druckhogen‘ —
ich habe es für ‚Drückeberger‘ gelesen.“ (Internat. Zeitschr.
f. Psychoanalyse, IV. 1916/ 17.)12) „In der Tramway sitzend, dachte ich darüber nach, daß
manche meiner Jugendfreunde, die immer als zart und schwäch-
lich gegolten hatten, jetzt die allerhärtesten Strapazen zu ertragen
imstande sind, denen ich ganz bestimmt erliegen würde. Mitten in
diesem unerfi‘eulichen Gedankenzuge las ich im Vor-überfahren mit
halber Aufmerksamkeit die großen schwarzen Lettern einer Firma—
tafel: ‚Eisenkonstitution‘. Einen Augenblick später fiel mir
ein, daß dieses Wort für eine Geschäftsaufschrift nicht recht passe;
mich rasch umdrehend, erhaschte ich noch einen Blick auf die
Inschrift und sah, daß sie richtig ‚Eisenkonstruktion‘
lautete“. (L. c.)15) „In den Abendblättern stand die inzwischen als unrichtig
erkannte Reuterdepesche, daß Hughes zum Präsidenten der
Vereinigten Staaten gewählt sei. Anschließend daran erschien ein
kurzer Lebenslauf des angeblich Gewählten und in diesem stieß
ich auf die Mitteilung, daß Hughes in Bonn Universitätsstudien
absolviert habe. Es schien mir sonderbar, daß dieses Umstandes in
den wochenlangen Zeitungsdebatten, die dem Wahltag voran-
.gegangen waren, keine Erwähnung geschehen war. Nochmalige
Übelprüfi1ng ergab denn auch, daß nur von der ‚Brown‘-Uni—
versität die Rede war. Dieser krasse Fall, bei dem für das
Zustandekommen des Verlesens eine ziemlich große Gewaltsam-
keit notwendig war, erklärt sich außer aus der Flüchtigkeit bei
der Zeitungslektüre vor allem daraus, daß mir die Sympathie
des neuen Präsidenten für die Mittelmächte als Grundlage
künftiger guter Beziehungen nicht bloß aus politischen, sondern
auch darüber hinaus aus persönlichen Gründen wünschenswert
schien.“ (L. c.)S.
VI. Verlesen und Verschreiben mg
B) VERSCHREIBEN
\) Auf einem Blatte, welches kurze tägliche Aufzeichnungen
meist von geschäfllichem Interesse enthält, finde ich zu meiner
Überraschung mitten unter den richtigen Daten des Monats Sep-
tember eingeschlossen das verschriebene Datum „Donnerstag, den
20. Okt.“. Es ist nicht schwierig, diese Antizipation aufzuklären,
und zwar als Ausdruck eines Wunsches.‘ Ich bin wenige Tage
vorher frisch von der Ferienreise zurückgekehrt und fühle mich
bereit für ausgiebige ärztliche Beschäftigung, aber die Anzahl der
Patienten ist noch gering. Bei meiner Ankunft fand ich einen
Brief von einer Kranken vor, die sich für den 20. Oktober
ankündigte. Als ich die gleiche Tageszehl im September nieder-
schrieb, kann ich wohl gedacht haben: Der X. sollte doch schon
da sein; wie schade um den vollen Monat! und in diesem
Gedanken rückte ich das Datum vor. Der störende Gedanke ist
in diesem Falle kaum ein anstößiger zu nennen; dafür weiß ich
auch sofort die Auflösung des Schreibfehlers, nachdem ich ihn
erst bemerkt habe. Ein ganz analoges und ähnlich motiviertes
Verschreiben wiederhole ich dann im Herbst des nächsten Jahres.
—— E. Jones hat ähnliche Verschreibungen im Datum studiert
und sie in den meisten Fällen leicht als motivierte erkannt.2) Ich erhalte die Korrektur meines Beitrags zum „Jahresbericht
für Neurologie und Psychiatrie“ und muß natürlich mit besonderer
Sorgfalt die Automamen revidieren, die, weil verschiedenen Nationen
angehörig, dem Setzer die größten Schwierigkeiten zu bereiten
pflegen. Manchen fremd klingenden Namen finde ich wirklich
noch zu korrigieren, aber einen einzigen Namen hat merkwürdiger— '
weise der Setzer gegen mein Manuskript verbessert7 und zwar
mit vollem Rechte Ich hatte nämlich Buckrhard geschrieben,
während der Setzer Burckhard erriet. Ich hatte die Abhandlung
eines Geburtshelfers über den Einfluß der Geburt auf die Ent—
stehung der Kinderlähmungen selbst als verdienstlich gelobt, wü.ßteS.
150 Zur Psychopathologie des Alltagslebens
auch nichts gegen deren Autor zu sagen, aber den gleichen Namen
wie er trägt auch ein Schriftsteller in Wien, der mich durch eine
unverständige Kritik über meine „Traumdeutung“ geärgert hat.
Es ist gerade so, als hätte ich mir bei der Niederschrift des Namens
Burckhard, der den Gehurtshelfer bezeichnete, etwas Arges über
den anderen B., den Schriftsteller, gedacht, denn Namenverdrehen
bedeutet häufig genug, wie ich schon beim Versprechen erwähnt
habe, Schmähung‘.5) Diese Behauptung wird sehr schön durch eine Selbstheobach-
tung von A. J. Storfer bekräftigt, in welcher der Autor mit
rühmenswerter Offenheit die Motive klarlegt, die ihn den Namen
eines vermeintlichen Konkurrenten falsch erinnern und dann
entstth niederschreiben hießen:„Im Dezember 1910 sah ich im Schaufenster einer Züricher
Buchhandlung das damals neue Buch von Dr. Eduard Hitschmann
über die Freudsche Neurosenlehre. Ich arbeitete damals geradeam
Manuskript eines Vortrags, den ich demnächst in einem akademischen
Verein über die Grundzüge der Freudschen Psychologie halten
sollte. In der damals schon niedergeschriebenen Einleitung des
“Vortrags hatte ich auf die historische Entwicklung der Freudschen
Psychologie aus Forschungen auf einem angewandten Gebiete, auf
gewisse, daraus folgende Schwierigkeiten einer zusammenfassenden
Darstellung der Grundzüge hingewiesen, und darauf, daß noch
keine allgemeine Darstellung bestehe. Als ich das Buch (des mir
bis dahin unbekannten Autors) im Schaufenster sah, dachte ich
zunächst nicht daran, es zu kaufen. Einige Tage nachher beschloß
ich aber, es zu tun. Das Buch war nicht mehr im Schaufenster.
Ich nannte dem Buchhändler das vor kurzem erschienene Buch;1) Vgl, etwa die Stelle im „Julius Cäsar“, III, 5:
CINNA. Ehrlich, mein Name ist Cinna.
BÜRGER. Heißt ihn in Stücke! er ist ein Verschworenel'.
CINNA. Ich bin Cinna der Poet! Ich bin nicht Cinna der Verschworene.
BURGER. Es tut nichts; sein Name ist Cilmi, reißt ihm den Namen aus dem
Herzen und laßt ihn laufen.S.
V I . Verlesen und Verschreiben 151
als Autor nannte ich ‚Dr. Eduard Hartmann‘. Der Buchhändler
verbesserte: ‚Sie ineinen wohl Hitsohmann‘, und brachte mir das
Buch.Das unbewußte Motiv der Fehlleistung war naheliegend. Ich
hatte es mir gewissermaßen zum Verdienst angerechnet, die Grund—
züge der psychoanaly‘tischen Lehren zusammengefaßt zu haben und
habe offenbar das Buch Hitschmanns als Minderer meines Verdienstes
mit Neid und Ärger angesehen. Die Abänderung des Namens sei
ein Akt der unbewußten Feindseligkeit, sagte ich mir nach der
‚Psychopathologie des Alltagslebens‘. Mit dieser Erklärung gab ich
mich damals zufrieden.Einige Wochen später notierte ich mir jene Felflleistung. Bei
dieser Gelegenheit warf ich auch die Frage auf, warum ich
Eduard Hitschrnann gerade in Eduard Hartmann umgeändert
hatte. Sollte mich bloß die Namensähnlichkeit auf den Namen des
bekannten Philosophen geführt haben? Meine erste Assoziation
war die Erinnerung an einen Ausspruch, den ich einmal von
Professor Hugo v. Meltzl, einem begeisterten Schopenhauerverehrer,
gehört hatte und der ungefähr so lautete: ‚Eduard v. Hartmann
ist der verhunzte, der auf seine linke Seite umgestülpte Schopen-
hauer‘. Die affektive Tendenz, durch die das Ersatzgebilde für den
vergessenen Namen determiniert war, war also: ‚Ach, an diesem
Hirschmann und seiner zusammenfassenden Darstellung wird wohl
nicht viel daran sein; er verhält sich wohl zu Freud wie Hart-
mann zu Schopenhauer‘.Ich hatte also diesen Fall eines determinierten Vergessens mit
Ersatzeinfall niedergeschrieben.Nach einem halben Jahre kam mir das Blatt, auf dem ich die
Aufzeichnung gemacht hatte, in die Hand. Da bemerkte ich, daß
ich statt Hitschmann durchwegs Hintschmann geschrieben hatte.“
(Internat. Zeitschr. f. Psychoanalyse, II, 1914).4.) Ein anscheinend ernsterer Fall von Verschreiben, den ich
vielleicht mit ebensoviel Recht dem „Vergreifen“ einordnen könnte:9.
S.
152 Zur Psychopathobgie des Alltagsleben;
Ich habe die Absicht, mir aus der Postsparkasse die Summe von
500 Kronen kommen zu lassen, die ich einem zum Kurgebrauch
abwesenden Verwandten schicken will. Ich bemerke dabei, daß
mein Konto auf 4580 K lautet und nehme mir vor, es jetzt auf
die runde Summe von 4.000 K herunterzusetzen, die in der nächsten
Zeit nicht angegriffen werden soll. Nachdem ich den Scheck
ordnungsmäßig ausgeschrieben und die der Zahl entsprechenden
Ziffern ausgeschnitten habe, merke ich plötzlich, daß ich nicht
380 K, wie ich wollte, sondern gerade 458 bestellt habe, und
erschrecke über die Unzuverlässigkeit meines Tuns. Den Schreck
erkenne ich bald als unberechtigt; ich bin ja jetzt nicht ärmer
geworden, als ich vorher war. Aber ich muß eine ganze Weile
darüber nachsinnen, welcher Einfluß hier meine erste Intention
gestört. hat, ohne sich meinem Bewußtsein anzukündigen. Ich
gerate zuerst auf falsche VVeg-e, will die beiden Zahlen, 580 und
4.58, voneinander abziehen, weiß aber dann nicht, was ich mit
der Differenz anfangen soll. Endlich zeigt mir ein plötzlicher
Einde den wahren Zusammenhang. 458 entspricht ja zehn
Prozent des ganzen Kontos von 4580 K! 10% Rabatt hat man
aber beim Buchhändler. Ich besinne mich, daß ich vor wenigen
Tagen eine Anzahl medizinischer Werke, die ihr Interesse für
mich verloren haben, ausgesucht, um sie dem Buchhändler gerade
für 500 K anzubieten. Er fand die Forderung zu hoch und
versprach, in den nächsten Tagen endgültige Antwort zu sagen.
Wenn er mein Angebot annimmt, so hat er mir gerade die Summe
ersetzt7 welche ich für den Kranken verausgaben soll. Es ist nicht
zu verkennen, daß es mir um diese Ausgabe leid tun Der Affekt
bei der Wahrnehmung meines Irrtums läßt sich besser verstehen
als Furcht, durch solche Ausgaben am zu werden. Aber beides,
das Bedauern wegen dieser Ausgabe und die an sie geknüpfte
Verarmungsangst, sind meinem Bewußtsein völlig fremd; ich habe
das Bedauern nicht verspürt, als ich jene Summe zusagte, und
fände die Motivierung desselben lächerlich. Ich würde mir eineS.
VI. Ver-lesen und Verschreiben 155 '
solche Reg-ung wahrscheinlich gar nicht zutrauen, wenn ich nicht
durch die Übung in Psychoanalysen bei Patienten mit dem Ver-
drängten im Seelenleben ziemlich vertraut wäre, und wenn ich
nicht vor einigen Tagen einen Traum gehabt hätte, welcher die
nämliche Lösung erforderte‘. ’5) Nach W. Stekel zitiere ich folgenden Fall, für dessen
Authentizität ich gleichfalls einstehen kann: „Ein geradezu un-
glaubliches Beispiel im Verschreiben und Verlesen ist in der Redaktion
eines verbreiteten Wochenblattes vorgekommen. Die betreffende
Leitung wurde öffentlich als ‚käuflich‘ bezeichnet; es galt, einen
Artikel der Abwehr und Verteidigung zu schreiben. Das geschah
auch — mit großer Wärme und großem Pathos. Der Chefredakteur
des Blattes las den Artikel, der Verfasser selbstverständlich mehrmals
im Manuskript, dann noch im Bürstenabzug, alle waren sehr
befriedigt Plötzlich meldet sich der Korrektor und macht auf
einen kleinen Fehler aufmerksam, der der Aufmerksamkeit aller
entgangen war. Dort stand es ja deutlich: ‚Unsere Leser werden
uns das Zeugnis ausstellen, daß wir immer in eigennützigster
Weise für das Wohl der Allgemeinheit eingetreten sind.‘ Selbst—
verständlich sollte es uneigennützigster Weise heißen. Aber die
wahren Gedanken brachen mit elementarer Gewalt durch die
pathetische Rede.“6) Einer Leserin des „Fester Lloyd“, Frau Kata Levy in
Budapest, ist kürzlich eine ähnlich unbeabsichtigte Au£richtigkeit
in einer Äußerung aufgefallen, die sich das Blattam 1 1. Oktober 1918
aus Wien hatte telegraphieren lassen:„Als zweifellos darf auf Grund des absoluten Vertrauens-
verhältnisses, das während des ganzen Krieges zwischen uns und
dem deutschen Verbündeten geherrscht hat, vorausgesetzt werden,
daß die beiden Mächte in jedem Falle zu einer einmiitigen Ent-1) Es ist dies jener Traum, den ich in einer kurzen Abhandlung: „Über den
Traum“, (Nr. VIII der „Ga-emfragen des Nerven— und Seeleulebens“, hg. von
Löwenfeld und Kurella, 1901. — Enthalten in Bd. In dieser Gesamtausgabe)
zum Paradigma genommen habe.S.
154. Zur Psychapatholagie des Alltagslebens
schließung gelangen Würden. Es ist überflüssig, noch ausdrücklich
zu erwähnen, daß auch in der gegenwärtigen Phase ein reges und
lückenhaftes Zusammenarbeiten der verbündeten Diplomatien
stattfindet.“Nur wenige Wochen später konnte man sich über dieses „Ver—
trauensverhältnis“ freimütiger äußern, brauchte man nicht mehr
zum Verschreiben (oder Verdrucken) zu flüchten.7) Ein in Europa weilender Amerikaner, der seine Frau in
schlechtem Einvernehmen verlassen hat, glaubt, daß er sich nun
mit ihr versöhnen könne, und fordert sie auf, ihm zu einem
bestimmten Termin über den Ozean nachzukommen: „Es wäre
schön,“ schreibt er, „wenn Du wie ich mit der ,Mauretania‘
fahren könntest.“ Das Blatt, auf dem dieser Satz steht, getraut
er sich dann aber nicht abzuschicken. Er zieht es vor, es neu zu
schreiben. Denn er will nicht, daß sie die Korrektur bemerke,
die an dem Namen des Schiffes notwendig geworden war. Er
hatte nämlich anfänglich „Lusitania“ geschrieben.Dies Verschreiben bedarf keiner Erläuterung, es ist ohne weiteres ‘
deutbar. Doch läßt die Gunst des Zufalles noch einiges hinzufügen:
Seine Frau war vor dem Kriege zum erstenmal nach Europa
gefahren, nach dem Tode ihrer einzigen Schwester. Wenn ich
nicht irre, ist die „Mauretania“ das überlebende Schwesterschiff
der während des Krieges versenkten „Lusitania“.8) Ein Arzt hat ein Kind untersucht und schreibt nun ein
Rezept fiir dasselbe nieder, in welchem Alcohol vorkommt.
Die Mutter belästigt ihn während dieser Tätigkeit mit‘törichten
und überflüssigen Fragen. Er nimmt sich innerlich fest
vor, sich jetzt darüber nicht zu ärgern, führt diesen Vorsatz
auch durch, hat sich aber während der Störung verschrieben.
Auf dem Rezept steht anstatt Alcohol zu lesen Achol‘.g) Der stofflichen Verwandtschaft wegen reihe ich hier einen
Fall an, den E. Jones von A. A. Brill berichtet. Letzterer:|) Etwa: Keine Galle.
S.
VI. Verla-en. und Verschrzibm 155
hatte sich, obwohl sonst völlig abstinent, von einem Freunde
verleiten lassen, etwas Wein zu trinken. Am nächsten Morgen
gab ihm ein heftiger Kopfschmerz Anlaß, diese Nachgiebigkeit zu
bedauem. Er hatte den Namen einer Patientin niederzuschreiben,
die Ethel hieß, und schrieb anstatt dessen Ethyl‘. Es kam
dabei wohl auch in Betracht, daß die betreffende Dame selbst
mehr zu trinken pflegte, als ihr gut tut.Da ein Verschreiben des Arztes beim Rezeptieren eine Bedeutung
beansprucht, die weit über den sonstigen praktischen Wert der
Fehlleistungen hinausgeht, bediene ich mich des Anlasses, um die
einzige bis jetzt publizierte Analyse von solchem ärztlichen
Verschreiben ausführlich mitzuteilen:10) Dr. Ed. Hitschmann (Ein wiederholter Fall von
Verschreiben bei der Rezeptiemng): „Ein Kollege erzählte mir,
es sei ihm im Laufe der Jahre mehrmals passiert, daß er
sich beim Verschreiben eines bestimmten Medikaments für _weib-
liche Patienten vorgeschrittenen Alters irrte. Zweimal verschrieb
er die zehnfache Dosis und mußte nachher, da ihm dies plötzlich
einfiel, unter größter Angst, der Patientin geschadet zu haben
und selbst in größte Unannehmlichkeit zu kommen, eiligst die
Zurückziehung des Rezepts anstreben. Diese sonderbare Symptom-
handlung verdient durch genauere Darstellung der einzelnen Fälle
und durch Analyse klargelegt zu werden.Erster Fall: Der Arzt verschreibt einer an der Schwelle des
Greisenalters stehenden armen Frau gegen spastische Obstipation
zehnfach zu starke Belladonna—Zäpfchen. Er verläßt das Ambulatorium
und etwa eine Stunde später fällt ihm zu Hause, während er
Zeitung liest und frühstückt, plötzlich sein Irrtum ein; es über—
fällt ihn Angst, er eilt zunächst ins Ambulatorium zurück, um
die Adresse der Patientin zu requirieren, und von dort in ihre
weit entlegene Wohnung. Er findet das alte Weiblein noch mit
unausgeführtem Rezept, worüber er höchst erfreut und beruhigt1\ Äthylalkohol.
S.
156 Zur Psychopathologiz des Alltagsleben:
heimkehrt. Er entschuldigt sich vor sich selbst nicht ohne
Berechtigung damit, daß ihm der gesprächige Chef der Ambulanz
während der Rezeptur über die Schulter geschaut und ihn
gestört hatte.Zweiter Fall: Der Arzt muß sich aus seiner Ordination von
einer koketten und pikant schönen Patientin losreißen, um ein
älteres Fräulein ärztlich aufzusuchen. Er benützt ein Automobil,
da er nicht viel Zeit für diesen Besuch übrig hat; denn er soll
um eine besüminte Stunde, nahe von ihrer Wohnung, ein
geliebtes junges Mädchen heimlich treffen. Auch hier ergibt}sich
die Indikation für Belladonna wegen analoger Beschwerden wie
im ersten Falle. Es wird wieder der Fehler begangen, das
Medikament zehnfach zu stark zu rezeptieren. Die Patientin bringt
einiges nicht zum Gegenstand gehörige Interessante vor, der Arzt
aber verrät Ungeduld, wenn er sie auch mit Worten verleugnet,
und verläßt die Patientin, so daß er reichlich zurecht zum
Rendezvous erscheint. Etwa zwölf Stunden nachher, gegen sieben
Uhr morgens, erwacht der Arzt; der Einfall seines Verschreibens
und Angst treten fast gleichzeitig iu sein Bewußtsein, und er
sendet, rasch zu der Kranken, in der Hoffnung, daß das Medi—
kament noch nicht aus der Apotheke geholt sei, und bittet um
Rückstellung des Rezepts, um es zu revidieren. Er erhält jedoch
das bereits ausgeführte Rezept zurück und begibt sich mit einer
gewissen stoischen Resignation und dem Optimismus des Erfahrenen
in die Apotheke, wo ihn der Provisor damit beruhigt, daß er
selbstverständlich (oder vielleicht auch durch ein Versehen?) das
Medikament in einer geringeren Dosis verabreicht habe.Dritter Fall: Der Arzt will seiner greisen Tante, Schwester
seiner Mutter, die 1VIischung von Tinct. belladonnae und Tinct.
opii in harmloser Dosis verschreiben. Das Rezept wird sofort
durch das Mädchen in die Apotheke getragen. Ganz kurze Zeit
später fällt dem Arzt ein, daß er anstatt tinctura ,extractum‘
geschrieben habe, und gleich darauf telephoniert der Apotheker,S.
VI. Verlesen und Verschr‘eiben 157
über diesen Irrtum interpellierend. Der Arzt entschuldigt sich
mit der erlogenen Ausrede, er hätte das Rezept noch nicht
vollendet gehabt, es sei ihm durch die unerwartet rasche Weg—
nehmung des Rezepts vom Tische die Schuld abgenommen.Die auffällig gemeinsamen Punkte dieser drei Irrtümer in der
Verschreibung sind darin gelegen, daß es dem Arzte nur bei
diesem einen Medikament bisher passiert ist, daß es sich jedesmal
um eine weibliche Patientin im vorgeschrittenen Alter handelte
und daß die Dosis immer zu stark war. Bei der kurzen Analyse
stellte es sich heraus, daß das Verhältnis des Arztes zur Mutter
von entscheidender Bedeutung sein mußte. Es fiel ihm nämlich
ein, daß er einmal — und zwar höchstwahrscheinlich vor diesen
Symptomhandlungen —» seiner gleichfalls greisen Mutter dasselbe
Rezept verschrieben hatte, und zwar in der Dosis von 0.05,
obwohl die gewöhnliche 0.09 ihm geläufiger war, um ihr radikal
zu helfen, wie er sich dachte. Die Reaktion der zarten Mutter
auf dieses Medikament war Kopfkongestion und unangenehme
Trockenheit im Rachen. Sie beklagte sich darüber mit einer halb
schenhaften Anspielung auf die gefährlichen Ordinationen, die'
von einem Sahne ausgehen können. Auch sonst hat die Mutter,
übrigens Amenstochter, gegen gelegentlich vom ärztlichen Sohne
empfohlene Medikamente ähnlich ablehnende, halb schemhafte
Einwendungen erhoben und vom Vergiften gesprochen.Soweit Referent die Beziehungen dieses Sohnes zu seiner Mutter
durchschaut, ist er zwar ein instinktiv liebevolles Kind, aber in
der geistigen Schätzung der Mutter und im persönlichen Respekt
keineswegs übertrieben. Mit dem um ein Jahr jüngeren Bruder
und der Mutter in gemeinsamem Haushalt lebend, empfindet er
dieses Zusammenscin seit Jahren für seine erotische Freiheit als
Hemmung, wobei wir allerdings aus psychoanalytischer Erfahrung
wissen, daß solche Begründungen zum Vorwand für inneres
Gebundensein gern mißbraucht werden. Der Arzt akzeptierte die
Analyse unter ziemlicher Befriedigung über die Aufklärung undS.
158 Zur Psychapathologie des Alltagslebens
meinte lächelnd, das Wort Belladonna = schöne Frau könnte
auch eine erotische Beziehung bedeuten. Er hat das Medikament
früher gelegentlich auch selbst verwendet.“ (Internat. Zeitschr. f.
Psychoanalyse, I, 1 g 1 5.)Ich möchte urteilen, daß solche ernsthafte Fehlleistungen auf
keinem anderen Wege zustandekommen als die harmlosen, die
wir sonst untersuchen.11) Für ganz besonders harmlos wird man das nachstehende,
von S. Ferenczi berichtete Verschreiben halten. Man kann es
als Verdichtungsleistung infolge von Ungeduld deuten (vergl. das
Versprechen: Der Apfe, S. 70) und wird diese Auffassung
verteidigen dürfen, bis nicht etwa eine eingehende Analyse des
Vorfalls ein stärkeres störendes Moment nachgewiesen hätte:„Hiezu paßt die Anektode“ — schreibe ich einmal in mein
Notizbuch. Natürlich meinte ich Anekdot e, und zwar von
einem zu Tode verurteilten Zigeuner, der sich die Gnade erbat,
selber den Baum zu wählen, auf den er gehängt werden soll.
(Er fand trotz eifi'igen Suchens keinen Passenden Baum.)12) Andere Male kann im Gegensatz hiezu der unscheinbarste
Schreibfehler gefährlichen geheimen Sinn zum Ausdruck bringen.
Ein Anonymus berichtet:„Ich schließe einen Brief mit den Worten: ,Herzlichste Grüße
an Ihre Frau Gemahlin und ihren Sohn.‘ Knapp bevor ich das
Blatt ins Kuvert stecke, bemerke ich den Irrtum im Anfangs—
buchstaben bei ‚ihren Sohn‘ und verbessere ihn. Auf dem Heimweg
von dem letzten Besuche bei diesem Ehepaar hatte meine
Begleiterin bemerkt, der Sohn sehe einem Hausfreund frappant
ähnlich und sei auch sicher sein Kind.“15) Eine Dame richtet an ihre Schwester einige beglück—
wünschende Zeilen zum Einzug in deren neue und geräumige
Wohnung. Eine dabei anwesende Freundin bemerkt, daß die
Schreiberin eine falsche Adresse auf den Brief gesetzt hat, und
zwar nicht die der eben verlassenen Wohnung, sondern die derS.
V [. Vorlesen und Verschreiben 159
ersten, längst aufgegebenen, welche die Schwester als eben
verheiratete Frau bezogen hatte. Sie macht die Schreiberin darauf
aufmerksam. Sie haben recht, muß diese zugeben, aber wie
komme ich darauf? Warum habe ich das getan? Die Freundin
meint: Wahrscheinlich gönnen Sie ihr die schöne große Wohnung
nicht, die sie jetzt bekommen soll, während Sie sich selbst im
Raum beengt fühlen, und versetzen sie darum in die erste
Wohnung zurück, in der sie es auch nicht besser hatte. —— Gewiß
gönne ich ihr die neue Wohnung nicht, gesteht die andere
ehrlich zu. Sie setzt dann fort: Wie schade, daß man bei diesen
Dingen immer so gemein ist!14.) E. Jones teilt folgendes, ihm von A. A. Brill über—‘
lassene Beispiel von Verschreiben mit: Ein Patient richtete an
Dr. Brill ein Schreiben, in welchem er sich bemühte, seine
Nervosität auf die Sorge und Erregung über den Geschäftsgang
während einer Baumwollkrise zurückzuführen. In diesem Schreiben
hieß es: my trouble is all due to that damned frigidl wave;
there is’nt even any seed. Er meinte mit „wave“ natürlich eine
Welle, Strömung auf dem Geldmarkt; in Wirklichkeit schrieb er
aber nicht wave, sondern wife. Auf dem Grunde seines Herzens
ruhten Vorwürfe gegen seine Frau wegen ihrer ehelichen Kälte
und ihrer Kinderlosigkeit, und er war nicht weit entfernt von
der Erkenntnis, daß die ihm aufgezwungene Entbehrung einen
großen Anteil an der Verursachung seines Leidens habe.15) Dr. K. Wagner erzählt von sich im Zentralblatt für
Psychoanalyse, I, 12:„Beim Durchlesen eines alten Kollegienheftes fand ich, daß
mir in der Geschwindigkeit des Mitschreibens ein kleiner Lapsus
unterlnufcn war. Statt ,Epithel‘ hatte ich nämlich ‚Edithel‘
geschrieben. Mit Betonung der ersten Silbe gibt das das
Diminutivum eines Mädchennamens. Die retrospektive Analyse
ist einfach genug. Zur Zeit des Verschreibens war die Bekannt—
schaft zwischen mir und der Trägerin dieses Namens nur eineS.
14.0 Zur Psychopatlwlogie des Alltagslebens
ganz oberflächliche, und erst viel später wurde daraus ein intimer
Verkehr. Das Verschreiben ist also ein hübscher Beweis für den
Durchbruch der unbewußten Neigung zu einer Zeit, wo ich
selbst eigentlich davon noch keine Ahnung hatte, und die gewählte
Form des Diminutivums charakterisiert gleichzeitig die begleitenden
Gefühle.“16) Frau Dr. v. Hug-Hellmuth: „Ein Arzt verordnet
einer Patientin Levitico— statt Levicowasser. Dieser Irrtum,
der einem Apotheker willkommenen Anlaß zu abfälligen Bemer—
kungen gegeben hatte, kann leicht einer milderen Auffassung
begegnen, wenn man nach den möglichen Beweggründen aus
dem Unbewußten forscht und ihnen, sind sie auch nur subjektive
Annahme eines diesem Arzte Fernstehenden, eine gewisse Wahr—
scheinlichkeit nicht von vornherein abspricht: Dieser Arzt erfreute
sich, trotzdem er seinen Patienten ihre wenig rationelle Ernährung
in ziemlich derben Worten vorhielt, ihnen sozusagen die
Leviten las, starken Zuspruchs, so daß sein Wartezimmer vor
und in der Ordinationsstunde dicht besetzt war, was den Wunsch
des Arztes rechtfertigte, das Ankleiden der absolvierten Patienten
möge sich möglichst rasch, vita, vita vollziehen. Wie ich mich
richtig zu erinnern glaubte, war seine Gattin aus Frankreich
gebürtig, was die etwas kühn scheinende Annahme, daß er sich
bei seinem Wunsche nach größerer Geschwindigkeit seiner
Patienten gerade der französischen Sprache bediente, einigermaßen
rechtfertigt. Übrigens ist es eine bei vielen Personen anzutreffende
Gewohnheit, solchen Wünschen in fremder Sprache Worte zu
verleihen, wie mein eigener Vater uns Kinder bei Spaziergängen
gern durch den Zuruf ‚Avanti giaventü‘ oder ‚Marchez au pas‘
zur Eile drängte, dagegen wieder ein schon recht bejahrter Arzt,
bei dem ich als junges Mädchen wegen eines Halsübels in
Behandlung stand, meine ihm allzu raschen Bewegungen durch
ein beschwichtigendes ‚Piano, piana‘ zu hemmen suchte. So
erscheint es mir recht gut denkbar, daß auch jener Arzt dieserS.
VI. Vsrksen und Verschreiben 14.1
Gewohnheit huldigte; und so ,verschreibt‘ er Levitico— — statt
Levicowasser.“ (Zentralblatt für Psychoanalyse, II, 5.)Andere Beispiele aus der Jugenderinnerung der Verfasserin
ebendaselbst (frazösisch statt französisch —— Verschreiben des
Namens Karl). '17) Ein Verschreiben, das sich inhaltlich mit einem bekannten
schlechten Witz deckt, bei dem aber die Witzabsicht sicherlich
ausgeschlossen war, danke ich der Mitteilung eines Herrn ]. G.,
von dem ein anderer Beitrag bereits Erwähnung gefunden hat:„Als Patient eines (Lungen-)Sanatoriums erfahre ich zu
meinem Bedanern, daß bei einem nahen Verwandten dieselbe
Krankheit konstatiert wurde, die mich zur Aufsuchung einer
Heilanstalt genötigt hat. In einem Briefe lege ich nun meinem
Verwandten nahe, zu einem Spezialisten zu gehen, einem bekannten
Professor, bei dem ich selbst in Behandlung stehe, und von dessen
medizinischer Autorität ich überzeugt bin, während ich anderseits
allen Grund habe, seine Unhöflichkeit zu beklagen; denn der
betreffende Professor hat mir —— erst kurze Zeit vorher —— die
Ausstellung eines Zeugnisses verweigert, das für mich von großer
Wichtigkeit war. In der Antwort auf meinen Brief werde ich
von meinem Verwandten auf einen Schreibfehler aufmerksam
gemacht, der mich, da ich seine Ursache augenblicklich erkannte,
außerordentlich erheiterte. Ich hatte in meinem Schreiben fol—genden Passus verwendet: ,. . . übrigens rate ich Dir, ohne
Verzögerung Prof. X. zu insultieren.‘ Natürlich hatte ich
konsultieren schreiben wollen. —- & bedarf vielleicht des Hin—weises darauf, daß meine Latein- und Französischkenntnisse die
Erklärung ausschalten, daß es sich um einen aus Unwissenheit
resultierenden Fehler handelte.“18) Auslassungen im Schreiben haben natürlich Anspruch auf
dieselbe Beurteilung wie Verschmibungen. Im Zentralblatt fiir
Psychoanalyse, I, 12, hat Dr. jur. B. Dattner ein merkwürdiges
Beispiel einer „historischen Fehlleistung“ mitgeteilt. In einem derS.
142 Zur Psychopathologie des Alltagslebens
Gesetzesartikel über finanzielle Verpflichtungen der beiden Staaten,
welche in dem Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn im
Jahre 1867 vereinbart wurden, ist das Wort effektiv in der
ungarischen Übersetzung weggeblieben, und Dattner macht es
wahrscheinlich, daß die unbewußte Strömung der ungarischen
Gesetza;redaktoren, Österreich möglichst wenig Vorteile zuzugestehen,
an dieser Auslassung beteiligt gewesen sei.Wir haben auch allen Grund anzunehmen, daß die so häufigen
Wiederholungen derselben Worte beim Schreiben und Abschreiben
— Perseverationen — gleichfalls nicht bedeutungslos sind, Setzt
der Schreiber dasselbe Wort, das er bereits geschrieben hat, noch
ein zweites Mal hin, so zeigt er damit wohl, daß er von diesem
Worte nicht so leicht losgekommen ist, daß er an dieser Stelle
mehr hätte äußern können, was er aber unterlassen hat, oder
ähnliches. [Die Perseveration beim Abschreiben scheint die Äußerung
eines „auch, auch ic “ zu ersetzen. Ich habe lange gerichts—
ärztliche Gutachten in der Hand gehabt, welche Perseverationen
von seiten des Abschreibers an besonders ausgezeiclmeten Stellen
aufwiesen, und hätte sie gern so gedeutet, als ob der seiner
unpersönlichen Rolle Überdrüssige die Glosse einfügen Würde: Ganz
mein Fall, oder ganz so wie bei uns.19) Es steht ferner nichts im Wege, die Druckfehler als „Ver-
schreibungen“ des Setzers zu behandeln und sie als größtenteils
motiviert aufzufassen. Eine systematische Sammlung solcher Fehl—
leistungen, die recht amüsant und lehrreich ausfallen könnte, habe
ich nicht angelegt. Jones hat in seiner hier mehrfach erwähnten
Arbeit den „Misprints“ einen besonderen Absatz gewidmet. Auch
die Entstehungen in Telegrammen lassen sich gelegentlich als
Verschreibungen des Telegraphisten verstehen. In den Sommer—
ferien trifft mich ein Telegramm meines Verlags, dessen Text
mir unbegreiflich ist. Es lautet:„Vorräte erhalten, Einladung X. dringend.“ Die Lösung
des Rätsels geht von dem darin erwähnten Namen X. aus. X. istS.
VI. Verlesen und Verschreiben 14.5
doch der Autor, zu dessen Buch ich eine Einleitung schreiben
5011. Aus dieser Einleitung ist die Einladung geworden. Dann darf
ich mich aber erinnern, daß ich vor einigen Tagen eine Vorrede
zu einem anderen Buch an den Verlag abgeschickt habe, deren
Eintreffen mir also so bestätigt wird. Der richtige Text hat sehr
wahrscheinlich so geheißen:„Vorrede erhalten, Einleitung X. dringend.“ Wir dürfen
annehmen, daß er einer Bearbeitung durch den Hunger-
komplex des Telegraphisten zum Opfer gefallen ist, wobei übrigens
die beiden Hälften des Satzes in innigeren Zusammenhang gebracht
wurden, als vom Absender beabsichtigt war. Nebstbei ein schönes
Beispiel von „sekundärer Bearbeitung“, wie Sie in den meisten
Träumen nachweisbar ist'.H. Silberer erörtert in der Internat. Zeitschrift für Psycho-
analyse, VHI, 1922, die Möglichkeit „tendenziöser Druckfehler.“Gelegentlich sind von Anderen Druckfehler aufgezeigt worden,
denen man eine Tendenz nicht leicht streitig machen kann, so von
Storf er im Zentralblatt für Psychoanalyse, II, 1914: „Der politische
Druckfehlerteufel“ und ibid. III, 1915, die kleine Notiz, die ich
hier abdrucke:90) „Ein politischer Druckfehler findet sich in der Nummer
des ,März‘ vom 95. April d. I. In einem Briefe aus Argyrokastm-n
wurden Äußerungen von Zographos, dem Führer der auf.
ständischen Epiroten in Albanien (oder wenn man will: dem
Präsidenten der unabhängigen Regierung des Epirus) wiedergegeben.
Unter anderem heißt es: ‚Glauben Sie mir; ein autonomer Epirus
läge im ureigensten Interesse des Fürsten Wied. Auf ihn könnte
er sich stürzen. . .‘ Daß die Annahme der Stütze, die ihm die
Epiroten anbieten, seinen Sturz bedeuten würde, weiß wohl der
Fürst von Albanien auch ohne jenen fatalen Druckfehler.“21) Ich las selbst vor kurzem in einer unserer Wiener Tages-
zeitungen einen Aufsatz „die Bukowina unter rumänischer1) Vgl. Traumdeutung, siebente Auflage, 1992, Abschnitt über die Traumurheit.
S.
144 Zur Psychopathobgiz des Alltagslebem
Herrschaft“, dessen Überschrift man zum mindesten als verfiüht
erklären durfte, denn damals hatten sich die Rumänen noch nicht
zu ihrer F eindseligkeit bekannt. Es hätte nach dem Inhalt unzweifel—
haft russisch anstatt rumänisch heißen müssen, aber auch dem
Zensor scheint die Zusammenstellung so wenig befremdend gewesen
zu sein, daß er selbst diesen Druckfehler übersah.Es ist schwer, nicht an einen „politischen“ Druckfehler zu denken,
wenn man in dem gedruckten Zirkular der rühmlich bekannten
(ehemaligen k. k. Hof—)Bnchdruckerei Karl Prochaska in Taschen
folgende orthographische Verschreibung liest:„P. T. Durch den Machtspruch der Entente wurde durch die Bestim-
mung des Olsaflusses als Grenze nicht nur Schlesien, sondern auch
Teschen in zwei Teile geteilt, von welchen einer Polen, der andere
der Tschecho-Slovakei zuviel.“In amüsanter Weise mußte sich Th. Fontane einmal gegen
einen allzu sinnreichen Druckfehler zur Wehre setzen. Er schrieb
am 99. März 1860 an den Verleger Julius Springer:Sehr geehrter Herr!
Es scheint mir nicht beschieden, meine kleinen Wünsche in
Erfüllung gehen zu sehen. Ein Einblick in den Korrekturhogen‘,
den ich beischließe, wird Ihnen sagen, was ich meine. Auch hat
man mit nur einen Bogen geschickt, wiewohl ich zwei, aus
angegebenen Gründen, brauche. Auch die Wiedereinsendung des
ersten Bogens zu nochmaliger Durchsicht — namentlich der
englischen Wörter und Sätze halber —— ist nicht erfolgt.
Mir liegt sehr daran. Seite 97 heißt es z. B. im heutigen Korrektur—
bogen in einer Szene zwischen John Knox und der Königin:
„worauf Maria aasrief.“ Solchen fulminanten Sachen gegenüber1) Es handelt sich um den Druck des 1860 bei Julius Springer erschienenen
Buches „Ja-nein des Tweed. Bilder und Briefe am Schottland.“S.
VI. Verlesen und Verschreilzen '14.5
will man gern die Beruhigung haben, daß der Fehler auch wirklich
beseitigt ist. Es ist dies unglückliche „aas“ statt „aus“ um so
schlimmer, als kein Zweifel ist, daß sie (die Königin) ihn im
stillen wirklich so genannt haben wird. Mit bekannter Hochachtung
Ihr ergebenster Th. Fontane.Wu ndt gibt eine bemerkenswerte Begründung für die leicht
zu bestätigende Tatsache, daß wir uns leichter verschreiben als
versprechen (l. c. S. 574). „Im Verlaufe der normalen Rede ist
fortwährend die Hemmungsfunktion des Willens dahin gerichttfl,
Vorstellungsverlauf und Artikulationsbewegung miteinander in
Einklang zu bringen. Wird die den Vorstellungen folgende Aus—
drucksbewegung durch mechanische Ursachen verlangsamt wie
beim Schreiben. . ., so treten daher solche Antizipationen besonders
leicht ein.“Die Beobachtung der Bedingungen, unter denen das Verlesen
auftritt, gibt Anlaß zu einem Zweifel, den ich nicht unerwähnt
lassen möchte, weil er nach meiner Schätzung der Ausgangspunkt
einer fruchtbaren Untersuchung werden kann. Es ist jedermann
bekannt, wie häufig beim Vorlesen die Aufmerksamkeit des
Lesenden den Text verläßt und sich eigenen Gedanken zuwendet;
Die Folge dieses Abschweifens der Aufmerksamkeit ist nicht
selten, daß er überhaupt nicht anzugeben weiß, was er gelesen
hat, wenn man ihn im’Vorlesen unterbricht und befragt. Er
hat dann wie automatisch gelesen, aber er hat fast immer richtig
vorgelesen. Ich glaube nicht, daß die Lesefehler sich unter solchen
Bedingungen merklich vermehren. Von einer ganzen Reihe von
Funktionen sind wir auch gewohnt anzunehmen, daß sie
automatisch, also von kaum bewußter Aufmerksamkeit begleitet,
am exaktesten vollzogen werden. Daraus scheint zu folgen, daß die
Aufmerksamkeitsbeding-ung der Sprech—, Lese- und Schreibfehler
anders zu bestimmen ist, als sie bei Wundt lautet (Wegfall
oder Nachlaß der Aufmerksamkeit). Die Beispiele, die wir der
Analyse unterzogen haben, gaben uns eigentlich nicht das Recht,Freud, IV 10
S.
146 Zur Psychopafhologi'z de.: Alltagsleben:
eine quantitative Verminderung der Aufmerksamkeit anzunehmen;
wir fanden, was vielleicht nicht ganz dasselbe ist, eine Störung
der Aufmerksamkeit durch einen fremden, Anspruch erhebenden
Gedanken.*
Zwischen „Verschreiben“ und „Vergessen“ darf man den Fall
einschalten, daß jemand eine Unterschrift anzubringen vergißt.
Ein nicht unterschriebener Scheck ist soviel wie ein ver—
gessener. Fiir die Bedeutung eines solchen Vergessens will ich
eine Stelle aus einem Roman anführen, die Dr. H. Sachs
aufgefallen ist:„Ein sehr lehrreiches und durchsichtiges Beispiel, mit welcher
Sicherheit die Dichter den Mechanismus der Fehl— und
Symptomhandlungen im Sinne der Psychoanalyse zu verwenden
wissen, enthält der Roman von John Galsworthy: ‚The
Island Pharisees.‘ Im Mittelpunkte steht das Schwanken eines
jungen Mannes, der dem reichen Mittelstand angehört, zwischen
tiefem sozialen Mitgefühl und den gesellschaftlichen Kon-
ventionen seiner Klasse. Im XXVI. Kapitel wird geschildert, wie
er auf einen Brief eines jungen Vagabunden reagiert, den er,
durch seine originelle Lehensauffassung angezogen, einigemal
unterstützt hatte. Der Brief enthält keine direkte Bitte um Geld,
aber die Schilderung einer großen Notlage, die keine andere
Deutung zuläßt. Der Empfänger weist zunächst den Gedanken
von sich, das Geld an einen Unverbesserlichen wegzuwerfen,
statt damit wohltätige Anstalten zu unterstützen. ‚Eine helfende
Hand, ein Stück von sich selbst, ein kameradschaflliches Nicken
einem Mitgeschöpf zu geben, ohne Rücksicht auf einen Anspruch,
nur weil es ihm eben schlecht ging, welch ein sentimentaler
Unsinn! Irgendwo muß der Scheidestn'ch gezogen werden!‘ Aber
während er diese Schlußfolgerung vor sich hinmurmelte, fühlte
er, wie seine Aufrichtigkeit Einspruch erhob: ,Schwindler! Du
willst dein Geld behalten, das ist alles!‘S.
freudgs4
118
–147