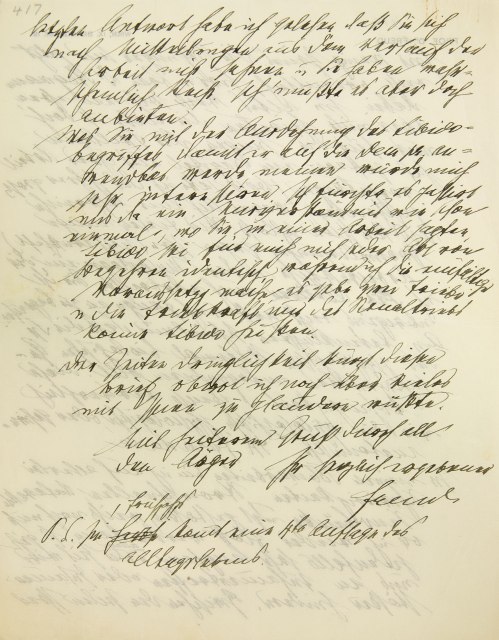-
S.
PROF. DR. FREUD. WIEN, IX. BERGGASSE 19.
30. Nov 11
Lieber Freund
Bleuler hat mir vorgestern seinen Austritt
u dessen Begründung aßgezeigt u diesen
Brief geschlossen: Ich wage zu hoffen, daß
Sie nach dem Geschehenen meinen Aus-
tritt für selbstverständlich und notwendig
finden u vor allem, daß er an unseren
persönlichen Beziehungen nichts ändere.“ Dieser
Satz gab mir das gute Recht, kritisch zu
antworten. Meine Antwort war gestern
schon festgestellt und ist heute – unbeein-
flußt durch Ihr früh angelangtes
Schreiben – abgeschickt worden.Ich weiß nicht, ob ich die Sache besser gemacht
habe, aber es waren mir „alle Knöpfe
gerissen an der Hose der Geduld.“
Es mag unpolitisch sein, aber endlich man
darf sich nicht maltraitiren lassen. Viel-
leicht lauert der andere auch nur auf
eine Tracht Prügel in seinen masoch.
Gelüsten. Die hat er nun bekom̄en;
seien Sie dessen versichert, obwol ich
Ihnen den Brief nicht einsenden kann
wie Sie mir den Maeder’schen, dessen
Rechtschaffenheit jedem Leser einleuchtet.
Was Bl. nun thun wird, weiß ich nicht, mag -
S.
ich auch nicht mehr in Betracht ziehen. Die ΨΑ
wird auch ohne ihn gehen u schließlich wird
er sich zwischen den zwei Stühlen auch
nicht besonders behaglich befinden.
Wenn es möglich sein sollte, daß er jetzt
seinen Groll gegen mich kehrt u sich
mit Ihnen u Maeder auseinandersetzen
will, so weiß ich ja doch, daß Sie es an
keinem Entgegenkom̄en fehlen lassen
werden. Der Maier sollte aber auf jeden Fall springen.Ich danke Ihnen für die Verfügung über
Bl.’s Alkoholaufsatz. Er wird morgen
an F. abgehen, begleitet von der Wieder-
holung Ihres Rates, u wird dann an Sie
zurückgehen oder direkt zu Deuticke,
wie Sie es Fer. anweisen wollen.Riklin läßt sich viel Zeit mit seinen
Sekretärpflichten. Für Pfister darf man
also wieder hoffen. Mit Halbheiten geht
es nie lange.Ob Sie sich von der Versam̄lung im
Herbst fern halten sollen, weiß ich
nicht. Es wäre eine gute Gelegenheit
auf Ihrem eigenen Boden die Feinde
mores zu lehren, meinetwegen auch
wieder einmal einen Vogt abzutun. -
S.
Hier wenig Neues. Die Sitzungen sind jetzt
recht ordentlich, Herr und Frau Dr Stegmann
dabei. Ein altes Weib soll man ehren,
aber nicht heiraten, die Liebe ist doch
nur für die Jungen. Die Spielrein
hat gestern ein Kapitel aus ihrer Arbeit
vorgetragen (bald hätte ich das Ihrer groß
geschrieben), woran sich eine lehrreiche
Diskussion schloß. Mir fielen einige
Formulirungen gegen Ihre (jetzt ernsthaft)
Arbeitsweise in der Mythologie ein, die
ich der Kleinen auch vorbrachte. Sie ist
übrigens recht nett u ich fange an zu begreifen.
Am bedenklichsten scheint mir, daß die Sp
das psychologische Material biologischen Ge-
sichtspunkten unterordnen will; diese
Abhängigkeit ist ebenso verwerflich
wie die philosophische, physiologische, oder gehirn-
anato mische. ΨΑ fara da se.In meinen Totemarbeiten bin ich auf allerlei
Schwierigkeiten, Stromschnellen, Katarakte,
Sandbänke, udgl. gestoßen, weiß noch nicht,
ob ich wieder flott werden kann. Es geht
jedenfalls sehr langsam, u allein die Zeit wird
uns an Zusam̄entreffen oder Zusam̄en-
stößen hindern. Zwischen den Zeilen Ihrer -
S.
letzte Antwort habe ich gelesen, daß Sie sich
nach Mitteilungen aus dem Verlauf der
Arbeit nicht sehnen, u Sie haben wahr-
scheinlich Recht. Ich mußte es aber doch
anbieten.Was sie mit der Ausdehnung des Libido-
begriffes, damit er auf die Dem pr. anwendbar werden, meinen, würde mich
sehr interessiren. Ich fürchte es passirt
uns da ein Unverständnis wie schon
einmal, wo Sie in einer Arbeit sagten,
Libodo sei für mich mit jeder Art von
Begehren identisch, während ich die einfältige
Voraussetzung mache, es gebe zwei Triebe
u die Triebkraft nur des Sexualtriebs
könne Libido heißen.Der Zeiten Dringlichkeit kürzt diesen
Brief, obwol ich noch über vieles
mit Ihnen zu plaudern wüßte.Mit heiterem Gruß durch all
den Ärger
Ihr herzlich ergebener
FreudP. S. Im
HerbstFrühjahr kom̄t eine 4te Auflage des
Alltagslebens.
Herr und Frau Dr Stegmann]
Arnold Stegmann
(1872–1914)
Gerichtsarzt und Psychiater
1911 Ehe mitAnna Margarete Stegmann.
Analysand von Sigmund Freud
1914 als Kriegsfreiwilliger bei Verdun gefallen.
Anna Margarete Stegmann (geb. Meyer)
* 12. Juli 1871 in Zürich
† 1. Juli 1936 in Arlesheim)
Nervenärztin, Psychoanalytikerin, Feministin, Reichstagsabgeordnete der SPD. Kunstsammlerin. Mitglieder der Berliner Ortsgruppe der internationalen Psychoanalytischen Vereinigung.
Leben
Anna Margarete Meyer, auch Marga genannt, wurde als zwölftes Kind eines Landwirts in Zürich geboren. Mit 16 Jahren war sie Vollwaise. Nach einem Postfachexamen war sie zunächst als Beamtin im Schweizerischen Postdienst tätig, u. a. als Korrespondentin der Kreispostdirektion Zürich. Nachdem sie auf dem zweiten Bildungsweg die Matura erworben hatte, studierte sie in Zürich und Bern Medizin. 1910 promovierte sie mit einer Arbeit über die Psychologie des Kindsmords. Darin versuchte sie aufzuzeigen, wie die Tat der Mutter mit den sozialen Umständen und ihrer Opferrolle als Frau zusammenhing.
1910 arbeitete sie zunächst als Assistenzärztin an einer Anstalt für Epileptiker in Zürich. 1911 ging sie nach Berlin und setzte ihre Assistenzzeit an der Charité bei Alfons Cornelius fort. 1911 heiratete sie den Gerichtsarzt und Psychiater Arnold Stegmann (1872–1914), der ein Analysand Sigmund Freuds war. Ihr Mann starb 1914 als Kriegsfreiwilliger bei Verdun, die Ehe blieb kinderlos. Anna Margarete Stegmann teilte mit ihm das Interesse an der Psychoanalyse, zusammen mit Mira Oberholzer-Gincburg, Tatjana Rosenthal und Karen Horney gehörte sie zu den ersten weiblichen Mitgliedern der Berliner Psychoanalytische Vereinigung. Ihre Lehranalyse absolvierte sie vermutlich bei Karl Abraham. Nach dem Tod ihres Mannes war sie mit dem 18 Jahre jüngeren Kunstwissenschaftler Karl Adrian befreundet. Auch diese, wohl glücklichere Verbindung, wurde durch den frühen Tod Adrians 1915 beendet. Das gemeinsame Interesse an der Zeitgenössischen Kunst behielt sie auch nach seinem Tod weiter und machte sie zu einer bedeutenden Kunstsammlerin Dresdens.[2][3]
1920 erhielt sie ihre Approbation als Ärztin für Deutschland und eröffnete eine Praxis als Allgemein- und Nervenärztin in Dresden.
Im Jahr 1918 trat Stegmann der SPD bei. Zwischen 1920 und 1924 war sie unbesoldete Stadträtin in Dresden. Von 1924 bis 1930 war sie Mitglied des Reichstages.
Sie war Mitglied der Schopenhauer-Gesellschaft, der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit[4] und arbeitete im Stadtbund Dresdner Frauenvereine mit.[5]
Wirken
Als Ärztin und Psychoanalytikerin befasste Stegmann sich mit der Psychogenese körperlicher Krankheiten und entwarf als erste eine Psychoanalyse der Krebserkrankung. Mit ihrem 1913 erschienenen Aufsatz über die Darstellung epileptischer Anfälle im Traum leistete sie Pionierarbeit auf dem Gebiet der Psychosomatik der Epilepsie. Als Ärztin und Politikerin hielt sie zahlreiche Vorträge zur Problematik der Alkoholabhängigkeit und zur Schädlichkeit des Tabakkonsums bei Jugendlichen.[3]
Als SPD-Mitglied gehörte sie 1920 zu den ersten weiblichen Stadträten Dresdens. 1924 wurde sie Abgeordnete des Reichstags und setzte sich dort vorrangig für soziale und frauenpolitische Themen ein. Dokumentiert ist u. a., dass sie sich in der zweiten Wahlperiode des Reichstages für das nie erlassene Bewahrungsgesetz engagierte, welches sich einerseits gegen die menschenunwürdige Unterbringung geistig behinderter und „asozialer“ Personen in Gefängnissen, Arbeitshäusern und Psychiatrien richtete, andererseits eine zwangsweise Unterbringung regeln sollte.[6][3]
In der Debatte um den § 218 argumentierte sie 1925 für ein Recht von Frauen auf Abtreibung.[7]
Ihr Wirken als Kunstsammlerin und der Umfang ihrer Sammlung ist noch nicht abschließend erforscht.[3] Bekannt ist, dass sie – wie Ida Bienert – zu den wenigen Sammlern in Dresden gehörte, die Werke zeitgenössischer Künstler kauften.[3] Sie gehörte zur Dresdener Ortsgruppe des 1916 von Ida Dehmel und Rosa Schapire gegründeten Frauenbunds zur Förderung der deutschen bildender Kunst, der die bildenden Künstler der Gegenwart fördern wollte und ihre Werke durch Schenkungen entgegen der Zeitströmung in die Museen zu bringen versuchte.[8] 1925 stiftete sie unter dem Titel „Karl-Adrian-Stiftung“ elf Werke aus ihrer Sammlung dem Dresdner Stadtmuseum, von denen später sechs in der Aktion „Entartete Kunst“ verbracht wurden.[9] Dabei handelte es sich um die erhaltenen Werke Heinrich Campendonks Badende Frauen mit Fisch (1915), Lyonel Feiningers Gelmeroda, Karl Schmidt-Rottluffs Sitzende Frau (1915), Emil Noldes Mädchen im Grünen (1915), Conrad Felixmüllers Angebetete und Eugen Hoffmanns Adam und Eva (1919). Weitere Werke der Schenkung, von Robert Genin, Emil von Gerliczy, Edmund Moeller und Wilhelm Lehmbruck gelten weiterhin als verschollen.[3]
Anhand von Katalogen konnten bis 2006 insgesamt 33 Ölbilder, fünf Aquarelle und zwei Plastiken der Sammlung Margarete Stegmann zugeordnet werden. Dazu gehören das Gemälde Genesendes Mädchen (1890) von Lovis Corinth, Landschaft mit Kühen von Heinrich Campendonk, Paul Klees Naturtheater (1914) und Vogel Reich (1918), Lasar Segalls Kaddisch von 1918 und Pablo Picassos Verschleierte Frau. Von Alexej Jawlensky, dem sie freundschaftlich verbunden war, besaß sie insgesamt 15 Werke aus den Jahren 1915 bis 1935. Einen besonderen Stellenwert nahmen die Werke von Emil Nolde ein, für dessen Werke sie sich sehr begeisterte und mit dem sie, wie mit anderen Künstlern, auch im persönlichen Austausch stand: Mädchen im Garten (1915), Mädchen und Lilie (1918), Jüngling und Mädchen (1919), Gutsherr (1920) und Blumenstrauß. In ihrem Zimmer hatte sie eine Nolde-Wand mit Werken und Briefen des Künstlers eingerichtet und ihre Briefe an Nolde zeigen eine tiefe persönliche Verbundenheit mit seinen Werken, in denen sie die eigenen Lebenserfahrungen gespiegelt sah.[3]
Werke (Auswahl)
Beitrag zur Psychologie des Kindsmords. Dissertation Leipzig 1910
Ein Fall von Namenvergessen. Zentralblatt für Psychoanalyse und Psychotherapie 2, 1912, 650f
Ein Vexiertraum. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 1, 1913, 486–489
Darstellung epileptischer Anfälle im Traum. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 1913, 560f
Identifizierung mit dem Vater. Zentralblatt für Psychoanalyse und Psychotherapie 1, 1913, 561f
Die §§ 218/219 des Strafgesetzes. Vierteljahresschrift des Bundes Deutscher Ärztinnen 1(2), 1924, 27–30
Die Psychogenese organischer Krankheiten und das Weltbild. Imago 12, 1926, 196–202
Frauenblindheit der Männer – eine alte Krankheit. Die Genossin 6, 1929, 229f
Stimmen gegen den § 218. Der Sozialistische Arzt 7, 1931, 100f
Weblinks
Biografie von Anna Margarete Stegmann. In: Heinrich Best, Wilhelm H. Schröder: Datenbank der Abgeordneten in der Nationalversammlung und den deutschen Reichstagen 1919–1933 (Biorab–Weimar).
Anna Margarete Stegmann in der Datenbank der Reichstagsabgeordneten
Einzelnachweise
Thomas Müller; Ludger M. Hermanns: Margarete Stegmann - Psychoanalytikerin, Reichstagsabgeordnete und Frauenrechtlerin. Luzifer-Amor 14 (27), 2001, 36–59
Margarete Stegmann bei Psychoanalytikerinnen in Deutschland. Abgerufen am 31. Mai 2018
Heike Biedermann: „Neuste Kunst sammeln im wesentlichen nur Frau Ida Bienert und Frau Dr. Stegmann...“: Die Sammlung Margarete Stegmann. In: Heike Biedermann et al.: Von Monet bis Mondrian: Meisterwerke der Moderne aus Dresdner Privatsammlungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dresden 2006, S. 91–99
Biografie von Anna Margarete Stegmann. In: Wilhelm H. Schröder: Sozialdemokratische Parlamentarier in den deutschen Reichs- und Landtagen 1876–1933 (BIOSOP)
Stadtmuseum Dresden (Hrsg.): 100 Jahre Frauenwahlrecht. Frauen wählen in Dresden. Dresden 2019, S. 10–11.
Matthias Willing: Das Bewahrungsgesetz (1918-1967). Eine rechtshistorische Studie zur Geschichte der deutschen Fürsorge. Mohr Siebeck, Tübingen 2003, S. 89
Ingo von Münch: Der Paragraph voll Blut und Tränen. Die Zeit vom 7. April 1972. Abgerufen am 2. Juni 2018
Rainer Stamm: Frauenbund in der Kunst: Mutige Verwirklichung weltfremder Pläne. Frankfurter Allgemeine vom 20. August 2017. Abgerufen am 2. Juni 2018
Uta Baier: Dresdens unbekannte Mäzene. Die Welt vom 26. September 2006. Abgerufen am 2. Juni 2018
Zur Diskussion über Jungs Ansichten in der WPV: Siehe Protokoll der WPV von diesem Tag in dieser Edition.
die Kleine]
Sabina Spielrein
* 07.11.1885 in Rostow, Russland
† 12.08.1942
Spielrein, Sabine (1912): Die Destruktion als Ursache des Werdens. Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen. 1912, (4):465-503.
Darin entwickelte Spielrein ein Konzept des Todestriebes, den sich nicht nur negativ sondern notwendig für weitere Entwicklung erachtete. Ohne Zerstörung gäbe es auch keine weitere Entwicklung. Das argumentiert sie nicht nur psychologisch sondern auch biologisch, der Zerfall der Zellen bilde die Grundlage für das Wachstum neuer Zellen.
Quelle: Heike Oldenburg, Jessica Thönnissen, Burkhart Brückner (2016): Spielrein, Sabina Nikolajewna.
In: Biographisches Archiv der Psychiatrie. URL: www.biapsy.de/index.php/de/9-biographien-a-z/242-spielrein-sabina-nikol… [19.08.2025]
Werke (Auswahl)
Spielrein, Sabina (1911): Über den psychologischen Inhalt eines Falles von Schizophrenie (Dementia praecox). In: Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen 3, S. 329-400.
Spielrein, Sabina (1912): Die Destruktion als Ursache des Werdens. In: Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen 4, S. 465-503.
Spielrein, Sabina (1920): Renatchens Menschenentstehungstheorie. In: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 6, (2), S. 155-157.
Spielrein, Sabina (1920a): Das Schamgefühl bei Kindern. In: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 6, (2), S. 157-158.
Spielrein, Sabina (1920b): Das schwache Weib. In: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 6, (2), S. 158.
Spielrein, Sabina (1920c): Verdrängte Munderotik. In: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 6, (4), S. 361-362.
Spielrein, Sabina (1923): Ein Zuschauertypus. In: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 9, (2), S. 210-211.
Posthume Veröffentlichungen, Sekundärliteratur, Filme
Spielrein, Sabina (1986): Werke. Freiburg: Kore.
Spielrein, Sabina (1986a): Die Destruktion als Ursache des Werdens. Tübingen: Edition Diskord.
Spielrein, Sabina (1987): Sämtliche Schriften. Freiburg: Kore.
Spielrein, Sabina (2007): Nimm meine Seele. Tagebücher und Schriften. Berlin: Der Freitag.
Spielrein, Sabina (2001): Tagebuch und Briefe. Die Frau zwischen Jung und Freud. Hg. von T. Hensch. Gießen: Psychosozial Verlag.
Stephan, I. (1992): Die Gründerinnen der Psychoanalyse. Eine Entmythologisierung Sigmund Freuds in zwölf Frauenporträts. Stuttgart: Kreuz.
Volkmann-Raue, S. (2002): Sabina Spielrein: Die Destruktion als Ursache des Werdens. In: S. Volkmann-Raue, H. E. Lück: Bedeutende Psychologinnen. Biographien und Schriften. Weinheim: Beltz Verlag, S. 39-55.
Ich hieß Sabina Spielrein. Dokumentarfilm, Deutschland 2002. Regie: Elisabeth Márton.
Prendimi l'anima. Spielfilm, Italien/Frankreich/Großbritannien 2003. Regie: Roberto Faenza.
Eine dunkle Begierde. Spielfilm, Kanada/Großbritannien/Deutschland 2011. Regie: David Cronenberg.
Quelle: Heike Oldenburg, Jessica Thönnissen, Burkhart Brückner (2016): Spielrein, Sabina Nikolajewna.
In: Biographisches Archiv der Psychiatrie. URL: www.biapsy.de/index.php/de/9-biographien-a-z/242-spielrein-sabina-nikol… [19.08.2025]fara de se]
L'Italia farà da sé: Kampfruf des Jungen Italien
"Junges Italien (italienisch Giovine Italia, auch Giovane Italia) war der Name einer von Giuseppe Mazzini 1831 in Marseille gegründeten politischen, radikaldemokratischen Vereinigung des Risorgimento (der Periode des italienischen Einigungsprozesses im 19. Jahrhundert), die zur Zeit des Metternichschen Systems eine unitarische, unabhängige italienische Republik schaffen wollte. Nach Einschätzung Metternichs hatte die Bewegung nie mehr als 1000 aktive Mitglieder, sie wurde jedoch indirekt von deutlich mehr Menschen unterstützt, indem diese bspw. ihre verbotenen Schriften lasen. Am 5. Mai 1848 wurde die Vereinigung endgültig aufgelöst, und Mazzini gründete an ihrer Stelle die Associazione Nazionale Italiana."
Quelle: https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=fara+da+se&ie=UTF-8&oe=UTF-8 [2025-08-19]
Berggasse 19
Wien 1090
Oostenryk
1003 Seestraße
Küsnacht 8700
Switserland
C32F25